Kommunikationswissenschaft Verantwortung Als Duft-Marke
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Stories of Capitalism: Inside the Role of Financial Analysts
Stories of Capitalism Stories of Capitalism InsIde the Role of fInancIal analysts Stefan Leins The University of Chicago Press Chicago and London publication of this book has been aided by grants from the bevington fund and the swiss national science foundation. This work is being made available under the Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0). To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ The University of Chicago Press, Chicago 60637 The University of Chicago Press, Ltd., London © 2018 by The University of Chicago All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission, except in the case of brief quotations in critical articles and reviews. For more information, contact the University of Chicago Press, 1427 East 60th Street, Chicago, IL 60637. Published 2018 Printed in the United States of America 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 1 2 3 4 5 ISBN-13: 978-0-226-52339-2 (cloth) ISBN-13: 978-0-226-52342-2 (paper) ISBN-13: 978-0-226-52356-9 (e- book) DOI: 10.7208/chicago/9780226523569.001.0001 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Leins, Stefan, author. Title: Stories of capitalism : inside the role of financial analysts / Stefan Leins. Description: Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2018. | Includes bibliographical references and index. Identifiers: LCCN 2017031750 | ISBN 9780226523392 (cloth : alk. paper) | ISBN 9780226523422 (pbk. : alk. paper) | ISBN 9780226523569 (e-book) Subjects: LCSH: Financial analysts | Financial services industry—Employees. -
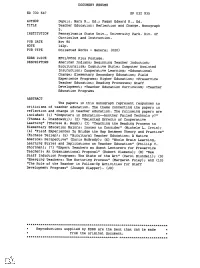
Fagan Edward R., Ed. Teacher Education: Reflection and Change
DOCUMENT RESUME ED 330 647 SP 032 935 AUTHOR Dupuis, Mary M., Ed.; Fagan Edward R., Ed. TITLE Teacher Education: Reflection and Change. Monograph 5. INSTITUTION Pennsylvania State Univ., University Park. Div. of Curriculum and Instruction. PUB DATE Nov 90 NOTE 142p. PUB TYPE Collected Works - General (020) EDRS PRICE MF01/PC06 Plus Postage. DESCRIPTORS American Indians; Beginning Teacher Induction; Biculturalism; Cognitive Style; Computer Assisted Instruction; Cooperative Learning; *Educational Change; Elementary Secondary Education; Field Experience Programs; Higher Education; *Preservice Teacher Education; Reading Processes; Staff Development; *Teacher Education Curriculum; *Teacher Education Programs ABSTRACT The papers in this monograph represent responses to criticisms of teacher education. The theme connecting the papers is reflection and change in teacher education. The followingpapers are included:(1) "Computers in Education--Another Failed Technolo y?" (Thomas A. Drazdowski);(2) "Selected Effects of Cooperative Learning" (Therese A. Ream); (3) "Teaching the Reading Processto Elementary Education Majors: Issues to Consider" (Michele L. Irvin); (4) "Field Experiences To Bridge the Gap Between Theory andPractice" (Michele Tellep); (5) "Bicultural Teacher Education: A Native American Perspective" (Doris McGrady);(6) "Whole Brain Learning, Learning Styles and Implications on Teacher Education" (Phillip V. Shortman);(7) "Expert Teachers as Guest Lecturers for Preservice Teachers: An Organizational Proposal" (Robert Clemens);(8) "New -

African American Reparations, Human Rights, and the War on Terror
Michigan Law Review Volume 101 Issue 5 2003 American Racial Jusice on Trial - Again: African American Reparations, Human Rights, and the War on Terror Eric K. Yamamoto William S. Richardson School of Law, University of Hawai'i Susan K. Serrano Equal Justice Society Michelle Natividad Rodriguez Follow this and additional works at: https://repository.law.umich.edu/mlr Part of the Civil Rights and Discrimination Commons, Human Rights Law Commons, International Law Commons, Law and Race Commons, and the Supreme Court of the United States Commons Recommended Citation Eric K. Yamamoto, Susan K. Serrano & Michelle N. Rodriguez, American Racial Jusice on Trial - Again: African American Reparations, Human Rights, and the War on Terror, 101 MICH. L. REV. 1269 (2003). Available at: https://repository.law.umich.edu/mlr/vol101/iss5/6 This Essay is brought to you for free and open access by the Michigan Law Review at University of Michigan Law School Scholarship Repository. It has been accepted for inclusion in Michigan Law Review by an authorized editor of University of Michigan Law School Scholarship Repository. For more information, please contact [email protected]. AMERICAN RACIAL JUSTICE ON TRIAL - . AGAIN: AFRICAN AMERICAN REPARATIONS, HUMAN RIGHTS, AND THE WAR· ON TERROR Eric K. Yamamoto,* Susan K. Serrano,** and Michelle Natividad Rodriguez*** Few questions challenge us to consider 380 years of history all at once, to tunnel inside our souls to discover what we truly believe about race and equality and the value of human suffering. - Kevin Merida1 (on African American reparations) Secretary of State Colin L. Powell said today that terrorists can only be attacked from "the highest moral plan" and that there is no contradiction between the Bush Administration's war on terrorism and a continuing U.S. -
Curriculum Vitae
6/14/21 CURRICULUM VITAE Edward Hance Shortliffe, MD, PhD, MACP, FACMI, FIAHSI [work] Chair Emeritus and Adjunct Professor, Department of Biomedical Informatics Vagelos College of Physicians and Surgeons, Columbia University in the City of New York [email protected] – https://www.dbmi.columbia.edu/people/edward-shortliffe/ Adjunct Professor of Biomedical Informatics College of Health Solutions Arizona State University, Phoenix, AZ [email protected] – https://isearch.asu.edu/profile/1098580 Adjunct Professor, Department of Healthcare Policy and Research (Health Informatics) Weill Cornell Medical College, New York, NY http://hpr.weill.cornell.edu/divisions/health_informatics/ [home] 272 W 107th St #5B, New York, NY 10025-7833 Phone: 212-666-8440 — Mobile: 917-640-0933 [email protected] – http://www.shortliffe.net Born: Edmonton, Alberta, Canada Date of birth: 28 August 1947 Citizenship: U.S.A. (naturalized - 1962) Spouse: Vimla L. Patel, PhD Education From To School/Institution Major Subject, Degree, and Date 9/62 6/65 The Loomis School, Windsor, CT. High School 9/65 7/66 Gresham's School, Holt, Norfolk, U.K. Foreign Exchange Student 9/66 6/70 Harvard College, Cambridge, MA. Applied Math and Computer Science, A.B., June 1970 9/70 1/75 Stanford University, Stanford, CA PhD, Medical Information Sciences, January 1975 9/70 6/76 Stanford University School of Medicine MD, June 1976. 7/76 6/77 Massachusetts General Hospital, Boston, MA Internship in Internal Medicine 7/77 6/79 Stanford University Hospital, Stanford, CA Residency in Internal Medicine Honors Graduation Magna Cum Laude, Harvard College, June 1970 Medical Scientist Training Program (MSTP), NIH-funded Stanford Traineeship, September 1971 - June 1976 Grace Murray Hopper Award (Distinguished computer scientist under age 30), Association for Computing Machinery, October 1976 Research Career Development Award, National Library of Medicine, July 1979—June 1984 Henry J. -

Forced Labor in Austria Late Recognition History Tragic Fates
Fund for Reconciliation, Peace and 19381945 Cooperation:Forced Labor in Austria Late Recognition History Tragic Fates Hubert Feichtlbauer Imprint Austrian Reconciliation Fund (Publisher) Hubert Feichtlbauer (Author) Scientific Advisor Univ. Doz. Florian Freund German Edition: ISBN: 3-901116-21-4 English Edition: ISBN: 3-901116-22-2 Published in German, English, Polish and Russian Printed by Rema Print, Neulerchenfelder Straße 35, A-1160 Vienna, on 100% chlorine-free bleached paper The book, the title, the cover design and all symbols and illustrations used are protected by copyright. All rights reserved, in particular with regard to the translation, reproduction, extraction of photomechanical or similar material and storage in data processing media either in full or in part. Despite careful research, no responsibility is accepted for the correctness of the information contained in this book. In order to ensure the readability of the texts and lists, gender-specific formulations were frequently dispensed with. Quotes from individuals and legal documents were translated solely for the purposes of this publication. No liability is accepted for translation, typesetting and printing errors. www.reconciliationfund.at © 2005 2 Schopenhauerstraße 36, A-1180 Vienna www.braintrust.at Contents 1. ›Preface‹ 5 Wolfgang Schüssel, Maria Schaumayer, Ludwig Steiner, Richard Wotava; About This Book 2. ›Guilt and Atonement‹ 17 3. ›Racism and Exploitation‹ 41 4. ›Every Case a Tragic Fate‹ 71 5. ›Why Such a Late Issue?‹ 127 6. ›The State and the Business Community -

Austria's Image in the US After the Formation of the New ÖVP/FPÖ Gove
Günter Bischof "Experiencing a Nasty Fall from Grace…" Austria’s Image in the U.S. after the Formation of the New ÖVP/FPÖ Government I. The Context: Austria’s Postwar Image It was one of the distinct characteristics of Austria’s neutralist mentalité during the Cold War that the country’s self-perception, especially during Kreisky’s years in power, was that of the "island of the blessed." On the one hand, economic prosperity, an all-encompassing welfare system, and Austria’s unique neutral position between the blocs have turned most Austrians into self-absorbed isolationists enormously pleased with themselves. On the other hand, Austria’s social peace and low unemployment rates, engendered by the complex and highly statist Austrocorporatist system, also produced a perception in the world of Austria as a model small republic. Austria’s postwar image among U.S. policy elites was formed by the early Cold War struggle. In 1955 the Austrian State Treaty brought an end to the end of the endless four-power occupation. The image of Austria in the U.S. print media as "heroes of the Cold War" began to recede. In the early 1950’s the threat of Communist coups made Austria vulnerable to be partitioned. American geopolitics considered Austria, along with divided Germany, as crucial players in the struggle against Communism on the frontlines of the Cold War. Austrians were admired for having patiently suffered the oppressive Soviet occupation regime for so long. During the occupation, Americans often did not closely distinguish between Germany and Austria. In fact it was one of the greatest challenges of Austrian diplomats in Washington to try to make the American public understand the vital differences between liberated Austria and defeated Germany. -

Par Edouard Balladur
www.lemonde.fr 58 ANNÉE – Nº 17853 – 1,20 ¤ – FRANCE MÉTROPOLITAINE --- JEUDI 20JUIN 2002 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI -- Les engagements de Chirac Lendemains Tout le cinéma d’élections et les sorties f Les députés élisent Toute la Fête à l’épreuve de l’Europe les présidents des groupes de la Musique Immigration, élargissement, budget, TVA et PAC : le nouveau pouvoir et l’agenda européen f Jacques Barrot seul L’EUROPE s’invite dans l’agenda ce et la Suède s’opposent à tout ANGOLA politique français. Le gouvernement mécanisme de sanction. candidat pour l’UMP, de Jean-Pierre Raffarin à peine ins- M. Chirac devra plaider plusieurs Jean-Marc Ayrault Récit d’un désastre tallé, Jacques Chirac se rendra, ven- dossiers économiques qui ont, ces humanitaire p. 2 dredi 21 et samedi 22 juin, au som- dernières semaines, compliqué les favori pour le PS met européen de Séville. Recevant, relations avec ses partenaires. Sa ISRAËL mardi à Paris, l’Espagnol José Maria promesse électorale d’une baisse de f Aznar, président en exercice de la TVA de 19,6 % à 5,5 % dans la res- Les Verts tentent Vivre à Jérusalem dans l’Union européenne, le président de tauration se heurte aux règles euro- de constituer la terreur des attentats. la République s’est dit déterminé à péennes. Un compromis pourrait se ce que le « sommet de Séville soit un dégager sur l’équilibre des finances un cinquième groupe Reportage p. 3 succès ». publiques à atteindre en 2004. Rap- et un point de vue p. 20 L’un des principaux dossiers sera pelée à l’ordre à de multiples repri- f A droite, la bataille celui de l’immigration. -

Sammelklage Südafrikanischer Apartheidopfer. Die Schuld Der
WOZ Die Wochenzeitung - International http://www.woz.ch/artikel/print_12585.html WOZ 46/02 - Ressort International Sammelklage südafrikanischer Apartheidopfer Die Schuld der Unternehmen Mascha Madörin Wer Schiffe für den Sklavenhandel baut, solche montiert oder ausstattet, wer (...) Schiffe belädt, zur Abreise vorbereitet oder auf Reise schickt und weiss oder beabsichtigt, dass sie für den Sklavenhandel gebraucht werden, soll daran gehindert werden; ebenso wer mit seinen Geschäften dem Sklavenhandel Vorschub und Beistand leistet.» Dies beschloss im Jahre 1794 der US-Kongress. 1820 verschärfte er das Gesetz und sah für solche Vergehen die Todesstrafe vor. Sklaverei sollte juristisch wie Piraterie behandelt werden. Auch bei den Nürnberger Prozessen nach 1945 stellte die Anklage fest, dass Hitler als Führer die «Zusammenarbeit von Staatsmännern, militärischen Führern, Diplomaten und Geschäftsleuten» gebraucht habe, um seine Absichten durchzusetzen, und dass diese deshalb zur Verantwortung gezogen werden müssten. Von der Notwendigkeit, die Wirtschaft hinter sich zu haben, waren auch die Apartheidführer überzeugt. Sie scheuten sich nicht, dies der Weltöffentlichkeit wiederholt mitzuteilen. Sie stellten gar gesetzlich sicher, dass sich die Unternehmen in Südafrika an die Spielregeln der Kollaboration hielten. Ausländische Firmen konnten gezwungen werden, mit der südafrikanischen Rüstungsindustrie zusammenzuarbeiten. Unzählige solcher Details sind in den Entschädigungsklagen von Abrahams/ Hausfeld und Ntsebeza/Fagan nachzulesen. «Jedes Handelsabkommen, jeder Bankkredit, jede neue Investition ist ein Baustein in der Mauer unserer fortdauernden Existenz», stellte beispielsweise 1972 der südafrikanische Premierminister John Voster fest. Bausteine in der Mauer der Apartheid wurde zum geflügelten Wort. Die Platte «The Wall» der Rockgruppe Pink Floyd wurde 1980 verboten, weil die Liedzeile «All in all it’s just another brick in the wall» von SchülerInnen für Streikgesänge übernommen wurden. -

Aid Ude, 70U and .Eacb
caoo;uy ••••••• .r;ccel~r.lnc..~HEIt.NVC:: 100\3 . :'. WWW.b~urnberg.com liiiil,JJ.Io'" Ca/ftllflar. N.~. , -p;,., . .h.T J SUBP06NA DU~E~ T£CUM ."J.t!. f.fri~/ w. fl/ ~2J. .er~·./ :e:f-'~~J . Dti~MI.IJtJ· ·m." •••••..••. lip' -~ .., ••.••••. TO W UJ..i "?~j ;'.. 13 r,J J 1t...A 't:':..L;j-i'·· ~-' ... '" GREETING: WB COMMAND YOn. That all basiDfJl&S aDd'!Jrc:u.e.l beilJK laid ude, 70U and .eacb. of, you ap/HHII •• afte" _ IlL J..t/'~.J'h ~J" },d1 rc,. ~ AIo~/. 1'"" j, J, to. J.., -A~ 1-.L~ . ~~at t~eS 'f...A~'. I'Iday~2A 6/. ~J r:JJ..r1~o"~rt.t:.r #e...JJ. -'- 0.0"tor':.,p '...N1'at.' I f)'fJ .." ../o'cl~k,. ill.. "the '. noOD~ ...dat 'MI, ,ft~SftCf or .djouzi:Jed. date to 6,ve feft;molly in this IIC#Oll' • "'f 1· aad ,tbatuJ::Oa. bri~, with you, a~.p~~d~,?~ lit lb. tim . t..- J ~ /!:J" .rf.rlAr:,"iA/3.... ,.' I" y~"''''1''''/ crJ.1h~~H~.~.~-:~;';'.dt; .r-JJ' ~ ~d.ww:d f)':-~~~J ~l?A~A ~ .~~1!,~'f::L;) ..~z.:./::J. ...... '. ". &AJ'~t..Si ..~( ~.~cJU.:.l~· ; i~:.?, t, .. (i E~.~:.,/.$... .~"r.'~f-I-J< AIt!4 'f~ r. CD r-d..r "'I'~!\. ,;Jh,d' ~: p.bO\lt.. "A/!hd, (,;J. dr 1'.4,..'1'It, ~·hlJ. I'..u!... I.'" :ric."... .s l.~'J~ .·.,r ,~.J~. J.o··.~7 .~. ~ ~~O~~. .\ . " . .D","· 'in 70fU 'cunody, ~ :all ~tber fiNds. e~id.~itift~S. wbicb ~tifib.v.fiJ your 'er,'stody or po•• r •. -

Resolving Business Disputes Through Litigation Or Other Alternatives: the Effects of Jurisdictional Rules and Recognition Practiceφ
POSCH-EIC FINAL PUBLICATION.DOC 4/16/2004 11:42 AM RESOLVING BUSINESS DISPUTES THROUGH LITIGATION OR OTHER ALTERNATIVES: THE EFFECTS OF JURISDICTIONAL RULES AND φ RECOGNITION PRACTICE Willibald Posch∗ I. INTRODUCTION................................................................ 363 II. JURISDICTION.................................................................. 368 III. FORUM SELECTION (PROROGATION OF JURISDICTION).... 374 IV. ARBITRATION ................................................................... 378 V. RECOGNITION AND ENFORCEMENT ................................. 380 VI. CONCLUSIONS .................................................................. 382 I. INTRODUCTION The rules on jurisdiction and recognition practice in the various U.S. jurisdictions on the one hand and in the European States on the other hand differ in several aspects. Therefore, their impact on transatlantic business transactions and the litigation resulting from those transactions may be significant. There is no doubt that in a globalized economy differences φ This article is based on a presentation made at the Conference on Transatlantic Business Transactions—Choice of Law, Jurisdiction and Judgments, which was held in Barcelona, Spain, June 1-3, 2003. The Conference was co-sponsored by the Association of American Law Schools and the European Law Faculties Association. ∗ J.D. Professor of Law, University of Graz/Austria 363 POSCH-EIC FINAL PUBLICATION.DOC 4/16/2004 11:42 AM 364 HOUSTON JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW [Vol. 26:2 between domestic rules governing jurisdictional issues and the recognition of foreign judgments may hamper the functioning of international trade and commerce. Unification of the rules on conflict of jurisdiction in civil and commercial matters, as provided within the European Union by the recent “Council Regulation Brussels Nr. 1”1, appears to not only be necessary for an internal market within a trade union or within a large nation consisting of a plurality of jurisdictions such as the United States of America. -

The Schüssel Era in Austria Günter Bischof, Fritz Plasser (Eds.)
The Schüssel Era in Austria Günter Bischof, Fritz Plasser (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES Volume 18 innsbruck university press Copyright ©2010 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, ED 210, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Published and distributed in the United States by Published and distributed in Europe by University of New Orleans Press: Innsbruck University Press: ISBN 978-1-60801-009-7 ISBN 978-3-902719-29-4 Library of Congress Control Number: 2009936824 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Assistant Editor Ellen Palli Jennifer Shimek Michael Maier Universität Innsbruck Loyola University, New Orleans UNO/Vienna Executive Editors Franz Mathis, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver Wirtschaftsuniversität -

Anti-Semitism Worldwide 2000/1 AUSTRIA
The Stephen Roth Institut for the Study of Contemporary Anti-Semitism and Racism (www.tau.ac.il) Anti-Semitism Worldwide 2000/1 AUSTRIA The European Union report prepared by observers appointed to monitor the sanctions against Austria labeled the FPÖ ”a right-wing populist party with radical elements,” and claimed it used ”extremist language.” During the year the FPÖ demonstrated its close links with National Socialism and with right-wing extremists. Extreme rightists and neo-Nazis intensified their activity in 2000. Contacts between Austrian and German right-wing extremists were also strengthened. The agreement on restitution payments to victims of National Socialism announced in early 2001 was criticized directly or indirectly by FPÖ members, including former party leader Jörg Haider. THE JEWISH COMMUNITY Austria has a Jewish population of 10,000 out of a total population of 8 million, most of whom live in Vienna. The present community is made up of several distinct groups, the most numerous being returnee Austrians and their families, as well as former refugees from Eastern Europe. A Jewish primary school and high school, as well as several Jewish publications, serve the needs of the community. Parliament approved a compensation package that was criticized by the Jewish community for withholding property. The new legislation provided a $7,000 lump sum payment to Austrian survivors, no matter where they are domiciled today. In October 2000, British artist Rachel Whiteread’s monument ”Nameless Library” was unveiled in Judenplatz in Vienna on the remains of a synagogue in which Jews had been killed in 1421. POLITICAL PARTIES AND EXTRA-PARLIAMENTARY GROUPS The FPÖ When the right-wing extremist Freiheitliche Partei Österreichs (Austrian Freedom Party – FPÖ) joined the federal coalition government in February 2000, the other members of the European Union (EU) (as well as the Czech Republic and Norway) responded by imposing sanctions on Austria.