Berichte Think
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

0.City 00.City 00000078B96b.City 000000799469.City 00002534.City 00268220901492.City 0037841796875.City 0053062438965.City 00683
0.city 00.city 00000078b96b.city 000000799469.city 00002534.city 00268220901492.city 0037841796875.city 0053062438965.city 00683e059be430973bcf2e13ef304fa996f5cb5a.city 0069580078125.city 007.city 008a.city 009115nomiyama.city 00919723510742.city 00gm02900-shunt.city 00gm02910-mhunt.city 00gs.city 00pe.city 010474731582894636.city 012.city 012179f708f91d34c3ee6388fa714fbb592b8d51.city 01280212402344.city 013501909eecc7609597e88662dd2bbcde1cce33.city 016317353468378814.city 017-4383827.city 01984024047851.city 01au.city 01gi.city 01mk.city 01tj.city 01zu.city 02.city 02197265625.city 022793953113625864.city 024169921875.city 02524757385254.city 0295524597168.city 02957129478455.city 02eo.city 02fw.city 03.city 03142738342285.city 03311157226562.city 03606224060056.city 0371.city 03808593749997.city 0390625.city 03a9f48f544d8eb742fe542ff87f697c74b4fa15.city 03ae.city 03bm.city 03fe252f0880245161813aaf4f2f4d7694b56f53.city 03fr.city 03uz.city 03wn.city 03zf.city 040.city 0401552915573.city 0402.city 0441436767578.city 04507446289062.city 04508413134766.city 04642105102536.city 05159759521484.city 05380249023437.city 0565036083984.city 0571.city 05rz.city 05sz.city 05va.city 05wa.city 06.city 0605239868164.city 06274414062503.city 06542968749997.city 0656095147133.city 06618082523343.city 0666be2f5be967dabd58cdda85256a0b2b5780f5.city 06735591116265432.city 06739044189453.city 06828904151916.city 06876373291013.city 06915283203125.city 06ez.city 06pt.city 07225036621094.city 0737714767456.city 07420544702148.city 07520144702147.city 07604598999023.city -

Deutsche Nationalbibliografie 2019 C 01
Deutsche Nationalbibliografie Reihe C Karten Vierteljährliches Verzeichnis Jahrgang: 2019 C 01 Stand: 03. April 2019 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2019 ISSN 1869-3970 urn:nbn:de:101-201811221539 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. Reihe C, Karten enthält ausschließlich Kartenwerke. Die werkes. Innerhalb der Sachgruppen werden die Titel al- Titelanzeigen selbst sind, wie auf der Sachgruppenüber- phabetisch geordnet. sicht angegeben, entsprechend der Dewey-Dezimalklas- Den Anzeigen liegen die "Regeln für die alphabeti- sifikation (DDC) gegliedert und können auch über die sche Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken Sachgruppenlesezeichen -

Potenzialanalyse Der Ernährungssouveränität Berlins Unter Einbezug Verschiedener Ernährungsszenarien Und Regionaler Raumgrößen
Institut: Geographie und Geologie Studiengang: Nachhaltigkeitsgeographie Potenzialanalyse der Ernährungssouveränität Berlins unter Einbezug verschiedener Ernährungsszenarien und regionaler Raumgrößen Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Titels Master of Science, M.Sc. Vorgelegt von Norman Voigt Greifswald, den 12.04.2018 Erstgutachterin: M. Sc. Uta Schmidt Zweitgutachterin: Dr. Henrike Rieken Titelbild Die Zeit ist reif für Ernährungssouveränität! (nyeleni – Bewegung für Ernährungssouveränität) Wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden, voller Informationen, aber ohne Erkenntnis, randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung. So gingen wir, von uns selbst nicht aufgehalten. Roger Willemsen Danksagung Danksagung Die Masterthesis ist nicht nur Zeugnis meiner wissenschaftlichen Fähigkeit und die Beantwortung einer Forschungsfrage, sie ist auch das Ende eines Lebensabschnitts. Die letzten Jahre waren für mich ein großes Glück und eine große Freude. Ich durfte viele tolle Menschen kennenlernen, habe meinen Horizont erweitert und einen Lebensweg gefunden, der mir Sinn, Kraft und Halt gibt. Gerüstet, voll mit Wissen und intrinsischer Motivation zur Bewältigung kommender Aufgaben. Mein Wunsch ist natürlich, das gewonnene Wissen und die gewonnenen Erfahrungen so einsetzen zu können, dass wir uns eben doch selbst aufhalten, nachhaltige und transformatorische Wege einschlagen und der Bezeichnung Homo sapiens gerecht werden. Dazu möchte ich meinen Anteil leisten. Zu allererst möchte ich meinen Eltern und meiner Familie danken. Die gesamte Studienzeit wäre ohne sie deutlich schwieriger gewesen. Für all die Unterstützung, die Geduld, das Vertrauen und das Verständnis bin ich über alles dankbar! Bezogen auf diese Arbeit möchte ich meinen Betreuerinnen Uta Schmidt und Dr. Henrike Rieken für ihre stetige Unterstützung danken sowie Benedikt Härlin und Michael Wimmer für die geführten Experteninterviews. Niemals kann eine solche Arbeit ohne die Hilfe anderer abgeschlossen werden, die lesen, korrigieren und eigene Erfahrungen einbringen. -

Amtsblatt 01 02.Pdf
1 x Amtsblatt für Brandenburg Gemeinsames Ministerialblatt für das Land Brandenburg 13. Jahrgang Potsdam, den 4. Januar 2002 Nummer 1 Inhalt Seite Ministerium des Innern Bildung der neuen Gemeinde Storbeck-Frankendorf . 3 Änderung des Amtes Temnitz . 3 Eingliederung der Gemeinden Bahnsdorf, Drasdo und Wiederau sowie der Stadt Uebigau in die Stadt Wahrenbrück . 3 Änderung des Amtes Falkenberg/Uebigau . 3 Bildung der neuen Stadt Beelitz . 3 Auflösung des Amtes Beelitz . 3 Eingliederung der Gemeinde Buchhain in die Stadt Doberlug-Kirchhain . 4 Änderung des Amtes Doberlug-Kirchhain und Umland . 4 Bildung einer neuen Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow . 4 Bildung einer neuen Gemeinde Schönwald . 4 Bildung einer neuen Gemeinde Unterspreewald . 4 Bildung einer neuen Gemeinde Dissen-Striesow . 4 Bildung einer neuen Gemeinde Schmogrow-Fehrow . 4 Eingliederung der Gemeinde Müschen in die Gemeinde Burg (Spreewald) . 5 Änderung des Amtes Burg (Spreewald) . 5 Bildung einer neuen Gemeinde Gumtow . 5 Eingliederung der Gemeinden Allmosen, Barzig, Saalhausen und Wormlage in die Stadt Großräschen . 5 Eingliederung der Gemeinde Zitz in die Gemeinde Rosenau . 5 Änderung des Amtes Wusterwitz . 6 Eingliederung der Gemeinde Terpt in die Stadt Luckau . 6 Eingliederung der Gemeinde Zöllmersdorf in die Stadt Luckau . 6 Änderung des Amtes Luckau . 6 2 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 1 vom 4. Januar 2002 Inhalt Seite Eingliederung der Gemeinde Weesow in die Stadt Werneuchen . 6 Änderung des Amtes Werneuchen . 6 Bildung der neuen Gemeinde Vielitzsee . 7 Eingliederung der Gemeinde Keller in die Stadt Lindow (Mark) . 7 Eingliederung der Gemeinde Klosterheide in die Stadt Lindow (Mark) . 7 Eingliederung der Gemeinde Banzendorf in die Stadt Lindow (Mark) . 7 Änderung des Amtes Lindow (Mark) . -

Amtsblatt Lindow (Mark)
A m t s b l a t t für das Amt Lindow (Mark) 25. Jahrgang Lindow, den 03.12.2015 Nummer 06 Impressum Herausgeber für den amtlichen und nicht amtlichen Teil: Amt Lindow (Mark) Straße des Friedens 20 16835 Lindow (Mark) Verlag für diese Ausgabe ist der Herausgeber Das Amtsblatt erscheint in einer Auflage von 100 Stück und in der Regel monatlich. Das Amtsblatt ist erhältlich im Amt Lindow (Mark)/Hauptamt und im Touristinformationsbüro. Eine Zusendung des Amtsblattes erfolgt auf Antrag gegen Vorkasse der Portokosten in Höhe von 2,00 €. Inhaltsverzeichnis: 1. Amtlicher Teil 1.1. Satzungen und Verordnungen Keine Veröffentlichungen 1.2. Bekanntmachungen der Gemeinden und des Amtes 1.2.1. Bekanntmachung zur 2. Änderung des räumlichen Teilflächennutzungsplanes Vielitz in der Gemeinde Vielitzsee 1.2.2. Bekanntmachung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung Lindow (Mark) 1.2.3. Bekanntmachung von Beschlüssen des Hauptausschusses Lindow (Mark) 1.2.4. Bekanntmachung von Beschlüssen der Gemeindevertretung Vielitzsee 1.2.5. Bekanntmachung von Beschlüssen des Amtsausschusses Lindow (Mark) 1.2.6. Bekanntmachung von Beschlüssen der Gemeindevertretung Herzberg (Mark) 1.2.7. Bekanntmachung von Beschlüssen der Gemeindevertretung Rüthnick 1.2.8. Bekanntmachung – Durchführung Volksbegehren „Volksinitiative für größere Mindestabstände von Windrädern sowie keine Windräder im Wald“ 2. Nichtamtlicher Teil 2.1. Elternbrief Nr. 40 1. Amtlicher Teil 1.1. Satzungen und Verordnungen Keine Veröffentlichungen ◆ ◆ ◆ 1.2. Bekanntmachungen der Gemeinden und des Amtes 1.2.1. Bekanntmachung zur 2. Änderung des räumlichen Teilflächennutzungsplanes Vielitz in der Gemeinde Vielitzsee Amt Lindow (Mark) Lindow, den 06.10.2015 für die Gemeinde Vielitzsee Bekanntmachung zur 2. Änderung des räumlichen Teilflächennutzungsplanes Vielitz in der Gemeinde Vielitzsee Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung der 2. -
Paddeln, Radeln, Schlossparkbummel
RB54: LINDOW UND RHEINSBERG P ADDELN, RADELN, SCHLosspark- BUMMEL Kanu- und Radtouren im Ruppiner Seenland HEIMAT IN BEWEGUNG RB54 S. 14-15 S. 16-17 S. 8-9 S. 10-11 S. 7 INHALT Lindow – dort, wo sich drei Seen küssen 4 – 5 Kanu- und Fahrradverleih Rhinpaddel 6 Kanu-Rundtour auf dem Vielitzsee 7 Mit dem Kanu von Lindow nach Alt Ruppin 8 – 9 Radtour von Lindow nach Neuruppin 10 – 11 Rheinsberg – Glück auch nur für Tage 12 – 13 Auf dem Rhin ins Reich der Eisvögel 14 – 15 Radtour von Lindow nach Rheinsberg 16 – 17 Ausflugsbus 785 Rheinsberg – Mirow 18 Steigen Sie ein – mit der NEB bequem ans Ziel 19 3 MIT DER NEB, KANU UND RAD IN DIE NATUR Liebe Fahrgäste, RB54 wo ist es im Sommer am allerschönsten? Natürlich am, auf und im Wasser! Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir Sie nun in der warmen Jahreszeit mit der Regionalbahn RB54 ganz bequem in die Wasserparadiese Lindow und Rheinsberg im Ruppiner Seenland bringen können. Von April bis Oktober fährt die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) auf der Strecke von Löwenberg, über Herzberg und Lindow bis Rheinsberg. In Berlin haben Sie gute Anschlüsse: direkt mit der RB54 von Lichtenberg bzw. von Gesundbrunnen mit dem RE5 und Umstieg in Löwenberg. Steigen Sie ein und machen Sie Urlaub vom Alltag! Ein wild- romantisches Flüsschen, klare Seen, stille Wälder an den Ufern und zwei nette Städte mit interessanter Geschichte und besonderer Architektur erwarten Sie. Und damit Sie die Natur aktiv genießen können, vermietet Ihnen unser Partner- Unternehmen Rhinpaddel vor Ort Kanus und Fahrräder zu besonderen Konditionen. -

Ranglisten Gemeinde Von Vielitzsee
25.09.2021 Karten, Analysen und Statistiken zur ansässigen Bevölkerung Bevölkerungsbilanz, Bevölkerungs- und Familienentwicklung, Altersklassen und Durchschnittsalter, Familienstand und Ausländer Skip Navigation Links GERMANIA / Brandenburg / Provinz von Ostprignitz-Ruppin, Landkreis / Vielitzsee Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHIE WIRTSCHAFT RANGLISTEN SUCHEN GERMANIA Gemeinden Nebeneinander anzeigen >> Breddin Märkisch Linden Dabergotz Neuruppin Dreetz, b Neustadt (Dosse) Neustadt, Dosse Rheinsberg Fehrbellin Rüthnick Heiligengrabe Sieversdorf- Herzberg (Mark) Hohenofen Kyritz Storbeck- Frankendorf Lindow (Mark) Stüdenitz- Schönermark Temnitzquell Temnitztal Vielitzsee Walsleben, b Neuruppin Wittstock/Dosse Wusterhausen/Dosse Zernitz-Lohm Powered by Page 2 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Provinzen Adminstat logo DEMOGRAPHIE WIRTSCHAFT RANGLISTEN SUCHEN BARNIM, GERMANIAHAVELLAND, LANDKREIS LANDKREIS BRANDENBURG MÄRKISCH- AN DER HAVEL, ODERLAND, KREISFREIE LANDKREIS STADT OBERHAVEL, COTTBUS, LANDKREIS KREISFREIE OBERSPREEWALD- STADT LAUSITZ, DAHME- LANDKREIS SPREEWALD, ODER-SPREE, LANDKREIS LANDKREIS ELBE-ELSTER, OSTPRIGNITZ- LANDKREIS RUPPIN, FRANKFURT LANDKREIS (ODER), POTSDAM, KREISFREIE KREISFREIE STADT STADT POTSDAM- MITTELMARK, LANDKREIS PRIGNITZ, LANDKREIS SPREE-NEIßE, LANDKREIS TELTOW- FLÄMING, LANDKREIS UCKERMARK, LANDKREIS Regionen Powered by Page 3 Baden- Hessen L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Württemberg, Adminstat logo Mecklenburg- Land DEMOGRAPHIE -
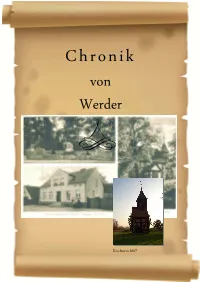
Chronik Von Werder
Chronik von Werder Kirchturm 2007 Werder, dass bedeutet so viel wie „Insel“ oder „Landstrich zwischen Fluss und See“. Werder liegt nahe dem Ostrand einer relativ ausgedehnten flachwelligen Grundmoräneninsel, die wie ein Werder aus den rings umgebenden, mehr oder weniger breiten und zur Zeit des Frankfurter Stadi- ums angelegten Schmelzwassertälern herausragt. Das südliche Randtal wird vom Landwehrgraben durchflossen, der die Südgrenze der Gemeindeflur bildet. Auf der Grundmoräneninsel konzentriert sich die nur von einigen kleinen Waldinseln unterbrochene Feldflur auf Sand- , an lehmigen Sand- und verbreitet lehmigen Sandböden . Die zum Teil vermoorten, zum Teil von grundwassernahen San- den erfüllten Schmelzwassertäler tragen größtenteils Grünland. Die Geschichte von Werder Das 7 km westlich von Neuruppin gelegenen Dorfs Werder befindet sich aber durchaus nicht auf einer Insel. Wie also kam es zu diesem Namen? –Bei dem Ortsnamen (1362 Arnoldus de Werder) kann Namensübertragung nicht ausgeschlossen werden. Als im 12. Jahrhundert die Deutschen kolonisierend in das seit etwa dem 7. Jahrhundert von Slawen bewohnte Gebiet vordrangen, kamen viele Neusiedler aus der Altmark. Dort finden wir noch heute auf verhältnismäßig engem Raum die Dörfer Werder, Gottberg, Garz, Storbeck, Walsleben, Bertikow und andere. In Erinnerung an ihre Heimat gaben die Kolonisten ihrer neuen Heimstatt die alten vertrauten Namen. Dass Werder eine rein deutsche Sied- lung ist und nicht an der Stelle eines ehemaligen slawischen Dorfes entstand, geht aus der Hufeneintei- lung in 41 flämische Hufen, darunter 2 Pfarrhufen, hervor. Der als Straßendorf angelegte Ort wird urkundlich erstmalig in dem auf Befehl der Grafen von Lindow 1491 aufgestellten Landregister erwähnt. Damals werden dort schon die von Fratz und die von Kulen (oder Kühlen)als begütert angeführt. -

18. Jahrgang Walsleben, 26. Oktober 2019 Nr. 6 Inhaltsverzeichnis 1
18. Jahrgang Walsleben, 26. Oktober 2019 Nr. 6 Inhaltsverzeichnis 1. Satzungen 1.1. Hauptsatzung der Gemeinde Dabergotz 1.2. Hauptsatzung der Gemeinde Temnitztal 2. sonstige amtliche Mitteilungen 2.1. Widmungsverfügung 2019/02 zur Widmung von Straßenflächen in der Gemeinde Walsleben 2.2. Widmungsverfügung 2019/01 zur Widmung von Straßenflächen in der Gemeinde Walsleben 2.3. öffentliche Ausschreibung zum Verkauf eines Wohngrundstückes in Garz, Dorfstraße 7 2.4. öffentliche Ausschreibung zum Verkauf eines Mehrfamilienhauses in Vichel, Dorfstraße 24 2.5. Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfs der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Dabergotz 2.6. Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfs der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Dabergotz 2.7. Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB des Vorentwurfs zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Dabergotz Nr. 1 „Industrie- und Gewerbegebiet Temnitzpark“ der Gemeinde Dabergotz 2.8. Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB des Vorentwurfs zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Gottberg Nr. 1 „Freiflächen-Photovoltaikanlage“ der Gemeinde Märkisch Linden 2.9. Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfs der 2. Änderung des Flächennutzungspanes der Gemeinde Märkisch Linden 2.10. Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB des Vorentwurfs der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Märkisch Linden 2.11. Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses der Gemeinde Temnitzquell zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Temnitzquell 2.12. Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses der Gemeinde Temnitzquell für den Bebauungsplan Netzeband Nr. 1 „Ambulantes Wohnen“ in der Gemeinde Temnitzquell 2.13. Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses der Gemeinde Temnitztal zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Temnitztal 3. -

Inhaltsverzeichnis
Neuruppin, den 05. April 2019 Nr. 02 | 28. Jahrgang | 14. Woche Inhaltsverzeichnis 1. Bekanntmachungen 1.1 Bekanntmachung über die Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises – Dirk Geißler ........................................ Seite 2 1.2 Bekanntmachung über die Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises – Dominik Krause ................................. Seite 2 1.3 Bekanntmachung über die Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises – Jana Hübner ....................................... Seite 2 1.4 Öffentliche Bekanntmachung der Wahlvorschläge zur Wahl des Kreistages des Landkreises Ostprignitz-Ruppin am 26. Mai 2019 ............................................................................................. Seite 2 1.5 Öffentliche Bekanntmachung: Briefwahlvorstände zur Wahl des Kreistages des Landkreises Ostprignitz-Ruppin und zur Europawahl .................. Seite 14 1.6 Verfügung zur Widmung von einem Teilabschnitt der Kreisstraße K6825 in der Stadt Wittstock/Dosse ................. Seite 14 2. Bekanntmachungen des Wasser- und Abwasserverbandes „Dosse“ 2.1 Wirtschaftsplan 2019 ........................................................................................................................................... Seite 15 Fortsetzung auf Seite 2 | 2 | 05. April 2019 AMTSBLATT für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin JJ 1. Bekanntmachungen 1.1 Bekanntmachung über die Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises – Dirk Geißler Der im März 2019 in Verlust geratene Dienstausweis des Landkreises Ost- gestellt vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin -

Gemeindebrief Der Ev
Oktober - November 2019 Gemeindebrief der Ev. Gesamtkirchengemeinde Temnitz in Dabergotz, Darritz, Frankendorf, Garz, Gottberg, Katerbow, Kerzlin, Kränzlin, Küdow, Lüchfeld, Manker, Netzeband, Pfalz- heim, Rägelin, Rohrlack, Vichel, Walsleben, Werder und Wildberg. 2 Inhalt Angedacht 03 - 04 Gemeindeleben 05 - 15 Gottesdienstplan 16 - 17 Termine 18 - 19 Geburtstage 20 - 21 Gemeindeleben 22 - 23 Kinder- und Familienseite 24 ESTAruppin 25 - 26 Ortskirchenratswahl 27 - 30 Freud und Leid 31 Adressen / Kontakte / Pfarrdienst 32 Bilder und Rechte Die Inhaber der Bildrechte sind der Redaktion bekannt. Impressum Dieser Kirchengemeindebrief erscheint alle 2 Monate. Den Gemeindebrief gestaltet der Redaktionskreis: Anja im Brahm, Ulrike Klame, Renate Schwarz, Steffi Ohm, Alexander Stojanowic, Sabrina Borchart Lektorat: Anja im Brahm, Alexander Stojanowic Layout: Lina-Marie Ostertag Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben. V.i.S.d.P.: für den GKR: Joachim Pritzkow, erreichbar über das Gemeindebüro Dorfstraße 21, 16818 Walsleben Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 06.11.2019 Angedacht 3 Liebe Leserinnen, liebe Leser, Rechts- und Geistesgeschichte gelang es Kaiser Maximilian Ende des 15. Jahr- DAS 5. GEBOT - Du sollst nicht töten hunderts ein Rechtssystem zu etablie- (morden)! ren, welches die Selbstjustiz verbietet und rechtliche Instanzen einsetzt. Diese Mit dem fünften Gebot verlassen wir den durften dann Todesstrafen verhängen. Bereich des eigenen Hauses und der Fa- Für Luther war es selbstverständlich, milie. So umschreibt es Martin Luther, denn seiner Auslegung der ersten vier denn die ersten drei Gebote betreffen Gebote nach überträgt sich der Gehor- den einzelnen Menschen und Gott und sam gegenüber Gott in der Familie auf das vierte Ehe und Familie. die Eltern und in der Gesellschaft auf Du sollst nicht töten! (2.Mose/Ex 20,13) - die Obrigkeit im Staat. -

Inhaltsverzeichnis 1. Bekanntmachungen
Neuruppin, den 18. August 2010 Nr. 5 – 19. Jahrgang – 33. Woche Inhaltsverzeichnis 1. Bekanntmachungen 1.1. Öffentliche Bekanntmachung von Anträgen der Stadt Rheinsberg auf Bescheinigung des Bestehens einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit an Grundstücken in den Gemarkungen Rheinsberg, Flure 2, 3 und 9 Zechlinerhütte, Flur 3 .............................................................................................................................................................. Seite 2 1.2. Öffentliche Bekanntmachung von Anträgen des Zweckverbands Wasser / Abwasser Fehrbellin – Temnitz auf Bescheinigung des Bestehens einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit an Grundstücken in den Gemarkungen Linum (Flur 12), Hakenberg (Flure 3 und 4), Tarmow (Flur 103) ..................................... Seite 2 1.3. Öffentliche Bekanntmachung von Anträgen des Landesamts für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV) auf Bescheinigung des Bestehens einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit an Grundstücken........................................... Seite 3 1.4. Öffentliche Bekanntmachung von Anträgen der Gemeinde Heiligengrabe auf Bescheinigung des Bestehens einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit an Grundstücken in den Gemarkungen Heiligengrabe, Flure 1, 2, 8, 9 und 10 Maulbeerwalde, Flure 1, 2 und 3 ............................................................................................................................................. Seite 4 1.5. Öffentliche Bekanntmachung von Anträgen der Stadtwerke Neuruppin GmbH