Landschaftsrahmenplan
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Innotrans 2018 Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg Standplan
InnoTrans 2018 Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg Standplan Gemeinschaftsstand der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg CityCube Halle B Grußwort 1 Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, herzlich willkommen zur InnoTrans 2018. haltigkeit und technologische Innovationen Vom 18. bis 21. September treffen sich im spiegeln sich auch in diesem Jahr im Berlin ExpoCenter City die führenden Ver- Programm wider. Die Digitalisierung im treterinnen und Vertreter der Bahnbranche. Schienenverkehr ermöglicht eine Fülle Als weltweite Leitmesse für Schienenver- neuer Anwendungen und Dienste, die sich kehrstechnik ist die InnoTrans zugleich effizienzsteigernd und ressourcenschonend das größte internationale Schaufenster der auf betriebliche Prozesse auswirken und Bahntechnologie. gleichsam den Kundinnen und Kunden im Personen- und Güterverkehr zugutekom- Ein kompaktes Konferenzprogramm in men. Kombination mit attraktiven Präsentationen macht die besondere Stärke dieser Industrie- Zu den Ausstellern zählen sowohl interna- messe aus. Zukunftsthemen wie Nach- tionale Unternehmen als auch zahlreiche 2 Grußwort innovative Zulieferfirmen und Forschungs- Dienstleistungen vor. Diese Broschüre bie- einrichtungen aus der Hauptstadtregion. tet Ihnen eine schnelle Übersicht über die Die Bahntechnik ist ein wichtiger Wachs- hier ausstellenden Unternehmen. tumsmotor für die regionale Wirtschaft und Impulsgeber für den Technologiestandort Nutzen Sie die Gelegenheit, die Neuhei- Berlin-Brandenburg. Die regionale Schie- ten in Augenschein zu nehmen und so nenverkehrstechnikbranche -

A History of German-Scandinavian Relations
A History of German – Scandinavian Relations A History of German-Scandinavian Relations By Raimund Wolfert A History of German – Scandinavian Relations Raimund Wolfert 2 A History of German – Scandinavian Relations Table of contents 1. The Rise and Fall of the Hanseatic League.............................................................5 2. The Thirty Years’ War............................................................................................11 3. Prussia en route to becoming a Great Power........................................................15 4. After the Napoleonic Wars.....................................................................................18 5. The German Empire..............................................................................................23 6. The Interwar Period...............................................................................................29 7. The Aftermath of War............................................................................................33 First version 12/2006 2 A History of German – Scandinavian Relations This essay contemplates the history of German-Scandinavian relations from the Hanseatic period through to the present day, focussing upon the Berlin- Brandenburg region and the northeastern part of Germany that lies to the south of the Baltic Sea. A geographic area whose topography has been shaped by the great Scandinavian glacier of the Vistula ice age from 20000 BC to 13 000 BC will thus be reflected upon. According to the linguistic usage of the term -

Subject: Information About the Limitation Accessibility to the Job- Center in District of Havelland. Controlling's Measures Ag
Dear Ladies and Gentlemen: Subject: Information about the limitation accessibility to the Job- Center in District of Havelland. Controlling’s measures against Coronavirus-Infection. In order to avoid any infections to the citizens in District of Havelland we have set new accessibility rules to all Job-Centers, only by priority, to clarify the essential and important matters. Please note that it’s only possible after setting the appointment by phone! The essential service issues are: - To cover any lake with the health insurance. - Bank account lockout. - Homelessness. 1- Usual opening hours will not be offered until further notice. 2- Please note that all the appointments starting March the 17th, 2020 will be carried out by telephone. Please be ready to become a phone call within the appointment time. 3- We will be reachable through Phone calls, Emails and letters. You can send any documents and letters to one of the following addresses: Jobcenter Falkensee: Bahnstr. 8-12, 14612 Falkensee E-Mail: [email protected] Jobcenter Nauen: Waldemardamm 3, 14641 Nauen E-Mail: [email protected] Jobcenter Rathenow: Berliner Str. 15, 14712 Rathenow E-Mail: [email protected] Your social benefits will be paid as usual. Please don’t come to the Job-Center if you have any Flu symptoms, debility, fever, cough or sore throat or any other similar symptoms. Health department in District of Havelland has set a direct Hot-Line to answer your questions about Coronavirus: 03385 7119 Mondays and Tuesdays: 9:00 am until 6:00 pm. Wednesdays and Thursdays: 9:00 am until 4:00 pm. -

Formed by Water Settled Here
Kiebitz Bogs, Ländchen, and Land Seizure Flying Machines, Microscopes, The 1315-square-kilometer nature park is above all shaped Retorts by the Weichselian glaciation, which ended over 10,000 years »The surrounds of Berlin are poor in good training grounds ago. Powerful glaciers and meltwaters formed the landscape. for gliding. The ideal of the latter is formed in a hill with In the low-lying areas large moors and wetland areas arose: drops on all sides of at least 20 meters. Between Rathenow the Haveland Luch (bog), the Rhinluch (Rhin bog), and the and Neustadt and der Dosse there is a stretch of land, the Dossebruch. A unique feature of the Westhavelland are the so called Ländchen Rhinow, that contains a large selection of Marsh marigold ground moraine plateaus and terminal moraine »islands« – such hills.« Otto Lilienthal – the »first pilot« – was often in the so called Ländchen. Like large islands they rise out of the Westhavelland between 1893 and 1896 because he couldn’t for the rationalization of eyeglass and microscope production lowlands and lent themselves therefore to settlement through find in Berlin any suitable training grounds for his ever better and was ground-breaking for the further development of optics. villages and cities. In the 7th century the Slavic Hevellians constructed flying machines. With his machines dismantled he In 1801 he founded the Optische Industrie-Anstalt (Optical Formed by Water settled here. They were so called after the Havel. With the traveled by train and horse-drawn carriage to the Rhinower Industry Institute). The city of Premnitz was until 1914 still German conquest by Albert the Bear in 1157 settlers came, expectations! That’s wonderful! I must say to you, all of you Mountains. -
Havelland-Radweg Von Berlin in Den Naturpark Westhavelland
Havelland-Radweg Von Berlin in den Naturpark Westhavelland Information & Buchung 033237 859030 www.havelland-tourismus.de Von Berlin in den Angebote entlang des Havelland-Radweges Pauschalen Naturpark Westhavelland Havelland-Radweg und Umgebung Diese Radwander-Tour führt Sie in vier leichten Tagesetappen zwischen 40 und 50 km von der westlichen Berliner Stadtgrenze bis in den LÄNGE insgesamt 115 km ÜBERREGIONALE ANBINDUNG Naturpark Westhavelland. bei Schönwalde-Glien über den Berliner Mauerweg VERLAUF · 5 Übernachtungen mit Frühstück in gemütlichen an den Radfernweg Berlin-Kopenhagen, in Rathenow Rathenow Berlin-Spandau – Schönwalde – Wansdorf – Pausin – 2- bis 4-Sterne Hotels/Pensionen/Ferienwohnungen an den Havel-Radweg und die Tour-Brandenburg, Perwenitz – Paaren im Glien – Nauen – Lietzow – Berge – in Wansdorf an die Radtour »Otto Lilienthal« Unterkünfte Gaststätten · Informationsmappe mit Karten material und leihweise ein GPS-Gerät Ribbeck – Paulinenaue – Pessin – Senzke – Kriele – Kotzen – · tägliche Besprechung der Fahrtrouten Tourismusverband Havelland e. V. Stechow – Rathenow – Steckelsdorf – Grütz – Schollene BAHNANBINDUNG 1 Gemeinschaftshaus Waldschule Krämer www.waldschule-pausin.de 18 Ferienhausvermietung Liane Zemlin F*** www.l-zemlin.de 34 Restaurant »Ahh und Ohh« www.ahhundohh.de Am Anger 18 a, 14621 Schönwalde-Glien OT Pausin, Tel. 033231 62903 Dorfstraße 6, 14715 Stechow-Ferchesar OT Ferchesar, Tel. 033874 60365 Graf-Arco-Straße 9, 14641 Nauen, Tel. 03321 450788 · Transferleistungen des Gepäcks zwischen den einzelnen Übernach- Theodor-Fontane-Straße 10 · 14641 Nauen OT Ribbeck BrandenBurger Nauen, Paulinenaue, Rathenow gastlichkeit 7 DZ 3 FW***, 5 FW, 1 FH 2010 2012 gastliches havelland 35 BRANDENBURG Altstadt-Café-Nickel www.altstadt-cafe-nickel.de Eine Aktion des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Brandenburg e.V., BESCHAFFENHEIT des Tourismusverband Havelland e.V. -

Konzeption Für Die Kita Borstel in Nauen, Landkreis Havelland
Konzeption für die Kita Borstel in Nauen, Landkreis Havelland Kita Borstel Tel.: 03321/ 48131 Ketziner Straße 20 Fax: 03321/828881 14641 Nauen Mail: [email protected] Internet: www.horizont-nauen.de Träger: HORIZONT e.V. Geschäftsführer: Steffen Baßel Tel.: 0 33 21 / 45 53 41 Gebhard – Eckler – Str. 3 Fax: 0 33 21 / 45 02 59 14641 Nauen Mail: [email protected] Internet: www.horizont-nauen.de Konzeption der Kita „Borstel“ - August 2020 Inhaltsverzeichnis 1 DIE EINRICHTUNG STELLT SICH VOR .......................................................................................... 4 1.1 KONTAKTDATEN ............................................................................................................................... 4 1.2 LAGE UND SOZIALES UMFELD ........................................................................................................... 6 1.3 GESCHICHTE DER EINRICHTUNG ....................................................................................................... 6 1.4 UNSERE VORZÜGE UND BESONDERHEITEN ....................................................................................... 7 1.5 DAS TEAM DER KITA „BORSTEL“ ....................................................................................................... 8 1.6 VEREIN, VORSTAND UND KITAFACHAUSSCHUSS ................................................................................ 9 1.7 ÖFFNUNGSZEITEN UND TAGESABLAUF ............................................................................................ 11 1.8 RAUMKONZEPT -
Werfen Sie Hier Einen Blick in Die
2./3. Mai 2020 Ausstellung und Kunstpreis des Landkreises Dahme-Spreewald, der Stadt Luckau sowie Kulturland Brandenburg e. V. OPEN STUDIOS | WORKSHOPS | GALLERIES „Krieg und Frieden“ – 1945 und die Folgen in Brandenburg (Themenjahr Kulturland Brandenburg) Flüchtlinge - ein zeitloses Feindbild? Offene 17. Mai - 17. September 2020 in Luckau Ausstellung von zehn Künstlern aus Berlin und Brandenburg ATELIERS im Stadtraum von Luckau Roland Boden Astrid Köppe Micha Brendel Nele Probst Landeshauptstadt Potsdam Rainer Görss & Hans Scheib Stadt Brandenburg an der Havel Ania Rudolph Roland Schefferski Landkreis Barnim Birgit Knappe Marietta Thier Landkreis Dahme-Spreewald Kurator: Herbert Schirmer Landkreis Elbe-Elster www.spektrale-dahme-spreewald.de Landkreis Havelland Landkreis Märkisch-Oderland Landkreis Oberhavel Landkreis Oberspreewald-Lausitz Landkreis Oder-Spree PREVIEW zum 14. Kunstfestival 2021 – Sonntag, 13. September 2020 Landkreis Ostprignitz-Ruppin in der Spreewald-Destillerie im Handwerksdorf Schlepzig/Slopišća Landkreis Potsdam-Mittelmark www.aquamediale.de Landkreis Prignitz Landkreis Teltow-Fläming Landkreis Uckermark Offene Ateliers ]]]]]] 2. und 3. Mai 2020 Am 2. und 3. Mai 2020 laden wieder zahlreiche Künstlerinnen und Künstler im Land Brandenburg interessierte Besucher herz- lich dazu ein, einen Blick in ihre Ateliers zu werfen. In dreizehn Landkreisen sowie in den Städten Potsdam und Brandenburg heißen Sie die Akteure willkommen, einen Einblick in das Schaffen und den Alltag bildender Künstler zu nehmen. Die Besucher können an beiden Tagen des Offenen Ateliers die Gelegenheit ergreifen, Künstlern bei der Arbeit über die Schulter zu schauen, begleitet von verschiedenen Aktionen und Attraktionen in einem ganz besonderen Ambiente. In den be - teiligten Galerien können Sie die Werke brandenburgischer Künstlerinnen und Künstler bewundern. Darüber hinaus bietet sich die Möglichkeit, mit den Akteuren ins Gespräch zu kommen, Arbeiten zu erwerben und sich auch selbst künstlerisch zu erproben. -
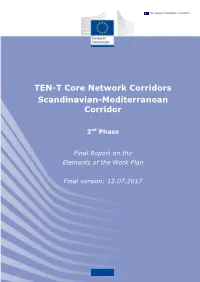
Final Report on Elements of Work Plan
Ref. Ares(2017)3520569 - 12/07/2017 TEN-T Core Network Corridors Scandinavian-Mediterranean Corridor 2nd Phase Final Report on the Elements of the Work Plan Final version: 12.07.2017 12 July 2017 1 Study on Scandinavian-Mediterranean TEN-T Core Network Corridor 2nd Phase (2015-2017) Final Report on the Elements of the Work Plan Information on the current version: The draft final version of the final report on the elements of the Work Plan was submitted to the EC by 22.05.2017 for comment and approval so that a final version could be prepared and submitted by 06.06.2017. That version has been improved with respect to spelling and homogeneity resulting in a version delivered on 30.06.2017. The present version of the report is the final final version submitted on 12.07.2017. Disclaimer The information and views set out in the present Report are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the Commission. The Commission does not guarantee the accuracy of the data included in this study. Neither the Commission nor any person acting on the Commission’s behalf may be held responsible for any potential use which may be made of the information contained herein. 12 July 2017 2 Study on Scandinavian-Mediterranean TEN-T Core Network Corridor 2nd Phase (2015-2017) Final Report on the Elements of the Work Plan Table of contents 1 Executive summary ............................................................................... 13 1.1 Characteristics and alignment of the ScanMed Corridor .............................. 13 1.2 Traffic demand and forecast .................................................................. -

OECD Territorial Grids
BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES DES POLITIQUES MEILLEURES POUR UNE VIE MEILLEURE OECD Territorial grids August 2021 OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities Contact: [email protected] 1 TABLE OF CONTENTS Introduction .................................................................................................................................................. 3 Territorial level classification ...................................................................................................................... 3 Map sources ................................................................................................................................................. 3 Map symbols ................................................................................................................................................ 4 Disclaimers .................................................................................................................................................. 4 Australia / Australie ..................................................................................................................................... 6 Austria / Autriche ......................................................................................................................................... 7 Belgium / Belgique ...................................................................................................................................... 9 Canada ...................................................................................................................................................... -

Region HAVELLAND-FLÄMING
Region HAVELLAND-FLÄMING BRANDENBURG REGIONAL 2006 REGION HAVELLAND-FLÄMING Lage • Landschaft • Überblick Havelland-Fläming, die mit 6.800 km2 flächenmäßig zweitgrößte Region Brandenburgs, liegt im Westen des Landes zwischen Berlin und dem Land Sachsen- Anhalt sowie der Region Prignitz-Oberhavel im Norden und Lausitz-Spreewald im Süden. Sie wird aus den Landkreisen Havelland, Potsdam-Mittelmark und Tel- tow-Fläming sowie den kreisfreien Städten Potsdam und Brandenburg a. d. H. gebildet. Der Sitz der Regio- nalen Planungsstelle in Teltow ist im Unterschied zu den anderen Regionen weder in einer Kreisstadt noch Bis auf die kreisfreie Stadt Brandenburg a. d. H. gren- einem Ober- oder Mittelzentrum. zen alle anderen Kreise der Region an Berlin an. Mit etwa 2.100 km2 gehört ein Drittel Havelland-Flämings Verwaltungs- und zentralörtliche Gliederung 2004 zum engeren Verflechtungsraum (andere Regionen nur bis maximal 16 %). Damit nimmt Havelland-Fläming nahezu die Hälfte der Fläche des gesamten Branden- burger Teiles vom engeren Verflechtungsraum ein. Dementsprechend erreichen die von Berlin ausgehen- den struktur- und wirtschaftsräumlichen Impulse, deren Wirkung im Umland am höchsten ist, hier einen weit- aus größeren Teil als bei anderen Regionen. Es exis- tieren, wie bei allen fünf „tortenschnittartig“ gebildeten Planungsregionen, deutliche, sich z. T. immer noch ver- stärkende wirtschafts- und sozialräumliche Struktur- und Dichteunterschiede zwischen engerem Verflech- tungs- und äußerem Entwicklungsraum, die innerhalb der Region in Potsdam-Mittelmark jedoch nicht so stark ausgeprägt sind wie in Teltow-Fläming und Havelland. Die Suburbanisierungsprozesse vollzogen sich im engeren Verflechtungsraum Havelland-Flämings (frü- heres „Westberliner Umland“) z. T. stärker als in den entsprechenden Räumen anderer Regionen (vormals „Ostberliner Umland“). Sie betreffen dabei sowohl Wirt- schafts- als auch Wohnsuburbanisation und äußern sich in einer hier höheren Arbeitsplatz-, Siedlungs- flächen- oder Bevölkerungszunahme und -dichte. -

Amtsblatt Für Den Landkreis Havelland Seite 90
Amtsblatt für den Landkreis Havelland Jahrgang 13 Rathenow, 2006-06-21 Nr. 11 Inhaltsverzeichnis - Bekanntmachung des Wasser- und Abwasserverbandes Rathenow: 2. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserverbandes Rathenow Seite 90 - Bodendenkmale im Landkreis Havelland Seite 91 Amtsblatt für den Landkreis Havelland Seite 90 Bekanntmachung des Wasser- und Abwasserverbandes Rathenow Wasser- und Abwasserverband Rathenow Beschluss Nr. 1/2006 2. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserverbandes Rathenow vom 29.11.2004 Auf der Grundlage des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) vom 19.12.1991 (GVBl. I. 1991, S. 685) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Mai 1999 (GVBl. I/99, S. 194) sowie der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I/01 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und anderer dienstrechtlicher Vorschriften vom 22. März 2004 (GVBl. I/03 S. 59) hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes Rathenow in ihrer Sitzung am 30.05.2006 die nachfolgende 2. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserverbandes Rathenow vom 29.11.2004 beschlossen. Artikel 1 2. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserverbandes Rathenow vom 29.11.2004 Die Satzung vom 29.11.2004 wird wie folgt geändert: Der § 5 Absatz 2., 1. Satz, erhält folgende Fassung: „§ 5 Verbandsversammlung 2. Die Vertreter haben folgende Stimmen, die nur einheitlich abgegeben werden können: Stadt Rathenow 6 Stimmen Stadt Premnitz 2 Stimmen andere Städte und Gemeinden je 1 Stimme.“ Artikel 2 „Diese 2. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserverbandes Rathenow vom 29.11.2004 tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.“ Rathenow, den 02.06.06 gez. -

Knotenpunktwegenetz Havelland.Pdf
www.pension-sperlingshof.de 1,00 Euro 1,00 Schutzgebühr: Tel. 03322-2560 · Sperlingshof 28 · 14624 Dallgow-Döberitz 14624 · 28 Sperlingshof · 03322-2560 Tel. Oktober 2015 Oktober Stand: bei Berlin und Potsdam zu den schönsten Radtouren. schönsten den zu Potsdam und Berlin bei sind nicht erlaubt. erlaubt. nicht sind Reproduktion, Wiederverwendung oder Nutzung für gewerbliche Zwecke Zwecke gewerbliche für Nutzung oder Wiederverwendung Reproduktion, Land-gut-Hotel Sperlingshof Land-gut-Hotel in Dallgow Dallgow in vom täglich Sie Starten Bild- und Kartenrechte liegen bei den jeweiligen Fotografen/Urhebern. Fotografen/Urhebern. jeweiligen den bei liegen Kartenrechte und Bild- Einzel-, Doppel- u. Familienzimmer · Apartments · Familienzimmer u. Doppel- Einzel-, Gestaltung, Konzeption und redaktionelle Texte sind urheberrechtlich geschützt. geschützt. urheberrechtlich sind Texte redaktionelle und Konzeption Gestaltung, zusammengestellt. Alle Angaben ohne Gewähr. ohne Angaben Alle zusammengestellt. Übernachten am Naturschutzgebiet Döberitzer Heide Döberitzer Naturschutzgebiet am Übernachten Die Daten wurden sorgfältig erhoben, geprüft und und geprüft erhoben, sorgfältig wurden Daten Die Haftungshinweis: Jürgen Fälchle – Fotolia.com – Fälchle Jürgen Titelbild: terra press GmbH, www.terra-press.de GmbH, press terra Karte: Layout, www.aktiv-reisen-bb.de www.havelland-tourismus.de Tel. 03322-25616 · [email protected] · 03322-25616 Tel. Theodor-Fontane-Straße 10, 14641 Nauen OT Ribbeck OT Nauen 14641 10, Theodor-Fontane-Straße Tourismusverband Havelland e.V. Havelland Tourismusverband Herausgeber: Katalog Katalog Katalog kostenfrei anfordern! kostenfrei Impressum weitere Touren Touren weitere Buchung und zur zur Infos Infos Mehr Mehr Vielfalt des Havellandes zeigt. Havellandes des Vielfalt www.shop.havelland-tourismus.de Sie die landschaftlich reizvolle Fluss- und Seentour, die die die die Seentour, und Fluss- reizvolle landschaftlich die Sie in unserem Internetshop erhältlich.