«Der Hochwasserschutz an Der Gürbe»
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Freistehendes Zweifamilienhaus Mit Ehemaliger Schmitte... Verkaufsdokumentation
rychener_briefbogen:rychener_briefbogen 29.5.2008 15:52 Uhr Seite 1 Freistehendes Zweifamilienhaus mit ehemaliger Schmitte... Verkaufsdokumentation Zweifamilienhaus Burgisteinstrasse 12, 3665 Wattenwil rychener immobilien + bau gmbh · höchhusweg 17 · 3612 steffisburg · tel 033 437 00 55 · fax 033 437 00 22 [email protected] · www.rychenerimmobau.ch Verkauf - Beratung rychener immobilien + bau gmbh höchhusweg 17 3612 steffisburg 033 437 00 55 033 437 00 22 [email protected] Livia Hofbauer L www.rychenerimmobau.ch Sachbearbeiterin Immobilien [email protected] Andrea Rychener Betriebsökonomin FH [email protected] Inhaltsverzeichnis Standortangaben .....................................................................................................................................3 Kartenausschnitt. .....................................................................................................................................4 Situationsplan. .........................................................................................................................................5 Objektangaben. .......................................................................................................................................6 Raumprogramm. ......................................................................................................................................7 Fotos und Baubeschrieb. ..........................................................................................................................8 -

Gürbetal Längenberg Schwarzenburgerland
«GANTRISCHPOST» Amtlicher Anzeiger für die Gemeinden: Belp | Gelterfingen | Gerzensee Heute mit Beilage Guggisberg | Jaberg | Kaufdorf | Kirchdorf Jordi AG Der AnzeigerKirchenthurnen | Lohnstorf | Mühledorf Druckerei GÜRBETAL LÄNGENBERG Mühlethurnen | Niedermuhlern | Noflen Frau Grimmbühler Riggisberg | Rüeggisberg | Rümligen Belpbergstrasse 15 3123 Belp 23. Februar 2017 | Nr. 8 SCHWARZENBURGERLAND Rüschegg | Schwarzenburg | Toffen | Wald 15. November 2007 Inseratebestellung für Belper 6-maliges Erscheinen Der Berner Flughafen im Morgennebel Foto: Anton Riedo 7 Stellen 8 Wohnungen / Liegenschaften 11 Schwarzenburgerland 12 Veranstaltungen Die betroffenen Anstösser werden durch 040925J NOTFALLDIENSTE KANTON BERN die Bauleitung direkt informiert. Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis Ärztlicher Notfalldienst Amt für Wald des Kantons Bern für die unumgängliche Massnahme. Einwohnergemeinde Belp Telefonieren Sie Ihrem Hausarzt und hören Waldpflanzenverkauf Abteilung Bau (031 818 22 40) Sie das allfällige Tonband bis zum Schluss Die Waldverjüngung soll vorwiegend durch Zimmerwaldweg Verkehrssperrung ab. Falls Ihr Hausarzt oder der Arzt eigener Naturverjüngung erfolgen. Waldbesitzer, Bachmann Schreinerei AG Belp Die folgende Strasse wird, gestützt auf Art. Hohburgstr. Türen 10, 3123 Belp Fenster,Fenster Tel. 031 819 02 75 Wahl nicht erreichbar ist, können Sie sich die trotzdem Pflanzen beziehen möchten, 44 der Strassenverordnung vom 29. Ok- an den Notfallarzt Ihrer Region wenden. richten ihre Bestellungen bis am 10. März SchränkeSchränke ParkettParkett tober 2008, wie folgt für jeglichen Verkehr Belp und Umgebung: 2017 an den zuständigen Revierförster. gesperrt: ReparaturenReparaturen BrandschutzBrandschutz Ärztenotfallnummer der Region Belp Für die Gemeinden Noflen, Rüeggis- Zimmerwaldweg Abzweiger Seftigen- und Umgebung 0900 57 67 47 (med- berg, Riggisberg, Rüschegg Freundliche Grüsse strasse bis untere Längenbergstrasse. Bachmann Schreinerei AG Belp phone Fr. 1.98 pro Min.) Dummermuth Markus, Zelg 6, 3662 Seftigen Dauer: Montag 6. -

How a Catastrophic Flood of the Gürbe River Triggered the Rethinking of Local Flood Protection." Arcadia (Summer 2019), No
How a Catastrophic Flood of the Gürbe River Triggered the Rethinking of Local Flood Protection Melanie Salvisberg On the evening of 29 July 1990, after a warm and sunny day, the sky over the Gantrisch region in the Swiss pre- Alps suddenly darkened. A huge thunderstorm appeared—a thunderstorm that not only set a meteorological record, but also changed the approach to flood protection in the Gürbe River area profoundly. Within a short period, the water level rose rapidly, causing the 29-kilometer-long river, a tributary that joins the Aare River south of Bern, to overflow. The water and the bed load caused severe damage to hydraulic structures, farmland, settlements, and traffic facilities near the river. The total cost of the damage was estimated to be 40 million Swiss francs. | downloaded: 4.10.2021 Flooded settlement in Toffen after the event of 29 July 1990. Photograph by Comet Photo AG (Zürich) / Com_LC0940-007-015. Accessed via ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, on 14 August 2019. Click here to view source. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License . Although the Gürbe Valley was known to be flood-prone, due to frequent thunderstorms, steep slopes, soil with low water-storage capacity, and soft rock in the upper reaches, the extent of the event was a shock, especially because extensive measures had been taken to prevent inundations since the mid-nineteenth century. The efforts had started with alterations to the Gürbe River from 1855 to 1881. With the intent of protecting the Gürbe Valley from flooding but also of reclaiming new land from the swampy flood plain, the previously meandering https://doi.org/10.7892/boris.133218 source: Source URL: http://www.environmentandsociety.org/node/8762 Print date: 12 September 2019 13:29:29 Salvisberg, Melanie. -

Bernstarke Finanzen Statt 5 Geldverschwendung
www.svp -bernw.cwhw, S.VsvPp K-baen rtno.nc hB ,e SrVn,P N Kovanetmonb eBre /r nD , ez'FeCmSVbBeS r,, Nrr . 4-201 7 #ber n s t ark A Z B 3 0 0 0 B e r n 2 #bernstarke Finanzen statt 5 Geldverschwendung die Staatsaufgaben ausgebaut niveler vers le bas et de bureau - und dafür gesorgt haben, dass cratiser. Supprimer les notes à sich Bern immer stärker von l’école, plumer les automobilis - den anderen Kantonen via Fi - tes, augmenter les impôts n’ont nanzausgleich alimentieren las - été évités de justesse que grâce sen muss. à l’UDC. Le succès à la dernière Sie haben noch immer nicht élection complémentaire au gelernt, dass eine einmalige Conseil-exécutif donne un sig - Zahlung nicht etwas ist, womit nal clair. Les mesures d’allège - man auch in den Folgejahren ment adoptées au Grand Con - Imagine rechnen kann. Wirtschaften seil marquent le premier grand Stell‘ Dir vor, es sind Wahlen und diese Kreise wohl privat auch succès de la nouvelle majorité keiner wählt. 70% wählen tatsäch - so? Die Cüpli-Vertreter dieser bourgeoise au gouvernement. lich nicht. Weil ohnehin alles wie Parteien wissen offensichtlich gewünscht funktioniert? Oder weil nicht mehr, wie es ist, wenn man Das Entlastungspaket gab zu sie anderes zu tun haben? Wie sich mit einem kleinen Lohn reden – gut so, denn nur wenn auch immer, die Demokratie funk - nicht viel leisten kann, deshalb man darüber spricht, kann man tioniert trotzdem. können sie nicht mehr mit Geld auch aufdecken, wo überall aus Stell‘ Dir vor, es sind Wahlen und umgehen. -

Fusionsvertrag Zwischen Den Einwohngerminden Gelterfingen, Kirchdorf, Mühledorf Und Noflen
4er-Fusion Gelterfingen Kirchdorf Mühledorf Noflen Fusionsvertrag zwischen den Einwohnergemeinden Gelterfingen, Kirchdorf, Mühledorf und Noflen Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 2 1 Allgemeines 3 2 Namen und Gebiet der fusionierten Gemeinde sowie Verlauf der neuen Grenzen 4 3 Beschlussfassung über das Organisationreglement und das Fusions-reglement 4 4 Zeitpunkt des Zusammenschlusses, Vollzugs 4 5 Einsetzung der Organe und Organisation der neuen Einwohnergemeinde Kirchdorf inkl. Personal 5 6 Zuständigkeit zur Fortführung der hängigen Geschäfte 7 7 Beschlussfassung über Jahresrechnung und Budget 7 8 Zuständigkeit und Vorgehen zur Bestimmung des Wappens der neuen Einwohnergemeinde Kirchdorf 7 9 Übergangs- und Schlussbestimmungen 8 10 Anhänge zum Fusionsvertrag: 9 10.1 Anhang 1: Kartografische Darstellung der neuen Gemeindegrenzen 9 10.2 Anhang 2: Inventar der vom Zusammenschluss betroffenen Grundstücke der vertragsschliessenden Gemeinden 10 10.2.1 Einwohnergemeinde Gelterfingen 10 10.2.2 Einwohnergemeinde Kirchdorf 11 10.2.3 Einwohnergemeinde Mühledorf 13 10.2.4 Einwohnergemeinde Noflen 14 10.2.5 Wasserversorgung Kirchdorf-Mühledorf-Noflen 15 10.3 Beilage 1: Inventar der Mitgliedschaften der vertragschliessenden Gemeinden in Gemeindeverbänden und anderen öffentlichrechtlichen und privatrechtlichen Institutionen 15 Seite I 2 Die Einwohnergemeinden Gelterfingen, Kirchdorf, Mühledorf und Noflen schliessen gestützt auf - Artikel 4e und Artikel 4c Absatz 1 Buchstabe b des Gemeindegesetzes vom 16.3.1998 (GG) und in Anwendung von Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe e GG in Verbindung mit Arti- kel 2 der Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 (GV) - die Beschlüsse der Stimmberechtigten der vier Gemeinden vom 21. Mai 2017 den folgenden Fusionsvertrag ab: 1 Allgemeines Zweck Art. 1 Die Einwohnergemeinden Gelterfingen, Kirchdorf, Mühledorf und Noflen vereinbaren, dass sie sich zur neuen Einwohnergemeinde Kirch- dorf zusammenschliessen. -

Liniennetz Thun Und Umgebung Linden Jassbach Aeschlen Linden Gridenbühl Grafenbühl Schlegwegbad Oberdiessbach Abzw
Konolfingen 711 Linden Dorf Liniennetz Thun und Umgebung Linden Jassbach Aeschlen Linden Gridenbühl Grafenbühl Schlegwegbad Oberdiessbach Abzw. Bleiken Langenegg Bahnhof 44 Heimenschwand Hinterägerten 167 Oberdiessbach Aeschlen Aeschlen Marbach 44 Münsingen 167 Kastanienpark Dorf Bareichte Scheidweg Heimenschwand Post Herbligen Dorf 42 Heimenschwand Badhaus Bern Bruchenbühl Brenzikofen Höh Heimberg Dornhalde Wangelen Mühlematt 711 710 3 Wangelen Wendeplatz 43 Kuhstelle HeimenschwandWachseldornDorf Feuerwehrmagazin Hof WachseldornSüderen Schulhaus Dorf Buechwaldstrasse Rohrimoos Bad Heimenschwand Aare Riedackerstrasse Bühl Rothachen Süderen Oberei Alte Post Burgistein 701 Oberlangenegg Innerer Kreuzweg Bern Heimberg Bahnhof Fischbach Sportzentrum Obere MürggenRachholtern Lood Fahrni Dörfli Fahrni Bach Hänni UnterlangeneggAebnitSchwarzenegg Ried SchmiedeBären Ried Käserei Oberlangenegg Stalden Fahrni Lueg Gysenbühl Bödeli MoosbodenGarage Laueligrabenweg 41 Eriz Säge 712 Uttigen Aarhölzliweg Steffisburg Wendeplatte Schmiede Fahrni Unterlangenegg Bühl Schiessstand Linden Zeichenerklärung 53 Seftigen Bahnhof Heimberg Lädeli Fahrni Schlierbach Kreuzweg Schwand Abrahams Schoss 711 Tarifzone TUS Eriz Losenegg 700 Steffisburg Engerain Oberes Flühli Bieten Schulhaus Gurzelen Steffisburg Emberg Schwarzenegg Dorf Gesamtes LIBERO- Gurzelen Stuffäri Kreuz Jungfrau- Schwarzenegg Dürren Fahrausweisangebot gültig strasse Alte Bernstrasse Steffisburg Flühli 1 Haldeneggweg 57 Uetendorf Zulgbrücke Steffisburg Kirche Nur LIBERO-Abos gültig Riggisberg Gurzelen -

FAG Listebestandeneprfungfa
Seite 1 von 4 Folgende Personen haben den Lehrgang zur Erlangung des Fachausweises als Bernische Gemeindefachfrau/Bernischer Gemeindefachmann 2020 bestanden Anrede Nachname Vorname Ort Arbeitgeber Frau Aeschlimann Selina Vanessa Thun Gemeindeverwaltung Fahrni b. Thun Frau Balzer-Kaufmann Yvonne Goldiwil (Thun) Einwohnergemeinde Heimberg Frau Bartenbach Nina Oberbalm Gemeinde Gerzensee Frau Baumberger Mara Koppigen Gemeindeverwaltung Signau Herr Beer Thomas Egerkingen Gemeindeverwaltung Niederbipp Frau Bergmann Christa Worb Gemeindeverwaltung Rubigen Frau Beyeler Jasmin K. Brienzwiler Gemeindeverwaltung Meiringen Frau Bieri Nadja Aeschi b. Spiez Gemeindeverwaltung Aeschi b. Spiez Herr Bigler Jürg Worb Gemeindeverwaltung Worb Herr Bigler Peter Uetendorf Einwohnergemeinde Heimberg Frau Böninger Janine Roggwil BE Gemeindeverwaltung Wynau Herr Brülhart Manfred Münchringen Einwohnergemeinde Grossaffoltern Frau Burkhalter Livia Längenbühl Einwohnergemeinde Gurzelen Frau Bürki Nadia Denise Spiez Stadt Thun Frau di Fede Alessandra Visp Gemeindeverwaltung Oberems Herr Dieterle Dominik Konolfingen Gemeindeverwaltung Schwarzenburg Herr Dubach Daniel Lotzwil Einwohnergemeinde Thunstetten Frau Durand Carla Sophie Wattenwil Gemeindeverwaltung Amsoldingen bwd | Papiermühlestrasse 65 | 3014 Bern | Tel. 031 330 19 90 | [email protected] | www.bwdbern.ch Seite 2 von 4 Frau Durtschi Sabine Uetendorf Einwohnergemeinde Uetendorf Frau Eichenberger Lisa Heimberg Einwohnergemeinde Münsingen Frau Franz Fabienne Boll Gemeindeverwaltung Biglen Frau Giglio Chiara Lara -

Die Amtsbezirke ; Die Einwohnergemeinden = Les Districts ; Les Communes Municipales
Die Amtsbezirke ; die Einwohnergemeinden = Les districts ; les communes municipales Objekttyp: Group Zeitschrift: Staatskalender des Kantons Bern = Annuaire officiel du canton de Berne Band (Jahr): - (2004) PDF erstellt am: 03.10.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Autorités de district 229 Die Amtsbezirke - Les districts -

Fusionsprojekte Im Kanton Bern (Stand: 25. April 2016)
Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern Fusionsprojekte im Kanton Bern (Stand: 25. April 2016) aktuelle Version unter http://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/gemeinden/gemeinden.html Fusion / Praxisbeispiele Fusionen Die gelben Markierungen zeigen Veränderungen/Projektfortschritte seit Dezember 2015. I. Laufende Fusionsprojekte Gemeinden Anzahl Stand Fusionsprojekt Fusion Gemeinden geplant per 1. Langenthal / 2 Gemäss Pressebericht vom 12. 1.1.2018 Obersteckholz September 2014 hat die Stadt Langenthal eine Anfrage zur Auf- nahme von Fusionsabklärungen positiv beantwortet. An der Gemeindeversammlung von Obersteckholz vom 3. De- zember 2014 wird mit 66 zu 3 Stimmen beschlossen, Fusionsab- klärungen mit Langenthal aufzu- nehmen. Im Juni 2016 wird der Grundsatzentscheid und im Sep- tember 2017 der definitive Ent- 600-14-130 scheid gefällt. 2. Grosshöchstet- 2 An den Gemeindeversammlungen 1.1.2018 ten / Schlosswil vom 2. Juni 2015 (Schlosswil) und 11. Juni 2015 (Grosshöchstetten) haben die Gemeinden beschlos- sen, Fusionsabklärungen aufzu- nehmen. Der Grundsatzentscheid über die Fortsetzung ist für Ende 2016, die definitive Abstimmung im 600-14-131 Juni, ev. September 2017 geplant. 3. Gelterfingen / 4 Nach dem Ausstieg von Gerzen- 1.1.2018 Kirchdorf / Nof- see Ende 2014 haben die Ge- len / Mühledorf meindeversammlungen der vier Gemeinden Ende November/An- fang Dezember 2015 beschlossen, erneute Fusionsabklärungen auf- zunehmen. Der Grundsatzent- 600-15-24 scheid erfolgt Ende 2016. 4. Hermrigen / 3 An den Gemeindeversammlungen 1.1.2018 Merzligen / Jens vom 20. Mai 2015 (Merzligen), oder vom 1. Juni 2015 (Jens) sowie 1.1.2019 vom 24. Juni 2015 (Hermrigen) haben die Gemeinden beschlos- sen, Fusionsabklärungen aufzu- 600-14-56 nehmen. Der Grundsatzentscheid erfolgt Ende 2016. -

31.050 Thun - Uebeschi - Blumenstein - (Linie 50) Thun - Wattenwil - Blumenstein - (Linie 51) Stand: 21
FAHRPLANJAHR 2020 31.050 Thun - Uebeschi - Blumenstein - (Linie 50) Thun - Wattenwil - Blumenstein - (Linie 51) Stand: 21. Oktober 2019 Montag–Freitag ohne allg. Feiertage 50000 50002 51002 50006 51008 50008 51010 50010 Thun, Bahnhof 5 58 6 28 7 01 7 31 8 01 8 31 9 01 9 31 Thun, Postbrücke 6 00 6 30 7 03 7 33 8 03 8 33 9 03 9 33 Thun, Guisanplatz 6 00 6 30 7 04 7 33 8 04 8 33 9 03 9 33 Thun, Hauptkaserne 6 01 6 31 7 05 7 34 8 05 8 34 9 04 9 34 Thun, Dufourkaserne 6 02 6 32 7 06 7 35 8 06 8 35 9 05 9 35 Thun, S+W 6 02 6 32 7 06 7 35 8 06 8 35 9 05 9 35 Thun, Kleine Allmend 6 03 6 33 7 07 7 36 8 07 8 36 9 06 9 36 Thun, Zollhaus 6 05 6 35 7 09 7 38 8 09 8 38 9 08 9 38 Thierachern, unterer Schwand 7 40 8 40 9 10 9 40 Thierachern, 7 41 8 41 9 11 9 41 mittlerer Schwand Thierachern, Niesenstrasse 7 42 8 42 9 12 9 42 Thierachern, Oberer Schwand 6 07 6 37 7 11 7 43 8 11 8 43 9 13 9 43 Thierachern, Räbgass 6 08 6 38 7 12 7 44 8 12 8 44 9 14 9 44 Thierachern, Kirche 6 10 6 40 7 13 7 46 8 13 8 46 9 16 9 46 Thierachern, Egg 6 11 6 41 7 15 7 47 8 15 8 47 9 17 9 47 Thierachern, Wahlen 6 12 6 42 7 16 7 49 8 16 8 49 9 19 9 49 Thierachern, Sandbühl 7 50 8 50 9 50 Uebeschi, Weiersbühl 7 51 8 51 9 51 Uebeschi, Dorf 7 52 8 52 9 52 Uebeschi, Neubau 7 53 8 53 9 53 Uebeschi, Neurütti 7 53 8 53 9 53 Uebeschi, Dürrenbühl 7 54 8 54 9 54 Uebeschi, Kärselen 6 14 6 44 Blumenstein, Secki 6 15 6 45 7 55 8 55 9 55 Blumenstein, Reckenbühl 6 15 6 45 7 55 8 55 9 55 Blumenstein, Lochmannsbühl 6 16 6 46 7 56 8 56 9 56 Blumenstein, Post 6 17 6 47 7 58 8 58 9 58 Blumenstein, Gemeindehaus 6 17 Thierachern, Wegweiser 7 17 8 17 9 20 Längenbühl, Weiermatt 7 18 8 18 9 21 Längenbühl, Grizzlibär 7 19 8 19 9 22 Längenbühl, Bach 7 20 8 20 9 23 Forst b. -

Die Region Thun-Oberhofen Auf Ihrem Weg in Den Bernischen Staat (1384–1803)
Die Region Thun-Oberhofen auf ihrem Weg in den bernischen Staat (1384–1803) Anne-Marie Dubler1 Inhaltsverzeichnis 1. Die Region zur Zeit der Grafen von Kiburg: Stadt Thun, Äusseres Amt, Adelsherrschaften .............................. 64 2. Die Stadt Thun und das Freigericht unter Bern: Die Neugestaltung der Verwaltung ............................................... 68 Stadt Thun: Stadtraum und Burgernziel ....................................... 69 Das Freigericht ersetzt das Äussere Amt ....................................... 70 Wem Gericht und Galgen gehören, dem gehört die Herrschaft: Die Rolle der Gerichtsbarkeit ....................................................... 71 3. Der Ausbau der bernischen Landesverwaltung in der Region ....... 77 Das Amt Thun und seine Erweiterung.......................................... 77 Die Vogtei Oberhofen – eine späte Neuschöpfung........................ 83 Die Amtsverwaltungen von Thun und Oberhofen: Schultheissen von Thun................................................................ 83 Vögte von Oberhofen................................................................... 84 Landschreiber von Thun .............................................................. 85 Amtsschreiber von Oberhofen...................................................... 86 Berns Strategie beim Aufbau der Landesherrschaft in der Region ... 86 4. Die Stadt Thun erwirbt und verwaltet Herrschaften über ihr Stadtspital....................................................................... 87 5. Die Privatherrschaften in der Region -
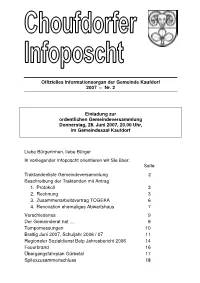
Offizielles Informationsorgan Der Gemeinde Kaufdorf 2007 – Nr. 2
Offizielles Informationsorgan der Gemeinde Kaufdorf 2007 – Nr. 2 Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung Donnerstag, 28. Juni 2007, 20.00 Uhr, im Gemeindesaal Kaufdorf Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger In vorliegender Infoposcht orientieren wir Sie über: Seite Traktandenliste Gemeindeversammlung 2 Beschreibung der Traktanden mit Antrag 1. Protokoll 3 2. Rechnung 3 3. Zusammenarbeitsvertrag TOGEKA 6 4. Renovation ehemaliges Abwartshaus 7 Verschiedenes 9 Der Gemeinderat hat … 9 Tempomessungen 10 Brattig Juni 2007, Schuljahr 2006 / 07 11 Regionaler Sozialdienst Belp Jahresbericht 2006 14 Feuerbrand 16 Übergangsfahrplan Gürbetal 17 Spitexzusammenschluss 18 Choufdorfer 2007 Nr. 2 Seite 2 Gemeindeversammlung vom 28.06.2007, 20 Uhr, im Gemeindesaal Traktanden 1 Protokoll 1.1 Protokoll der ausserordentlichen Versammlung der Einwohner- gemeinde vom 15. März 2007; Beratung, Genehmigung 2 Rechnung 2006 2.1 Kenntnisnahme des Rechnungsergebnisses 2006 3 Zusammenarbeitsvertrag TOGEKA 3.1 Feuerwehr – Zusammenarbeitsvertrag der Einwohnergemeinden Toffen, Gelterfingen und Kaufdorf mit Inkrafttreten per 01. Januar 2008 Orientierung, Beratung, Beschluss 4 Renovation ehemaliges Abwartshaus, Dorfstrasse 14, Kaufdorf 4.1 Kreditbeschluss Orientierung, Beratung, Beschluss Hinweis: Besichtigungsmöglichkeit des Abwartshauses für die Öffentlichkeit: Do. 21.06.2007, 18.00 – 20.00 Uhr Do. 28.06.2007, 17.00 – 20.00 Uhr 5 Orientierungen 6 Verschiedenes Rechtspflege Gegen Versammlungsbeschlüsse kann innert 30 Tagen, bei Wahlen innert 10 Tagen, nach der Versammlung beim Regierungsstatthalteramt Seftigen, Schloss, 3123 Belp, schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden (Artikel 97 Gemeindegesetz). Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist in der Regel sofort zu beanstanden (Art. 98 Gemeindegesetz). Die Versammlung ist öffentlich; Interessierte sind dazu freundlich eingeladen. Stimmberechtigt sind Schweizer Bürger und Bürgerinnen ab dem 18. Altersjahr, die seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnhaft sind.