Kiesinger Abgelöst Wurde
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

30Years 1953-1983
30Years 1953-1983 Group of the European People's Party (Christian -Demoeratie Group) 30Years 1953-1983 Group of the European People's Party (Christian -Demoeratie Group) Foreword . 3 Constitution declaration of the Christian-Democratic Group (1953 and 1958) . 4 The beginnings ............ ·~:.................................................. 9 From the Common Assembly to the European Parliament ........................... 12 The Community takes shape; consolidation within, recognition without . 15 A new impetus: consolidation, expansion, political cooperation ........................................................... 19 On the road to European Union .................................................. 23 On the threshold of direct elections and of a second enlargement .................................................... 26 The elected Parliament - Symbol of the sovereignty of the European people .......... 31 List of members of the Christian-Democratic Group ................................ 49 2 Foreword On 23 June 1953 the Christian-Democratic Political Group officially came into being within the then Common Assembly of the European Coal and Steel Community. The Christian Democrats in the original six Community countries thus expressed their conscious and firm resolve to rise above a blinkered vision of egoistically determined national interests and forge a common, supranational consciousness in the service of all our peoples. From that moment our Group, whose tMrtieth anniversary we are now celebrating together with thirty years of political -
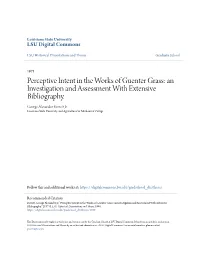
Perceptive Intent in the Works of Guenter Grass: an Investigation and Assessment with Extensive Bibliography
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1971 Perceptive Intent in the Works of Guenter Grass: an Investigation and Assessment With Extensive Bibliography. George Alexander Everett rJ Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses Recommended Citation Everett, George Alexander Jr, "Perceptive Intent in the Works of Guenter Grass: an Investigation and Assessment With Extensive Bibliography." (1971). LSU Historical Dissertations and Theses. 1980. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/1980 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Historical Dissertations and Theses by an authorized administrator of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. 71-29,361 EVERETT, Jr., George Alexander, 1942- PRECEPTIVE INTENT IN THE WORKS OF GUNTER GRASS: AN INVESTIGATION AND ASSESSMENT WITH EXTENSIVE BIBLIOGRAPHY. The Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, Ph.D., 1971 Language and Literature, modern University Microfilms, A XEROX Company, Ann Arbor, Michigan THIS DISSERTATION HAS BEEN MICROFILMED EXACTLY AS RECEIVED Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. PRECEPTIVE INTENT IN THE WORKS OF GUNTER GRASS; AN INVESTIGATION AND ASSESSMENT WITH EXTENSIVE BIBIIOGRAPHY A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of Foreign Languages by George Alexander Everett, Jr. B.A., University of Mississippi, 1964 M.A., Louisiana State University, 1966 May, 1971 Reproduced with permission of the copyright owner. -

Dr. Johann Wadephul Eröffnet Ausstellung Zum 80. Geburtstag Von Dr
23.09.2008 | Nr. 325/08 Johann Wadephul: Dr. Johann Wadephul eröffnet Ausstellung zum 80. Geburtstag von Dr. Gerhard Stoltenberg Sperrfrist 19:00 Uhr Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Dr. Johann Wadephul, hat heute (23. September) den ehemaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Dr. Gerhard Stoltenberg als „bleibendes Vorbild für die heutige Politikergeneration der CDU“ bezeichnet. Anlässlich der Eröffnung einer Ausstellung zum 80. Geburtstag von Dr. Gerhard Stoltenberg in den Räumen der CDU-Fraktion im Kieler Landtag würdigte Wadephul die Leistungen Stoltenbergs in Bund und Land: „Gerhard Stoltenberg war ein ganz Großer. Ein Leuchtturm in der deutschen Politik. Groß war er nicht nur äußerlich durch Gestalt und Haltung, sondern als Autorität, die getragen war von umfassender Bildung, fachlicher Kompetenz und unbestrittener moralischer Integrität“, so Wadephul. Zur Eröffnung der gemeinsamen Ausstellung der CDU-Landtagsfraktion und der Hermann Ehlers Stiftung kamen über 100 Gäste, darunter die Tochter Gerhard Stoltenbergs, Susanne Stoltenberg. Die Ausstellung ist dem politischen Wirken des ehemaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten, Bundesminister und CDU- Landesvorsitzenden, gewidmet, der am 29. September dieses Jahres seinen 80. Geburtstag gefeiert hätte. Stoltenberg verstarb am 23 November 2001 in Kiel. Fraktionschef Wadephul erinnerte daran, dass Stoltenberg bereits mit 26 Jahren in den Schleswig-Holsteinischen Landtag einzog. Besonders geprägt habe er Schleswig- Holstein in seiner Zeit als Ministerpräsident von 1971 bis 1982. Sein überwältigender Wahlsieg mit 51,7 Prozent bei der Landtagswahl 1971 habe einen Wiederaufstieg für die gesamte Bundes-CDU bedeutet. Insgesamt drei Mal hätten die Bürger zu Zeiten Stoltenbergs die CDU mit absoluter Mehrheit gewählt. Wadephul: „Sozusagen wählten die Bürger seines Landes Gerhard Stoltenberg dreimal mit absoluter Mehrheit zum Ministerpräsidenten.“ Stoltenberg habe wegen seines überragenden Sachverstandes über die Parteigrenzen hinweg Anerkennung gefunden. -

Bulletin of the GHI Washington Supplement 1 (2004)
Bulletin of the GHI Washington Supplement 1 (2004) Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. “WASHINGTON AS A PLACE FOR THE GERMAN CAMPAIGN”: THE U.S. GOVERNMENT AND THE CDU/CSU OPPOSITION, 1969–1972 Bernd Schaefer I. In October 1969, Bonn’s Christian Democrat-led “grand coalition” was replaced by an alliance of Social Democrats (SPD) and Free Democrats (FDP) led by Chancellor Willy Brandt that held a sixteen-seat majority in the West German parliament. Not only were the leaders of the CDU caught by surprise, but so, too, were many in the U.S. government. Presi- dent Richard Nixon had to take back the premature message of congratu- lations extended to Chancellor Kiesinger early on election night. “The worst tragedy,” Henry Kissinger concluded on June 16, 1971, in a con- versation with Nixon, “is that election in ’69. If this National Party, that extreme right wing party, had got three-tenths of one percent more, the Christian Democrats would be in office now.”1 American administrations and their embassy in Bonn had cultivated a close relationship with the leaders of the governing CDU/CSU for many years. -

Central Europe
Central Europe West Germany FOREIGN POLICY wTHEN CHANCELLOR Ludwig Erhard's coalition government sud- denly collapsed in October 1966, none of the Federal Republic's major for- eign policy goals, such as the reunification of Germany and the improvement of relations with its Eastern neighbors, with France, NATO, the Arab coun- tries, and with the new African nations had as yet been achieved. Relations with the United States What actually brought the political and economic crisis into the open and hastened Erhard's downfall was that he returned empty-handed from his Sep- tember visit to President Lyndon B. Johnson. Erhard appealed to Johnson for an extension of the date when payment of $3 billion was due for military equipment which West Germany had bought from the United States to bal- ance dollar expenses for keeping American troops in West Germany. (By the end of 1966, Germany paid DM2.9 billion of the total DM5.4 billion, provided in the agreements between the United States government and the Germans late in 1965. The remaining DM2.5 billion were to be paid in 1967.) During these talks Erhard also expressed his government's wish that American troops in West Germany remain at their present strength. Al- though Erhard's reception in Washington and Texas was friendly, he gained no major concessions. Late in October the United States and the United Kingdom began talks with the Federal Republic on major economic and military problems. Relations with France When Erhard visited France in February, President Charles de Gaulle gave reassurances that France would not recognize the East German regime, that he would advocate the cause of Germany in Moscow, and that he would 349 350 / AMERICAN JEWISH YEAR BOOK, 1967 approve intensified political and cultural cooperation between the six Com- mon Market powers—France, Germany, Italy, Belgium, the Netherlands, and Luxembourg. -

Stefan Appelius Als Pazifistin in Bonn: Alma Kettigs Weg in Der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion
Stefan Appelius Als Pazifistin in Bonn: Alma Kettigs Weg in der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion 1. Die Kontroverse um die Wiederaufrüstung Theo Pirker beschreibt das politische Klima in der Bundesrepublik mit Blick auf den Bundestagswahlkampf im Jahre 1953 sehr zutreffend mit der Feststellung, der Antikommunismus habe in der breiten Masse der Bevöl- kerung Westdeutschlands in jenen Jahren die Position des Antisemitismus eingenommen, in Form eines tiefen, weltanschaulich verhärteten und durch Propaganda stets aufs neue aktualisierbaren Vorurteils.1 Der Wahltag am 6. September 1953 brachte der SPD mit lediglich 28,8 % der Stimmen eine vernichtende Niederlage ein und der jungen Wittener Sozialdemokratin Alma Kettig den Einzug in den Bundestag. Alma Kettig hatte nur widerwillig und rein formal auf einem hinteren Platz der nord- rheinwestfälischen SPD-Landesliste kandidiert. Durch den Verlust sicher geglaubter Direktmandate "zog" die SPD-Landesliste in NRW erheblich besser als zunächst berechnet und bescherte so in den frühen Morgen- stunden des 7. September 1953 einer völlig überraschten Frau die Nach- richt, ihre parlamentarische Laufbahn habe soeben begonnen: "In Witten gab es fast einen kleinen Aufstand. Viele hatten ja gar nicht mitbekommen, daß ich kandidierte. Ich hatte gerade ein kleines Appartement gemietet, meine erste eigene Wohnung! Dafür hatte ich lange gespart. 20 Jahre lang hatte ich möbliert gewohnt. Als ich gerade Fenster putzte, wurde ich ans Telefon gerufen. 'Sitzt du oder stehst du?' fragten mich die Genossen aus dem Bezirksbüro. 'Wir möchten dir gratulieren'. Ich dachte, sie gratulieren mir zur Wohnung. 'Nein', sagten sie, 'zu ganz etwas anderem; du bist Bundestagsabgeordnete!' Ich konnte das zunächst gar nicht glauben. 'Allmächtiger Strohsack', dachte ich, 'was denn nun?'"2 1 Theo Pirker, 1965, S.181. -

Elisabeth Schwarzhaupt
Kennen Sie diese Frau? - Erste Konsistorialrätin (1939) - Erste deutsche Bundesministerin für Gesundheitswesen (1961-1966) - Erste Frau, welcher das Großkreuz des Bundesverdienstkreuzes verliehen wurde (1965) - Erste Vorsitzende des Deutschen Frauenrats (1970-1972) …Elisabeth Schwarzhaupt * 07.01.1901 in Frankfurt am Main † 30.10.1986 in Frankfurt am Main Elisabeth Schwarzhaupt, eine Frau, die Theaterkritikerin oder Jugendrichterin werden wollte. Groß geworden in einem liberalen, demokratischen Haushalt. Dennoch wurde ihr Wunsch, später als Theater- und Kunstkritikerin zu arbeiten von ihrem Vater abgelehnt. Stattdessen besuchte sie ein Lehrerinnenseminar und beginnt anschließend ein Jura Studium. Nach dem zweiten juristischen Staatsexamen fängt sie als Gerichtsassessorin in einer Rechtsberatung für Frauen an. E. Schwarzhaupt beschäftigt sich mit den Lektüren „Mein Kampf“ und „Mythos des 20. Jahrhunderts“ und bezieht 1932 öffentlich Stellung gegen das nationalsozialistische Frauenbild in „Die Stellung der Frau im Nationalsozialismus“. Ihr Verlobter, ein jüdischer Arzt verliert 1933 die Zulassung und emigriert in die Schweiz. Schwarzhaupt bemüht sich um eine berufliche Perspektive in der Schweiz. Nachdem sie 1936 immer noch nicht fündig wurde, beschließt sie in Deutschland zu bleiben und das Paar geht getrennte Wege. Hier wird schon eine feministische Ausrichtung in ihrem Leben sichtbar: Unabhängigkeit und Selbstständigkeit steht vor dem Liebesglück. Der Nationalsozialismus trifft auch Schwarzhaupts Karriere. 1933 wird auch sie Opfer einer frauenverachtenden Politik, welche es ihr verbietet weiterhin im Justizdienst tätig zu sein. So folgt eine Phase der Umorientierung, in der sie eine Promotion zum Thema „Fremdwährungsklauseln im deutschen Schuldrecht“ 1935 abschließt. Sie beginnt anschließend bei der Kirchenkanzlei der Deutschen Evangelischen Kirche in Berlin zu arbeiten und wird 1939 als erste Frau zur Konsistorialrätin und 1944 sogar zur Oberkonsistoralrätin ernannt. -

Bbm:978-3-322-95484-8/1.Pdf
Anmerkungen Vgl. hierzu: Winfried Steffani, Monistische oder pluralistische Demokratie?, in: Günter Doeker, Winfried Steffani (Hrsg.), Klassenjustiz und Pluralismus. Festschrift ftir Ernst Fraenkel, Ham burg 1973, S. 482-514, insb. S. 503. 2 Da es im folgenden um die Untersuchung eines speziellen Ausschnittes des bundesdeutschen Regierungssystems geht, kann unter dem Aspekt arbeitsteiliger Wissenschaft auf die Entwick lung eines eigenständigen ausgewiesenen Konzepts parlamentarischer Herrschaft verzichtet werden. Grundlegend ftir diese Untersuchung ist die von Winfried Steffani entwickelte Parla mentarismustheorie, vgl. zuletzt: ders., Parlamentarische und präsidentielle Demokratie, Opla den 1979, S. 160-163. 3 Steffani, Parlamentarische und präsidenticlle Demokratie, a.a.O., S. 92f. 4 Theodor Eschenburg, Zur politischen Praxis in der Bundesrepublik, Bd. 1, 2. überarbeitete und mit Nachträgen versehene Auflage, München 1967, Vorwort, S. 10. 5 Zur Bedeutung des Amtsgedankens für die politische Theorie vgl. Wilhelm Hennis, Amtsgedanke und Demokratiebegriff, in: ders., Die mißverstandene Demokratie, Freiburg im Breisgau 1973, S.9-25. 6 Ein Amtseid für Parlamentspräsidenten, so wie er von Wolfgang Härth gefordert wird, würde dieser Verpflichtung des Bundestagspräsidenten öffentlichen Ausdruck verleihen und sie damit zusätzlich unterstreichen. Eine Vereidigung des Bundestagspräsidenten wäre schon allein aus diesem Grunde sinnvoll und erforderlich. Vgl. Wolfgang Härth, Parlamentspräsidenten und Amtseid, in: Zeitschrift ftir Parlamentsfragen, Jg. 11 (1980), S. 497·503. 7 Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik, übersetzt und herausgegeben von Franz Dirlmeier, 5. Aufl. Berlin (Akademie-Verlag) 1969, 1094b (S. 6f): "Die Darlegung wird dann befriedigen, wenn sie jenen Klarheitsgrad erreicht, den der gegebene Stoff gestattet. Der Exaktheitsanspruch darf nämlich nicht bei allen wissenschaftlichen Problemen in gleicher Weise erhoben werden " 8 Vgl. als Kritik aus neuerer Zeit z. -

VI Analyse Der Wiederaufnahme Der Beziehungen
VI Analyse der Wiederaufnahme der Beziehungen VI.1 Entscheidungsträger VI.1.1 Bundeskanzler Kiesinger 1966 wurde mit Kurt Georg Kiesinger (CDU) als Bundeskanzler und Willy Brandt (SPD) als Außenminister die Große Koalition gebildet. Während ihrer Regierung kam es zu ersten Annäherungen zwischen der Bundesrepublik und Ägypten. Die Sympathien der westdeutschen Regierung für Israel im Juni-Krieg 1967 führte zur Verschlechterung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Ägypten. Entscheidungen, die zur Wiederaufnahme der Beziehungen führten, wurden während der Großen Koalition nicht getroffen. Kurt Georg Kiesinger gelang es 1966, sich gegen seine Mitbewerber Schröder, Barzel und Gerstenmaier in der Fraktion als Kanzlerkandidat durchzusetzen654. Konflikte um die damalige Kandidatur für die Erhard Nachfolge hatten das Verhältnis zwischen ihnen belastet, und Rainer Barzel beschuldigte Kiesinger nach seiner Nominierung, daß er sich in das von ihm „gemachte Bett“ gelegt habe. Während der Kanzlerschaft Kiesingers arbeiteten die beiden jedoch eng zusammen655. Kiesinger war Außenpolitiker aus Leidenschaft. 1957 hatte er auf den Posten des Außenministers gehofft, Adenauer hatte sich jedoch für Heinrich v. Brentano entschieden656. Zu Beginn seiner Amtszeit wurde er wegen seiner Nazi- Vergangenheit, zunächst hauptsächlich im Ausland, kritisiert. Kiesinger war nominelles Mitglied der NSDAP und von 1940-1945 in der Rundfunkabteilung des Auswärtigen Amtes tätig gewesen657. Er soll sich aber gegen anti-jüdische Propaganda gestellt und sich für Juden und Gegner des Nazi-Regimes eingesetzt haben658. Seit Beginn seiner Amtszeit tauchten immer wieder Behauptungen auf, die ihn als “Erz-Nazi“ beschuldigten, sich jedoch nach eingehender Untersuchung als wenig plausibel herausstellten659. Erste Schritte in der Ostpolitik lassen sich auf die Regierungszeit Kiesingers zurückverfolgen. Seine Regierungserklärung beinhaltete einen Appell an Aus- 654 Vgl. -

Deutscher Bundestag 89
Deutscher Bundestag 89. Sitzung Bonn, den 17. Oktober 1963 Inhalt: Bekanntgabe der Bildung der Bundesregie rung 4185 A Eidesleistung der Bundesminister 4185 D, 4186 Glückwünsche zum Geburtstag des Abg Müller (Erbendorf) 4187 A Nächste Sitzung 4187 A Anlage 4189 - Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode — 89. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 17. Oktober 1963 4185 89. Sitzung Bonn, den 17. Oktober 1963 Stenographischer Bericht Dr. Erich Mende zum Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen Beginn: 15.01 Uhr Alois Ni e der alt zum Bundesminister für Angelegenheiten des Bundesrates und der Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die Sitzung Länder ist eröffnet. Meine Damen und Herren, ich rufe auf Punkt 1 Dr. Bruno Heck zum Bundesminister für der Tagesordnung: Familie und Jugend Bekanntgabe der Bildung der Bundesregie- Hans L e n z zum Bundesminister für wissen- rung. schaftliche Forschung Der Herr Bundespräsident hat mir das folgende Dr. Werner Dollinger zum Bundesschatz Schreiben übersandt: minister Gemäß Artikel 64 Absatz 1 des Grundgesetzes Walter Scheel zum Bundesminister für wirt- habe ich auf Vorschlag des Herrn Bundeskanz- schaftliche Zusammenarbeit lers zu Bundesministern ernannt: Dr. Elisabeth Schwarzhaupt zum Bundes- Dr. Gerhard Schröder zum Bundesminister minister für Gesundheitswesen des Auswärtigen Dr. Heinrich KT o n e zum Bundesminister für Hermann Höcherl zum Bundesminister des besondere Aufgaben. Innern Meine Damen und Herren, nach Art. 64 des Dr. Ewald Bucher zum Bundesminister der Grundgesetzes leisten auch die Bundesminister bei Justiz der Amtsübernahme den in Art. 56 des Grundgeset- Dr. Rolf Dahlgrün zum Bundesminister der zes vorgesehenen Eid. Ich rufe daher Punkt 2 der Finanzen Tagesordnung auf: Kurt Schmück er zum Bundesminister für Eidesleistung der Bundesminister. -

1 Introduction
Notes 1 Introduction 1. What belongs together will now grow together (JK). 2. The well-known statement from Brandt is often wrongly attributed to the speech he gave one day after the fall of the Berlin Wall at the West Berlin City Hall, Rathaus Schöneberg. This error is understandable since it was added later to the publicized version of the speech with the consent of Brandt himself (Rother, 2001, p. 43). By that time it was already a well known phrase since it featured prominently on a SPD poster with a picture of Brandt in front of the partying masses at the Berlin Wall. The original statement was made by Brandt during a radio interview on 10 November for SFP-Mittagecho where he stated: ‘Jetzt sind wir in einer Situation, in der wieder zusammenwächst, was zusammengehört’ (‘Now we are in a situation in which again will grow together what belongs together’). 3. The Treaty of Prague with Czechoslovakia, signed 11 December 1973, finalized the Eastern Treaties. 4. By doing this, I aim to contribute to both theory formation concerning inter- national politics and foreign policy and add to the historiography of the German question and reunification policy. Not only is it important to com- pare theoretical assumptions against empirical data, by making the theoretical assumptions that guide the historical research explicit, other scholars are enabled to better judge the quality of the research. In the words of King et al. (1994, p. 8): ‘If the method and logic of a researcher’s observations and infer- ences are left implicit, the scholarly community has no way of judging the validity of what was done.’ This does not mean that the historical research itself only serves theory formation. -

UID Jg. 25 1971 Nr. 9, Union in Deutschland
Thema der Woche Nur die Spitze HEUTE Seite des Eisbergs sichtbar Warten auf das nächste Gefecht 2 Die Krise bei den Sozialdemokraten ist noch lange Darüber kann sich niemand wun- Neuer Anfang dern, solange Wehner und Steffen nicht zu sehen 3 nicht ausgestanden. Linksaußen stehende Sozial- im Parteivorstand der SPD einen demokraten mucken öffentlich gegen den Beschluß klaren Kurs der Partei verhindern. Als sozialdemokratischer Spitzen- Verstärkter Widerstand ihrer Partei auf, nicht mit den Kommunisten zu kol- kandidat in Schleswig-Holstein ver- gegen die Ostpolitik 5 laborieren. Eine schwache Figur macht der Partei- säumt Steffen keine Gelegenheit, die Bundesrepublik mit dem Begriff Wahlprogramm vorsitzende Brandt. CDU-Generalsekretär Dr. Bruno .moderner Faschismus' zu diffamie- der CDU in ren und darunter alles zu verstehen, Rheinland-Pfalz 7 Heck nimmt in dem folgenden Artikel zu der SPD- was dem linksradikalen Konzept Krise Stellung. Steffens widerspricht. Mit einer gewissen Logik verstieg Die ersten Tage nach dem Mün- dern die Tatsache, daß sich in der der sozialdemokratische-Minister- Die jüngste Massen- chener Bezirksparteitag der SPD bayerischen Hauptstadt ein linksra- präsidenten-Kandidat sich zu einer demonstration der Bauern haben gezeigt, daß die ideologische dikaler Vorstand etablieren konnte. Behauptung, die alles in den Schat- in Bonn hat ihre Wirkung Das knappe Abstimmungsergebnis Krise in der die Bundesregierung ten stellt, was wir bisher als poli- tragenden Partei erst beginnt. läßt keinen Zweifel daran, daß es auf die Bundesregierung tische Diskussionsbeiträge von SPD- sich in der Münchener SPD keines- nicht verfehlt. In Bonn Politikern zu hören bekamen. In Die Bonner SPD-Führung läßt in wegs nur um .kleine Kadergruppen' erinnert man sich der einem Interview vertritt er allen ihrem Pressedienst verlautbaren, sie handelt, wie der SPD-Pressedienst Vorschläge der CDU/CSU- Ernstes die Ansicht, zwischen der sei mit dem Ergebnis der Münche- verniedlichend bemerkt.