VI Analyse Der Wiederaufnahme Der Beziehungen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

30Years 1953-1983
30Years 1953-1983 Group of the European People's Party (Christian -Demoeratie Group) 30Years 1953-1983 Group of the European People's Party (Christian -Demoeratie Group) Foreword . 3 Constitution declaration of the Christian-Democratic Group (1953 and 1958) . 4 The beginnings ............ ·~:.................................................. 9 From the Common Assembly to the European Parliament ........................... 12 The Community takes shape; consolidation within, recognition without . 15 A new impetus: consolidation, expansion, political cooperation ........................................................... 19 On the road to European Union .................................................. 23 On the threshold of direct elections and of a second enlargement .................................................... 26 The elected Parliament - Symbol of the sovereignty of the European people .......... 31 List of members of the Christian-Democratic Group ................................ 49 2 Foreword On 23 June 1953 the Christian-Democratic Political Group officially came into being within the then Common Assembly of the European Coal and Steel Community. The Christian Democrats in the original six Community countries thus expressed their conscious and firm resolve to rise above a blinkered vision of egoistically determined national interests and forge a common, supranational consciousness in the service of all our peoples. From that moment our Group, whose tMrtieth anniversary we are now celebrating together with thirty years of political -
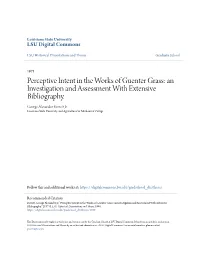
Perceptive Intent in the Works of Guenter Grass: an Investigation and Assessment with Extensive Bibliography
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1971 Perceptive Intent in the Works of Guenter Grass: an Investigation and Assessment With Extensive Bibliography. George Alexander Everett rJ Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses Recommended Citation Everett, George Alexander Jr, "Perceptive Intent in the Works of Guenter Grass: an Investigation and Assessment With Extensive Bibliography." (1971). LSU Historical Dissertations and Theses. 1980. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/1980 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Historical Dissertations and Theses by an authorized administrator of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. 71-29,361 EVERETT, Jr., George Alexander, 1942- PRECEPTIVE INTENT IN THE WORKS OF GUNTER GRASS: AN INVESTIGATION AND ASSESSMENT WITH EXTENSIVE BIBLIOGRAPHY. The Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, Ph.D., 1971 Language and Literature, modern University Microfilms, A XEROX Company, Ann Arbor, Michigan THIS DISSERTATION HAS BEEN MICROFILMED EXACTLY AS RECEIVED Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. PRECEPTIVE INTENT IN THE WORKS OF GUNTER GRASS; AN INVESTIGATION AND ASSESSMENT WITH EXTENSIVE BIBIIOGRAPHY A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of Foreign Languages by George Alexander Everett, Jr. B.A., University of Mississippi, 1964 M.A., Louisiana State University, 1966 May, 1971 Reproduced with permission of the copyright owner. -

Revisiting Zero Hour 1945
REVISITING ZERO-HOUR 1945 THE EMERGENCE OF POSTWAR GERMAN CULTURE edited by STEPHEN BROCKMANN FRANK TROMMLER VOLUME 1 American Institute for Contemporary German Studies The Johns Hopkins University REVISITING ZERO-HOUR 1945 THE EMERGENCE OF POSTWAR GERMAN CULTURE edited by STEPHEN BROCKMANN FRANK TROMMLER HUMANITIES PROGRAM REPORT VOLUME 1 The views expressed in this publication are those of the author(s) alone. They do not necessarily reflect the views of the American Institute for Contemporary German Studies. ©1996 by the American Institute for Contemporary German Studies ISBN 0-941441-15-1 This Humanities Program Volume is made possible by the Harry & Helen Gray Humanities Program. Additional copies are available for $5.00 to cover postage and handling from the American Institute for Contemporary German Studies, Suite 420, 1400 16th Street, N.W., Washington, D.C. 20036-2217. Telephone 202/332-9312, Fax 202/265- 9531, E-mail: [email protected] Web: http://www.aicgs.org ii F O R E W O R D Since its inception, AICGS has incorporated the study of German literature and culture as a part of its mandate to help provide a comprehensive understanding of contemporary Germany. The nature of Germany’s past and present requires nothing less than an interdisciplinary approach to the analysis of German society and culture. Within its research and public affairs programs, the analysis of Germany’s intellectual and cultural traditions and debates has always been central to the Institute’s work. At the time the Berlin Wall was about to fall, the Institute was awarded a major grant from the National Endowment for the Humanities to help create an endowment for its humanities programs. -

Download (515Kb)
European Community No. 26/1984 July 10, 1984 Contact: Ella Krucoff (202) 862-9540 THE EUROPEAN PARLIAMENT: 1984 ELECTION RESULTS :The newly elected European Parliament - the second to be chosen directly by European voters -- began its five-year term last month with an inaugural session in Strasbourg~ France. The Parliament elected Pierre Pflimlin, a French Christian Democrat, as its new president. Pflimlin, a parliamentarian since 1979, is a former Prime Minister of France and ex-mayor of Strasbourg. Be succeeds Pieter Dankert, a Dutch Socialist, who came in second in the presidential vote this time around. The new assembly quickly exercised one of its major powers -- final say over the European Community budget -- by blocking payment of a L983 budget rebate to the United Kingdom. The rebate had been approved by Community leaders as part of an overall plan to resolve the E.C.'s financial problems. The Parliament froze the rebate after the U.K. opposed a plan for covering a 1984 budget shortfall during a July Council of Ministers meeting. The issue will be discussed again in September by E.C. institutions. Garret FitzGerald, Prime Minister of Ireland, outlined for the Parliament the goals of Ireland's six-month presidency of the E.C. Council. Be urged the representatives to continue working for a more unified Europe in which "free movement of people and goods" is a reality, and he called for more "intensified common action" to fight unemployment. Be said European politicians must work to bolster the public's faith in the E.C., noting that budget problems and inter-governmental "wrangles" have overshadolted the Community's benefits. -

University Microfilms
INFORMATION TO USERS This dissertation was produced from a microfilm copy of the original document. While the most advanced technological means to photograph and reproduce this document have been used, the quality is heavily dependent upon the quality of the original submitted. The following explanation of techniques is provided to help you understand markings or patterns which may appear on this reproduction. 1. The sign or "target" for pages apparently lacking from the document photographed is "Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting thru an image and duplicating' adjacent pages to insure you complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a large round black mark, it is an indication that the photographer suspected that the copy may have moved during exposure and thus cause a blurred image. You will find a good image of the page in the adjacent frame. 3. When a map, drawing or chart, etc., was part of the material being photographed the photographer followed a definite method in "sectioning" the material. It is customary to begin photoing at the upper left hand corner of a large sheet and to continue photoing from left to right in equal sections with a small overlap. If necessary, sectioning is continued again — beginning below the first row and continuing on until complete. 4. The majority of users indicate that the textual content is of greatest value, however, a somewhat higher quality reproduction could be made from "photographs" if essential to the understanding o f the dissertation. -

Deutscher Bundestag 89
Deutscher Bundestag 89. Sitzung Bonn, den 17. Oktober 1963 Inhalt: Bekanntgabe der Bildung der Bundesregie rung 4185 A Eidesleistung der Bundesminister 4185 D, 4186 Glückwünsche zum Geburtstag des Abg Müller (Erbendorf) 4187 A Nächste Sitzung 4187 A Anlage 4189 - Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode — 89. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 17. Oktober 1963 4185 89. Sitzung Bonn, den 17. Oktober 1963 Stenographischer Bericht Dr. Erich Mende zum Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen Beginn: 15.01 Uhr Alois Ni e der alt zum Bundesminister für Angelegenheiten des Bundesrates und der Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die Sitzung Länder ist eröffnet. Meine Damen und Herren, ich rufe auf Punkt 1 Dr. Bruno Heck zum Bundesminister für der Tagesordnung: Familie und Jugend Bekanntgabe der Bildung der Bundesregie- Hans L e n z zum Bundesminister für wissen- rung. schaftliche Forschung Der Herr Bundespräsident hat mir das folgende Dr. Werner Dollinger zum Bundesschatz Schreiben übersandt: minister Gemäß Artikel 64 Absatz 1 des Grundgesetzes Walter Scheel zum Bundesminister für wirt- habe ich auf Vorschlag des Herrn Bundeskanz- schaftliche Zusammenarbeit lers zu Bundesministern ernannt: Dr. Elisabeth Schwarzhaupt zum Bundes- Dr. Gerhard Schröder zum Bundesminister minister für Gesundheitswesen des Auswärtigen Dr. Heinrich KT o n e zum Bundesminister für Hermann Höcherl zum Bundesminister des besondere Aufgaben. Innern Meine Damen und Herren, nach Art. 64 des Dr. Ewald Bucher zum Bundesminister der Grundgesetzes leisten auch die Bundesminister bei Justiz der Amtsübernahme den in Art. 56 des Grundgeset- Dr. Rolf Dahlgrün zum Bundesminister der zes vorgesehenen Eid. Ich rufe daher Punkt 2 der Finanzen Tagesordnung auf: Kurt Schmück er zum Bundesminister für Eidesleistung der Bundesminister. -

1 Introduction
Notes 1 Introduction 1. What belongs together will now grow together (JK). 2. The well-known statement from Brandt is often wrongly attributed to the speech he gave one day after the fall of the Berlin Wall at the West Berlin City Hall, Rathaus Schöneberg. This error is understandable since it was added later to the publicized version of the speech with the consent of Brandt himself (Rother, 2001, p. 43). By that time it was already a well known phrase since it featured prominently on a SPD poster with a picture of Brandt in front of the partying masses at the Berlin Wall. The original statement was made by Brandt during a radio interview on 10 November for SFP-Mittagecho where he stated: ‘Jetzt sind wir in einer Situation, in der wieder zusammenwächst, was zusammengehört’ (‘Now we are in a situation in which again will grow together what belongs together’). 3. The Treaty of Prague with Czechoslovakia, signed 11 December 1973, finalized the Eastern Treaties. 4. By doing this, I aim to contribute to both theory formation concerning inter- national politics and foreign policy and add to the historiography of the German question and reunification policy. Not only is it important to com- pare theoretical assumptions against empirical data, by making the theoretical assumptions that guide the historical research explicit, other scholars are enabled to better judge the quality of the research. In the words of King et al. (1994, p. 8): ‘If the method and logic of a researcher’s observations and infer- ences are left implicit, the scholarly community has no way of judging the validity of what was done.’ This does not mean that the historical research itself only serves theory formation. -

Brandts Magere Ostpolitik Nach Oreanda
Heute auf 6eite3: J. v. Wletkutz - Staut und Gesellschaft nach ht %atasttophe ^£>as tftprtußmWflit UNABHÄNGIGE WOCHENZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND Jahrgang 25 — Folge 28 2 Hamburg 13, Parkallee 86/13. Juli 1974 C 5524 C Von Yalta Brandts magere Ostpolitik nach Oreanda Die römischen Gespräche der SPD und ihre Folgen - Bonn von den Sowjets in die Falle gelockt H. W. — Die Krim ist für die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Der Moderator des „ZDF-Magazins" Sowjetunion schon einmal von Bedeutung Gerhard Löwenthal, hat dem Bundestags• gewesen. Denn genau in Yalta, auf der Krim, ausschuß zur Untersuchung der Guillaume- war es, wo Präsident Roosevelt mit Josef Stalin gegen Ende des Zweiten Weltkrieges Affäre Ablichtungen oder Abschriften von zusammentraf und wo letztlich die Preis• Dokumenten des Bundesnachrichtendienstes gabe Osteuropas an die Sowjetunion konze• zur Frage der außenpolitischen Aktivität diert wurde. Fast 30 Jahre später ist wieder der SPD in jener Zeit ausgehändigt, als Bun• ein Präsident der Vereinigten Staaten auf deskanzler Kiesinger die Bundesregierung die Krim geflogen, zusammen mit Leonid leitete und Willy Brandt Außenminister war. Breschnew, der dort, in Oreanda, wie letzt• Es handelte sich um Unterlagen, welche der hin für Willy Brandt und nun für Richard früherer „Kanzleramtsminister" Ehmke in Nixon den Gastgeber spielte. Dieses Orean• da aber ist praktisch nur eine Vorstadt von der Originalfassung vernichten ließ. Yalta und nicht weit von jener Zarenvilla Nun wird sich zwar der Guillaume-Aus- von Livadia entfernt, wo eben Josef Stalin schuß nicht mit dem Material befassen, zu• der entscheidende Coup der Einflußnahme mal die SPD-Vertreter mit begreiflichem auf Europa gelang. -

Zürcher Beiträge Zur Sicherheitspolitik Und Konfliktforschung Nr
Zürcher Beiträge zur Sicherheitspolitik und Konfliktforschung Nr. 56 FSK auf dem Internet Andreas Wenger and Jeremi Suri Die „Zürcher Beiträge zur Sicherheitspolitik und Konfliktforschung“ sowie die anderen Publikationen der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse sind ebenfalls auf dem World Wide Web im Volltext verfügbar: www.fsk.ethz.ch The Nuclear Revolution, Hrsg.: Kurt R. Spillmann und Andreas Wenger Forschungsstelle für Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse der ETH Zürich Social Dissent, and the © 2000 Forschungsstelle für Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse, ETH Zentrum, 8092 Zürich Evolution of Détente e-mail: [email protected] Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und fotomechanische oder elektronische Wieder- gabe, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Forschungsstelle. Patterns of Interaction, 1957-74 Die in den „Zürcher Beiträgen zur Sicherheitspolitik und Konfliktforschung“ wiedergegebenen Auffassungen stellen ausschliesslich die Ansichten der betreffenden Autoren dar. ISBN 3-905641-69-0 Hrsg.: Kurt R. Spillmann und Andreas Wenger ISSN 1423-3894 Forschungsstelle für Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse der ETH Zürich PREFACE Détente in Europe and its evolution in the 1960s and 1970s must be understood as a highly complex phenomenon, not unlike the establishment of the Cold War system in the 1940s and 1950s. As new archival material on the period becomes available, we will have to re-think how the “old” Cold War history described the origins and eventual failure of détente in this period of a rapidly changing international system. In the murky waters of the 1960s, the hotspots of the Cold War shifted from the nuclear-fortified post-war boundaries of Europe to peripheral areas and domestic spaces. While power became increasingly multi- dimensional, the management of alliance disputes under conditions of hege- monic decline became an overriding concern. -

L[Ffiffi&Ffiy
Wenof Eurore Brusselr, 15 Xoverbcr f983/15 Jaurryr 1984, n'33 (bi-nonthly) L[ffiffi&ffiY EUROP$AN CO|!;I}1UiiIil E,mP-{ LEffiffiffiE IJ|FORMATI0N SIRYiCI i trYA$HINGTON, D. O. This bulle tin is published by the OOiIMISSION OF THE EUROPEAN @MMUIITTIES Directorate-General I ntormation € Informalion for Women's organisations and press Rue de la Loi 200 8-1049 - Erussels - Te|,23511 11 Vomen of Europe tlr,. 3? - 15 t{ovember l9t3l15 January l9t4 - p. 2 IN THXS XSSUE The changing European CommunitY 3 Parental leave 4 Eurobarometer 6 Womenfs unemPloYment 8 The Equal Opportunities Committee l0 Women of Spain ll Local and regional elected representatives 14 European Parliament October 1983 session T7 November 1983 session t9 December 1983 session 2T Parliamentary Committee of Inquiry 24 European Court of Justice 25 Facts, Institutions and Laws 26 June r84: European Elections 43 Militant activities 44 Reseach, Meetings and Books 62 Our correspondents in the Community Belgium Nanette Nannan, 33 Rue E. Bouillot, Boite 9, 1060 Brussels Denmark Danske Kvinders Nationalraad, N. Hemmingsensgade 8, ll53' CoPenhagen France Jeanne Chaton, 43 Avenue Ernest Reyer, 75014 Paris Greece Effi Kalliga-Kanonidou, l0 Neofytou Douka St, 106 74 Athens Germany Christa Randzio-Plath, Hadermanns Yleg 2), 2 Hamburg 6l Ireland Janet Martin, 2 Clarement Close, Glasvenin, Dublin ll Italy Beatrice Rangoni Macchiavelli, Piazza di Spagna 51' 00187 Rome Luxembourg Alix Wagnerr T rue Henri Frommes, 1545 Luxembourg Netherlands Marjolijn Uitzinger, Fivelingo 207, Tnetermeer United Kingdom Pegty Crane, 12 Grove Park Road, Chiswick, London V4 European Lidya Gazzor lT Avenue de Tourville, 75007 Paris Parliament Editor: Fausta Deslpnmes krlormation for womenrs associations and press 200 Rue de la Loi' 1049 Brussels Editorial work on this issue of "Women of Europe" was Completed on 19 December 1983. -

Graue Eminenzen Der Macht In
Kay Müller • Franz Walter Graue Eminenzen der Macht Küchenkabinette in der deutschen Kanzlerdemokratie. Von Adenauer bis Schröder in VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhalt I. Einleitung 9 II. Berater beim „Alten": Die Herrenrunde im Palais Schaumburg 13 Der Architekt der Westpolitik: Herbert Blankenborn 13 Sekretär und Sphinx: Hans Globke 17 Der Troubleshooter: Otto Lenz 23 Komödiant und Pressechef: Felix von Eckardt 27 Der Mann für die Verträge: Walter Hallstein 31 Papa und Alleskleber: Heinrich Krone 34 Nähe und Neurosen der Macht 38 Deutsch-amerikanisch-jüdischer Brieffreund: Dannie Heinemann 41 Finanzmagier und Duzfreund: Robert Pferdmenges 43 Am Ende blieb nur Globke: Der Zerfall des Küchenkabinetts 46 III. Durch die Brigade „verberatet"? Ludwig Erhard 50 Frühe Formierung: In Erhards Kern-Team ergänzen sich die Fähigkeiten der Mitarbeiter 51 Abschottung und Krisen: Das Küchenkabinett zerfasert 57 Küchenkabinett ohne Koch? 61 IV. Die Küche im Kabinett: Kurt Georg Kiesinger 68 Philosophieren statt regieren: Die Lakaien arbeiten zu 69 Neue Konstellation erfordert neue Konzepte im Küchenkabinett 73 Der Kreßbronner Kreis als institutionalisiertes Küchenkabinett? 77 Kompetenzgerangel und das Ende der Großen Koalition 79 6 Inhalt V. Antreiber und Hofschranzen: Brandts Clique 82 Triumph und Absturz 82 Berliner Clique 83 Intellektueller, Diplomat und Kommunikator: Egon Bahr 85 Die „rote Lady": Katharina Focke 89 Hoppla-jetzt-komm-ich: Horst Ehmke 91 Neuformierung wider Willen 95 Schnoddrig, lässig, unabhängig: Conrad Ahlers 97 Der Verlust der Prätorianergarde 100 Der Kanzler und die Intellektuellen 103 Neid, Eifersucht und Depressionen 111 Diesseits der Küche: Der Fraktionsvorsitzende Wehner 115 VI. Kleeblätter bringen Glück und können effizient sein: Helmut Schmidt 117 So effizient wie Hans Globke: Manfred Schüler 119 Regierungssprecher und Berater des Kanzlers: Klaus Bölling 119 Abgeschüttet gegen externe Berater: Schmidts Blickwinkel verengt sich 124 Das Kanzleramt-Team zerfällt von innen 128 Koordination und Krisenmanagement? Fehlanzeige 130 VH. -

Brandt Plant Schnelle Regierungsbildung Nach Dem
,t,lÜJV-Dirwt.uw" •*" TAGES SP1EGE Berichte, Tabellen. Analysen UNABHÄNGIGE BERLINER MORGENZEITUNG i 188; B 19 (Charlb.), Kaiserdamm 7; B 20 Verlag Der Tagesspiegel GmbH, 1 Berlin 30, Postfadi, Potsdamer StraBe 87 / Telefon-Sammelnmn- w Bundeslogswahl tet), Wuhelmsraher D. 247; B 28 (Herms- mer 26 93-1 / Fernschreiber 01 83 773 / Telegramme: Tagesspiegel Berlin / Bankkonten: Berliner Disconto Ulfenstr. 25i B31 (Wilmd.), Uhlandstr. 137; Bank, Berliner Bank, Bank für Handel und Industrie, Berliner Commenbank, Sparkasse der Stadt Berlin Seite 2-5 1. 2; B41 (Friedenau), Rheins«. 02; B 41 West, Postscheck-Konto: Berlin West 105 / Bonner Redaktion: 53 Bonn, Pressehaas 1, Telefon 22 78 45 "fempelhofer D. 2i B 44 (Neukölln), Karl- und 22 14 14 / Abonnementspteis bei freier Zustellung dunih eigene Boten 7,20 DM. durdi die Post 8,30 DM ..-»,u<=j Baseler Str. 12i B 46 (Lmkwitz). Leonorenstr. 711 B 47 (Britz), Parchimer mtl. (einschl. 5,5 •/• MwSt) / Erscheinungsweise: tgl. anSer nach Sona- u. Feiertagen / Keine Ersatzanspruchs ISIIS (Reinickendorf), Scharnwebeistr. 491 B 61 (Kreuzbg.), Zossener Str. 20) B 65, Müllerstr. 122 b bei Störungen d. höhere Gewalt / Aszeigenprelsliste Nr. 19 / Erfüllungsort u. Gerichtsstand Berlis-Tempelhof Nr. 8267 / 28. JAHRGANG BERLIN, DIENSTAG, 21. NOVEMBER 1972 30 Pf A 6622 A Unsere Meinung: Brandt plant schnelle Regierungsbildung Historischer Einschnitt J.B. Der 19. November 1972 signalisiert ei- nen historischen Einschnitt in der Geschichte der Bundesrepublik. Es handelt sich nicht nur nach dem klaren Wahlsieg der Koalition um einen Wahlsieg, den eine Partei oder eine Koalition errungen hat; wir haben es viel- mehr mit einer Umstrukturierung der Parteien- SPD wurde zum erstenmal stärkste Partei in der Bundesrepublik - Der Opposition Gespräch Landschaft und damit der innenpolitischen Ver- hältnisse in der Bundesrepublik zu tun.