Historischer Atlas 4, 22 Von Baden
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Flüchtlinge Und Asylbewerberinnen/ Asylbewerber Im Alb-Donau-Kreis
Flüchtlinge und Asylbewerberinnen/ Asylbewerber im Alb-Donau-Kreis Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner Landratsamt Alb-Donau-Kreis – Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner Stand: 1. November 2020 Inhaltsverzeichnis Fachdienst Flüchtlinge, Integration, staatliche Leistungen ............................................. 3 A. Integrationsmanagement ........................................................................................... 3 B. Leistungen für Asylbewerber/innen ........................................................................... 7 C. Vorläufige Unterbringung .......................................................................................... 8 D. Betreuung vor Ort ...................................................................................................... 8 Ausländerbehörde – Landratsamt Alb-Donau-Kreis....................................................... 9 Ausländerbehörde – Große Kreisstadt Ehingen ............................................................ 9 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge .......................................................................... 9 Jobcenter Alb-Donau ..................................................................................................... 9 Hilfestellung – An wen wende ich mich? ...................................................................... 11 2 Fachdienst Flüchtlinge, Integration, staatliche Leistungen Schillerstraße 30, 89077 Ulm Tel.: 0731/185 - Durchwahl Funktion Name Durchwahl Fachdienstleiter Sontheimer, Emanuel 4388 Stellvertretende -
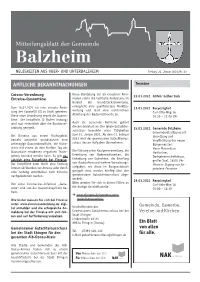
Mitteilungsblatt KW 03/21
Mitteilungsblatt der Gemeinde Balzheim NEUIGKEITEN AUS OBER- UND UNTERBALZHEIM Freitag, 22. Januar 2021/Nr. 03 AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN Termine Diese Bündelung der 55 einzelnen Kom- Corona-Verordnung 22.01.2021 Abfuhr Gelber Sack Einreise-Quarantäne munen stärkt die fachliche Kompetenz im Bereich der Grundstücksbewertung, ermöglicht eine qualifiziertere Marktbe- Zum 18.01.2021 ist eine erneute Ände- 23.01.2021 Recyclinghof wertung und lässt eine rechtssichere rung der CoronaVO EQ in Kraft getreten. Carl-Otto-Weg 16 Ableitung der Bodenrichtwerte zu. Diese neue Verordnung regelt die Quaran- 10.30 – 12.00 Uhr täne. Die Testpflicht (2 Stufen Testung) wird nun einheitlich über die Bundesver- Auch die Gemeinde Balzheim gehört diesem Gremium an. Der lokale Gutachter- ordnung geregelt. 25.01.2021 Gemeinde Balzheim ausschuss beendete seine Tätigkeiten Gemeinderatssitzung mit zum 31. Januar 2021. Ab dem 01. Februar Bei Einreise aus einem Risikogebiet Einsetzung und 2021 wird der gemeinsame Gutachteraus- besteht weiterhin grundsätzlich eine Verpflichtung des neuen schuss dessen Aufgaben übernehmen. zehntägige Quarantänepflicht, die frühe- Bürgermeisters stens mit einem ab dem fünften Tag der Herrn Maximilian Die Führung einer Kaufpreissammlung, die Quarantäne erhobenen negativen Tester- Hartleitner, Ermittlung von Bodenrichtwerten, die gebnis beendet werden kann. Es gilt zu- Dorfgemeinschaftshaus, Erstattung von Gutachten, die Erteilung sätzlich eine Testpflicht bei Einreise. großer Saal, 18:00 Uhr von Auskünften und weitere Verwaltungs- Der Testpflicht kann durch eine Testung Hinweis: Zugang nur für aufgaben, wie diese im Baugesetzbuch binnen 48 Stunden vor Anreise oder durch geladene Personen eine Testung unmittelbar nach Einreise geregelt sind, werden künftig über den nachgekommen werden. gemeinsamen Gutachterausschuss abge- wickelt. 29.01.2021 Recyclinghof Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an Von einer Coronavirus-Infektion „Gene- Carl-Otto-Weg 16 die dortige Geschäftsstelle: sene“ sind von der Quarantänepflicht be- 15:00 – 16:30 freit. -

Karte Der Erdbebenzonen Und Geologischen Untergrundklassen
Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen 350 000 KARTE DER ERDBEBENZONEN UND GEOLOGISCHEN UNTERGRUNDKLASSEN FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG 1: für Baden-Württemberg 10° 1 : 350 000 9° BAYERN 8° HESSEN RHEINLAND- PFALZ WÜRZBUR G Die Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen für Baden- Mainz- Groß- Main-Spessart g Wertheim n Württemberg bezieht sich auf DIN 4149:2005-04 "Bauten in deutschen Darmstadt- li Gerau m Bingen m Main Kitzingen – Lastannahmen, Bemessung und Ausführung üblicher Freudenberg Erdbebengebieten Mü Dieburg Ta Hochbauten", herausgegeben vom DIN Deutsches Institut für Normung e.V.; ub Kitzingen EIN er Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin. RH Alzey-Worms Miltenberg itz Die Erdbebenzonen beruhen auf der Berechnung der Erdbebengefährdung auf Weschn Odenwaldkreis Main dem Niveau einer Nicht-Überschreitenswahrscheinlichkeit von 90 % innerhalb Külsheim Werbach Großrinderfeld Erbach Würzburg von 50 Jahren für nachfolgend angegebene Intensitätswerte (EMS-Skala): Heppenheim Mud Pfrimm Bergst(Bergstraraßeß) e Miltenberg Gebiet außerhalb von Erdbebenzonen Donners- WORMS Tauberbischofsheim Königheim Grünsfeld Wittighausen Gebiet sehr geringer seismischer Gefährdung, in dem gemäß Laudenbach Hardheim des zugrunde gelegten Gefährdungsniveaus rechnerisch die bergkreis Höpfingen Hemsbach Main- Intensität 6 nicht erreicht wird Walldürn zu Golla Bad ch Aisch Lauda- Mergentheim Erdbebenzone 0 Weinheim Königshofen Neustadt Gebiet, in dem gemäß des zugrunde gelegten Gefährdungsniveaus Tauber-Kreis Mudau rechnerisch die Intensitäten 6 bis < 6,5 zu erwarten sind FRANKENTHAL Buchen (Odenwald) (Pfalz) Heddes-S a. d. Aisch- Erdbebenzone 1 heim Ahorn RHirschberg zu Igersheim Gebiet, in dem gemäß des zugrunde gelegten Gefährdungsniveaus an der Bergstraße Eberbach Bad MANNHEIM Heiligkreuz- S c Ilves- steinach heff Boxberg Mergentheim rechnerisch die Intensitäten 6,5 bis < 7 zu erwarten sind Ladenburg lenz heim Schriesheim Heddesbach Weikersheim Bad Windsheim LUDWIGSHAFEN Eberbach Creglingen Wilhelmsfeld Laxb Rosenberg Erdbebenzone 2 a. -

SPIELBERICHTE D-Junioren
KW 16 | 2018 Wochennachrichten TSV Blaustein Fußballjugend 16.04. – 22.04.2018 SPIELBERICHTE D-Junioren SGM Vöhringen II - TSV Blaustein I 2:6 A- Junio ren Dem deutlichen 5:0 aus der Vorwoche folgte dieses Mal FC Burlafingen - TSV Blaustein 3:3 ein ebenso deutliches wie verdientes 6:2 in Vöhringen. Ein echtes Spitzenspiel war die Partie Tabellenplatz 3 Die Mannschaft war ihrem Gegner mehr als überlegen – (FC Burlafingen) und Tabellenplatz 2 (unser Team). zeigte ein tolles Spiel und tolle Tore. Ein verdienter Beide Mannschaften bemühten sich sowohl im Erfolg. spielerischen und kämpferischen Bereich zu überzeugen. Die Gastgeber erwischten den etwas FC Burlafingen II - TSV Blaustein III 9:1 besseren Start und führten zur Pause mit 2:1 Toren. Unsere E-Junioren gehen in der Rückrunde als D3 an Doch unsere Mannschaft gab nie auf und verdiente sich den Start. Sie sollen sich bereits ein halbes Jahr früher auf alle Fälle den einen Punkt mit dem 3:3 an das größere Spielfeld gewöhnen. Der große Unentschieden. Altersunterschied – zum Teil 3 Jahre – die Nervosität und das deutlich größere Spielfeld machten das erste B-Junioren Spiel zu einem großen Problem. Die junge Mannschaft gab ihr Bestes, doch am Ende gab es im ersten Spiel TSV Blaustein I - TSV Neu-Ulm II 1:6 eine deutliche Niederl age. Kopf hoch, Jungs, die Erfolge Erneut einen Sechser-Pack handelte sich die B1 gegen stellen sich mit Sicherheit noch ein. den TSV Neu-Ulm II ein. Bis zur Pause konnte man das Spiel noch einigermaßen offen gestalten und lag nur mit 0:1 zurück. Nach der Pause konnte man sogar den Ausgleich erzielen. -

Innen Integration Im Alb-Donau-Kreis
Kontaktadressen der Integrations- und Flüchtlingsbeauftragten bzw. kommunalen Ansprechpartner/-innen Integration im Alb-Donau-Kreis Stadt/Gemeinde Gebiet Adresse Ansprechpartner Telefon E-Mail Allmendingen, Allmendingen Hauptstr. 16, 89604 Allmendingen Frau Melanie Böck 07391/701518 [email protected] Altheim Amstetten Amstetten Lonetalstraße 19, 73340 Amstetten Frau Gisela Walter 07331/300641 [email protected] Berghülen Berghülen Hauptstraße 2, 89180 Berghülen Herr Bernd Nüssle 07344/968610 [email protected] Frau Hanna Schneider [email protected] Blaubeuren 07344/966964 Blaubeuren Karlstraße 2, 89143 Blaubeuren Herr Nadim Awad [email protected] Blaustein, Dornstadt, Herr Johannes Kasper [email protected] Blaustein Marktplatz 2, 89134 Blaustein 07304/802227 Beimerstetten, Herr Mitja Weilemann [email protected] Westerstetten Dietenheim, Dietenheim Illerrieden, Königstraße 63, 89165 Dietenheim Frau Dilara Bodammer 07347/969638 [email protected] Balzheim Frau Dr. Ursula von 07391/5034611 Ehingen Ehingen Marktplatz 1, 89584 Ehingen [email protected] Helldorff 0151/20350787 Erbach Erbach Erlenbachstraße 50, 89155 Erbach Frau Natallia Reinke 07305/967632 [email protected] Herr Bürgermeister Griesingen Griesingen Alte Landstraße 51, 89608 Griesingen [email protected] Oliver Klumpp 07391/8748 Frau Silke Kilian 07346/960986 [email protected] Illerkirchberg Illerkirchberg Hauptstraße 49,89171 Illerkirchberg Vertretung: Herr Eger 07346/960920 [email protected] Hüttisheim, -

Öffentliche Bekanntmachung Der Stadt Ulm
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ulm Bekanntmachung der Kreiswahlleiter der Wahlkreise Nr. 64 Ulm und Nr. 65 Ehingen über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl zum 17. Landtag von Baden-Württemberg am 14. März 2021 Am 14. März 2021 findet die Wahl des 17. Landtags von Baden-Württemberg statt. Die Wahl ist nach den Vorschriften des Landtagswahlgesetzes (LWG) in der Fassung vom 15. April 2005 (GBl. S. 384), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Oktober 2019 (GBl. S. 425) geändert worden ist, und der Landeswahlordnung (LWO) in der Fassung vom 2. Juni 2005 (GBl. S. 513), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. Mai 2015 (GBl. S. 320, 323) geändert worden ist, vorzubereiten und durchzuführen. Das Innenministerium hat mit Bekanntmachung vom 27. Januar 2020, veröffentlicht im Staatsanzeiger vom 31. Januar 2020, für den Wahlkreis Nr. 64 Ulm Herrn Oberbürgermeister Gunter Czisch zum Kreiswahlleiter und Frau Stadtamtsrätin Yasemin Yilan zur stellvertretenden Kreiswahlleiterin und für den Wahlkreis Nr. 65 Ehingen Herrn Landrat Heiner Scheffold zum Kreiswahlleiter und Herrn Kreisoberverwaltungsrat Stefan Freibauer zum stellvertretenden Kreiswahlleiter berufen. 1. Öffentliche Aufforderung 1.1 Auf Grund von § 22 Abs. 2 Satz 1 LWO ergeht hiermit die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die am 14. März 2021 stattfindende Wahl zum 17. Landtag von Baden-Württemberg. Die Wahlvorschläge für den Wahlkreis Nr. 64 Ulm sind bis spätestens Donnerstag, 14. Januar 2021, 18.00 Uhr beim Kreiswahlleiter Herrn Oberbürgermeister Gunter Czisch (Wahlamt der Stadt Ulm, Olgastraße 66, 89073 Ulm) und für den Wahlkreis Nr. 65 Ehingen ebenfalls bis spätestens Donnerstag, 14. Januar 2021, 18.00 Uhr beim Kreiswahlleiter Herrn Landrat Heiner Scheffold (Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Schillerstraße 30, 89077 Ulm) schriftlich einzureichen. -

Lehner Agrar in Westerstetten Baut Für Fünf Millionen Euro
27 ALB-DONAU-KREIS Mittwoch, 6. Dezember 2017 Infos zu Neenstetter Projekten Verwaltung Die Gemeinde hat erstmals seit sechs Kontakt Jahren wieder eine E-Mail: [email protected] Bürgerversammlung Telefon: (0731) 156-234 veranstaltet. Neenstetten. Es waren Ergebnis- se aus acht Gemeinderatssitzun- Kokain gen, die Bürgermeister Martin Wiedenmann jüngst in der Bür- in der Region gerversammlung im Schützen- haus in Neenstetten vorgestellt verkauft? hat. Es war die erste Versamm- lung dieser Art seit dem Jahr 2011. Künftig sollen solche Informati- Landgericht Der Prozess onsveranstaltungen für die Bür- gegen einen 35-Jährigen ger wieder häufiger stattfinden. stockt. Der Abnehmer der Ein Thema war die Erweite- Drogen hält sich in Italien rung des Gewerbegebiets nach Süden hin, die der Gemeinderat auf, er will nicht aussagen. vor knapp zwei Monaten be- schlossen hat. Auf dem gut einem Memmingen. Der wichtigste Zeu- Hektar großen Areal, das in un- ge lebt jetzt in Italien, der Ange- mittelbarem Anschluss an den klagte will seine Aussage noch- Neubau des Feuerwehrhauses am mal überdenken: Der Prozess ge- Schrankenweg entsteht, sollen gen einen mutmaßlichen Drogen- sich dann zwei Firmen ansiedeln, händler vor dem Landgericht Im Gewerbegebiet „Häuslesäcker“ am südlichen Ortsrand von Westerstetten hat sich die Firma Lehner 15 000 Quadratmeter Erweiterungs- informierte der Bürgermeister. Memmingen kommt nicht so rich- äche gesichert. Foto: Volkmar Könneke Das Großprojekt Feuerwehr- tig voran. Dem 35-Jährigen aus haus mit angrenzendem Neubau dem Alb-Donau-Kreis wird vor- des Bauhofes ist ebenfalls in die- geworfen, über zwei Jahre hinweg sem Jahr beschlossen worden. mindestens zwei Mal im Monat Mehr als 1,6 Millionen Euro will Kokain verkauft zu haben, immer Lehner Agrar in Westerstetten die Gemeinde in das förderfähi- an den gleichen Abnehmer aus ge Projekt samt Schüttgut-Lager dem Kreis Neu-Ulm. -

Betreuungsreviere Revier Nr. Gemeinde
Landratsamt Alb-Donau-Kreis Betreuungsreviere Stand: 12.01.2021 Fachdienst Forst, Naturschutz Zuständigkeiten nach Städte und Gemeinden mit Gemarkungen Revier Nr. Gemeinde Gemarkung Revierleiter Altheim/Alb 9 Altheim/Alb Altheim/Alb Volker Sigmund Ballendorf Ballendorf Eschenweg 23 Börslingen Börslingen 89174 Altheim/Alb Neenstetten Neenstetten Tel. 07340 / 6837 Fax: 07340 / 9194151 Mobil: 0160 / 96967790 E-Mail: [email protected] Lonsee 10 Amstetten Amstetten Frieder Angerbauer Bräunisheim Nellinger Strasse 10 Hofstett-Emerbuch 73340 Amstetten Reutti Tel. 07331 / 715547 Schalkstetten Fax: 07331 / 715557 Stubersheim Mobil: 0173 / 3223504 Lonsee Ettlenschieß E-Mail: Halzhausen [email protected] Lonsee Luizhausen Radelstetten Urspring Langenau 11 Stadt Langenau Albeck Mirko Keber Göttingen Bergstr. 10 Hörvelsingen 89174 Altheim/Alb Langenau Tel. 07340 / 929786 Asselfingen Asselfingen Fax: 07340 / 929787 Bernstadt Bernstadt Mobil: 0175 / 2243797 Breitingen Breitingen E-Mail: Holzkirch Holzkirch [email protected] Nerenstetten Nerenstetten Öllingen Öllingen Rammingen Rammingen Setzingen Setzingen Weidenstetten Weidenstetten Merklingen 12 Merklingen Merklingen Timo Allgaier Nellingen Nellingen Schimmelweg 15 Oppingen 89191 Nellingen Westerheim Westerheim Tel.: 07337 / 9244240 Fax: 07337 / 9244241 Mobil: 0172 / 1596061 E-Mail: [email protected] Dornstadt 13 Beimerstetten Beimerstetten Klaus Zeller Dornstadt Bollingen Laichinger Weg 5 Dornstadt 89188 Merklingen Scharenstetten Tel. 07337 / 921500 Temmenhausen Fax: 07337 / 923247 Tomerdingen Mobil: 0173 / 6760435 Westerstetten Westerstetten E-Mail: [email protected] Seite 1 Landratsamt Alb-Donau-Kreis Betreuungsreviere Stand: 12.01.2021 Fachdienst Forst, Naturschutz Zuständigkeiten nach Städte und Gemeinden mit Gemarkungen Revier Nr. Gemeinde Gemarkung Revierleiter Laichingen 14 Stadt Laichingen Feldstetten Alfred Daiber Laichingen Hinter Allenberg 25 Machtolsheim 89150 Laichingen Suppingen Tel. -

Anlage Verzeichnis Der Gemarkungen
Verzeichnis der Gemarkungen Anlage (zu Nummer 1.2) Landkreis / Stadtkreis Gemeinde Gemeinde- Gemarkung Gemarkungs- schlüssel nummer Alb-Donau-Kreis Allmendingen 08425002 Allmendingen 8330 Ennahofen 8331 Grötzingen 8332 Niederhofen 8333 Weilersteußlingen 8334 Altheim (Alb) 08425005 Altheim 8140 Altheim (Alb-Donau-Kreis) 08425004 Altheim 8340 Amstetten 08425008 Amstetten 8120 Bräunisheim 8121 Hofstett-Emerbuch 8122 Reutti 8123 Schalkstetten 8124 Stubersheim 8125 Asselfingen 08425011 Asselfingen 8200 Ballendorf 08425013 Ballendorf 8150 Balzheim 08425140 Oberbalzheim 8450 Unterbalzheim 8451 Beimerstetten 08425014 Beimerstetten 8225 Berghülen 08425017 Berghülen 8290 Bühlenhausen 8291 Bernstadt 08425019 Bernstadt 8180 Blaubeuren 08425020 Asch 8301 Beiningen 8302 Blaubeuren 8300 Pappelau 8303 Seißen 8304 Sonderbuch 8305 Weiler 8306 Blaustein 08425141 Arnegg 8280 Bermaringen 8281 Ehrenstein 8282 Herrlingen 8283 Klingenstein 8284 Markbronn 8285 Wippingen 8286 Börslingen 08425022 Börslingen 8160 Breitingen 08425024 Breitingen 8175 Dietenheim 08425028 Dietenheim 8440 Regglisweiler 8441 Dornstadt 08425031 Bollingen 8231 Dornstadt 8230 Scharenstetten 8232 Temmenhausen 8233 Tomerdingen 8234 Ehingen (Donau) 08425033 Altbierlingen 8361 Altsteußlingen 8362 Berg 8363 Dächingen 8364 Ehingen 8360 Erbstetten 8365 Frankenhofen 8366 Gamerschwang 8367 Granheim 8368 Herbertshofen 8369 Heufelden 8370 Kirchbierlingen 8371 Kirchen 8372 Mundingen 8373 Nasgenstadt 8374 Rißtissen 8375 Schaiblishausen 8376 Volkersheim 8377 Emeringen 08425035 Emeringen 8470 Emerkingen -

Where Can You Use Your Ding Semester Ticket
WHERE CAN YOU USE YOUR THE DING SEMESTER TICKET: DING SEMESTER TICKET. MOBILITY FOR JUST .. The DING Semester Ticket is valid across the entire DING network, including hexagons in The DING Semester Ticket is a personal the DING–htv transition tari, i.e. in all the travel card for one semester and is valid STUDENT vvs hexagons shown below, and on all bus and around-the-clock for as many journeys as train lines (excluding long-distance travel). Attention: On the journey to Memmingen you wish. It costs €133.00. TRAVEL. the semester ticket is valid only on bus lines 250+255 - not on train! Who can buy a semester ticket? WINTER Any registered, fee-paying student at Ulm University, Ulm University of Applied TERM Sciences (THU), Neu-Ulm (HNU), Biberach naldo (HBC), Geislingen (HfWU), HfK+G Ulm as well as the BW Cooperative State Univer- htv sity Heidenheim located in Ulm/Wiblin- Ulm/Neu-Ulm gen (DHBW), upon presentation of a valid edition personal student ID card or certi§cate of registration. www.ding.eu Where to buy a semester ticket.* Ulm University Box-oce cafeteria SouthSide Ulm University of Applied Sciences (THU) Box-oce cafeteria Prittwitzstrasse Semester tickets are issued for the following periods: Biberach University of Applied Sciences (HBC) attacke.love Stadtwerke Biberach, Freiburger Strasse 6 Ulm Uni, HfK+G, DHBW For students at Uni Ulm, HfK+G, THU, HNU, HBC, HfWU Summer Apr. 1 – Sept. 30 SWU KundenCenter trati, Neue Strasse 79, Ulm Winter Oct. 1 – Mar. 31 DB Reise & Touristik, Bahnhofsplatz 1, Ulm naldo bodo vvm DB station ticket oce in DING, or at HDH train station THU, HNU, HBC, HfWU For students at DHBW (Wiblingen site) Summer Mar. -

Amtsblatt Nr. 05 Vom 31.01.2020
Redaktionsschluss Amtsblatt: Mittwoch 08:00 Uhr 31. Januar 2020 Nr. 5 Gemeindeverwaltung: Telefon 07393 953516 Telefax 07393 953517 Homepage: www.hausen–am–bussen.de E–Mail: info@hausen–am–bussen.de AMTLICHE MITTEILUNGEN DER GEMEINDE Sprechzeiten des Bürgermeisters In der nächsten Woche gelten folgende Öffnungszeiten in den Rathäusern in Hausen am Bussen und in Unterwachingen: Rathaus Unterwachingen: Donnerstag von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr Rathaus Hausen am Bussen: Donnerstag von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr. In dringenden Fällen ist Herr Bürgermeister Rieger unter der Telefon–Nr. 07393 3516 erreichbar. – Bürgermeisteramt – Abfuhr der „BLAUEN TONNE“ Die nächste Leerung der „Blauen Tonne“ in unserer Gemeinde ist am kommenden Dienstag, den 4. Februar 2020. Bitte stellen Sie die Tonne um 06:00 Uhr am Straßenrand bereit. Wir gratulieren Hausen am Bussen: Frau Maria Ziegler, Munderkinger Straße 23, am 2. Februar 2020 zum 72. Geburtstag Herrn Hans Sauter, Munderkinger Straße 22, am 9. Februar 2020 zum 80. Geburtstag Frau Anna Burgmaier, Munderkinger Str. 15, am 11. Februar 2020 zum 88. Geburtstag Frau Marianne Falch, Zum Kreisgarten 4, am 20. Februar 2020 zum 83. Geburtstag Herrn Siegfried Schelkle, Unterdorfstraße 17, am 24. Februar 2020 zum 80. Geburtstag Unterwachingen: Herrn Georg Hipper, Am Tobelbach 2, am 9. Februar 2020 zum 77. Geburtstag Wir wünschen den Jubilarinnen und Jubilaren des Monats Februar 2020 alles Gute sowie beste Gesundheit. Terminkalender Hausen am Bussen und Unterwachingen Monat Februar 2020 04.02.2020 Abfuhr Blaue Tonne -

Allmendingen Und Altheim
Mitteilungsblatt der Gemeinden Allmendingen und Altheim mit Ennahofen, Grötzingen, Weilersteußlingen und Niederhofen NEUIGKEITEN AUS ALLMENDINGEN UND ALTHEIM Freitag, 07. Februar 2020/Nr. 6 Einladung zum Tag der offenen Tür an der Kontakt und Öffnungszeiten Gemeinschaftsschule Schelklingen - Allmendingen Allmendingen und Altheim Bürgermeisteramt Schauen – Staunen – Hauptstraße 16 89604 Allmendingen Unsere Schule ! Öffnungszeiten: Montag - Freitag vormittags von 08.00 – 12.00 Uhr Dienstag nachmittags von 13.30 – 16.00 Uhr Donnerstag nachmittags von 13.30 – 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung Auskunft: Telefon 07391 / 7015-0 Telefax 07391 / 7015-35 ALLMENDINGEN E-Mail: [email protected] Wochenmarkt Nicht vergessen: Jeden Donnerstag Vormittag ist auf dem Rathausplatz der Wochenmarkt. Recyclinghof Öffnungszeiten: Freitag von 14.00 – 16.00 Uhr Tag der offenen Tür- Beginn 5. Uhr Samstag von 09.00 – 12.00 Uhr Freitag, 14. Februar 2020, 15.00 – 17.30 Uhr Technische Störungen Schule Allmendingen, Marienstraße 18, 89604 Allmendingen (Wasserversorgung…) www.gms-schelklingen-allmendingen.de Außerhalb der regulären Dienstzeit Tel. 07391/7015-66 Gas-Störungsdienst ALTHEIM T 0800 0 82 45 05 (gebührenfrei) 2 Freitag, 07. Februar 2020 LEINEN LOS! 20. Febr. – 14.00 Uhr Pfarrer-Sailer-Haus. Jede Frau ist willkommen! Impressum Verlag: Verantwortlich: Verantwortlich für die Vereinsnachrichten sind NAK GmbH & Co. KG Bürgermeister Florian Teichmann o. V. i. A. die jeweiligen Vereine und Organisationen. Frauenstraße 77· 89073 Ulm (Amtlicher Teil) T 0731 156 681 · F 0731 156 684 Druck: [email protected] · www.nak-verlag.de Pfarrerin Angelika Kasper, Südwest Presse Media Service GmbH (evangelische Kirchennachrichten) Druckstandort Münsingen Herausgeber: Gutenbergstraße 1 Gemeinde Allmendingen Pfarrer Martin Jochen Wittschorek, 72525 Münsingen Hauptstraße 16 · 89604 Allmendingen (katholische Kirchennachrichten) T 07391 70 15 0 · F 07391 70 15 35 Freitag, 07.