Detlev Pleiss
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

This Is a Self-Archived Version of an Original Article. This Version May Differ from the Original in Pagination and Typographic Details
This is a self-archived version of an original article. This version may differ from the original in pagination and typographic details. Author(s): Ihalainen, Pasi Title: European History as a Nationalist and Post-Nationalist Project Year: 2020 Version: Published version Copyright: © Max Weber Stiftungen, 2020 Rights: In Copyright Rights url: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en Please cite the original version: Ihalainen, P. (2020). European History as a Nationalist and Post-Nationalist Project. In S. Levsen, & J. Req (Eds.), Why Europe, Which Europe? A Debate on Contemporary European History as a Field of Research (15.11.2020). Max Weber Stiftungen. EuropeDebate. https://europedebate.hypotheses.org/353 Ihalainen, Pasi (2020). European History as a Nationalist and Post-Nationalist Project. In Levsen, Sonja; Req, Jörg (Eds.) Why Europe, Which Europe? A Debate on Contemporary European History as a Field of Research, EuropeDebate. Bonn: Max Weber Stiftungen 15.11.2020. https://europedebate.hypotheses.org/353 15/11/2020 BY EUROPEDEBATE European History as a Nationalist and Post- Nationalist Project Pasi Ihalainen European history in Finland Finland is rather exceptional in that, for decades, history students in major universities were allowed to choose between the disciplines of Finnish (national) and General (European/World) History as their major or in some cases Cultural, Economic, Intellectual, Political or Social History instead. Such a selection has been removed recently with the integration of the master’s programmes of Finnish and General History in most universities. It is hoped that this integration will lead to an increased internationalisation and Europeanisation of all academic history teaching and research, supporting the development of comparative, transnational and global perspectives. -

Thüringer Pfarrerbuch Band 10: Thüringer Evangelische Kirche 1921
THÜRINGEN 1920 – 2010 SERIES 250 1 Friedrich Meinhof 01.04.2015 Thüringer Pfarrerbuch Band 10: Thüringer evangelische Kirche 1921 ‐ 1948 und Evangelisch‐Lutherische Kirche in Thüringen 1948 ‐ 2008 Entwurf Zusammengestellt von Friedrich Meinhof 2015 Heilbad Heiligenstadt Series pastorum THÜRINGEN 1920 – 2010 SERIES 250 2 Friedrich Meinhof 01.04.2015 Abtsbessingen (S‐S) 1914 ‐ 1924 Hesse, Walter Karl Otto 1925 ‐ 1935 Petrenz, Hans‐Dietrich Otto Wilhelm, Pf. 1935 (1936) – 1953 Mascher, Werner, Hpf., Pf. 1953 – 1954 Wondraschek, Felix Julius, komm. Verw. 1954 Kästner, Ludwig, Pf. (in Winterstein), Vertr. 1954 (1957) – 1971 Lenski, Heinz, Hpr., Hpf., Pf. 1980 (1982) – 1985 Herbert, Bernd Ernst Erich, komm. Verw., Pfarrvik. 1988 Willer, Christoph 1990 ‐ Lenski, Hartmut, Pf. (in Allmenhausen) 1993 (1995) – 2003 Balling geb. Amling, Beate, Vik., Pf. z.A. Alkersleben (S‐S) 1913 ‐ 1928 Meyer, Franz Simon, Pf. Allendorf b. Königsee (SR) 1886 – 1927 Otto, Karl Heinrich Adolf, Pf. 1928 Triebel, Johannes Karl Ernst, Hpf. 1928 – 1933 Maser, Berthold Philipp Heinrich, Hpf., Pf. 1932 (1935) – 1948 Braecklein, Ingo (u. Schwarzburg) (1939 – 1945 Kriegsdienst) 1941 – 1943 Hansberg, Friedrich Franz, Hpf. (1940 – 1945 Kriegsdienst) 1949 (1950, 1952) – 1963 Bär, Karl, Pf. i. W., komm. Verw., Pf., Opf. 1963 Modersohn, Hans‐Werner, Vik. 1963 (1966) – 1975 Söffing, Horst, Vik., Pf. 1976 – 2006 Hassenstein, Karl‐Helmut, 1993 Opf.(in Döbrischau) Allmenhausen (S‐S) 1919 (1920) ‐ 1927 Simon, Johannes Wilhelm Gottfried 1926 (1927) ‐ 1931 Müller, Friedrich Heinrich Gottfried, Vik., Pf. (Allmenhausen‐ Billeben) 1932 – 1936 Wulff‐Woesten, Alfred Eberhard Harry, Lehrvik., Hpr., Hpf. 1936 (1939) – 1942 Pfannstiel, Paul Arthur, Hpf., Pf. (1940 ‐ 1942 Kriegsdienst) 1943 – 1945 Schoeme, Rolf Waldemar Friedrich, Pf. -

L 332 Official Journal
ISSN 1725-2555 Official Journal L 332 of the European Union Volume 49 English edition Legislation 30 November 2006 Contents I Acts whose publication is obligatory ★ Council Regulation (EC) No 1755/2006 of 23 November 2006 on the import of certain steel products originating in Ukraine ................................................................. 1 ★ Council Regulation (EC) No 1756/2006 of 28 November 2006 amending Regulation (EC) No 2667/2000 on the European Agency for Reconstruction ................................... 18 Commission Regulation (EC) No 1757/2006 of 29 November 2006 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables ............................... 19 II Acts whose publication is not obligatory Council 2006/856/EC: ★ Council Decision of 13 November 2006 establishing a Committee on monetary, financial and balance of payments statistics (Codified version) ............................................... 21 Commission 2006/857/EC: ★ Commission Decision of 15 June 2005 relating to a proceeding under Article 82 of the EC Treaty and Article 54 of the EEA Agreement (Case COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca) (notified under document number C(2005) 1757) (1) ........................................................... 24 2006/858/EC: ★ Commission Decision of 28 November 2006 amending Decision 2005/393/EC as regards restricted zones in relation to bluetongue (notified under document number C(2006) 5607) (1) ..... 26 1 ( ) Text with EEA relevance (Continued overleaf) 2 Acts whose titles are printed in light type are those relating to day-to-day management of agricultural matters, and are generally valid for a limited period. EN The titles of all other acts are printed in bold type and preceded by an asterisk. Contents (continued) 2006/859/EC: ★ Commission Decision of 28 November 2006 granting Malta a derogation from certain provisions of Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2006) 5642) ............................................................. -

Ordnung Der Müllerzunft Königshofen Und Wildberg Von 1618 Aus Dem
GrabfeldDas Heimatblätter für Kultur, Geschichte und Brauchtum im Grabfeld Herausgeber: Verein für Heimatgeschichte im Grabfeld e.V. und Museumspädagogisches Zentrum Bad Königshofen i. Gr. Nummer 8 Nummer 8 Bad Königshofen, Oktober 2000 Seite 1 REINHOLD ALBERT Ordnung der Müllerzunft Königshofen und Aus dem Inhalt Ordnung der Müllerzunft Königshofen Wildberg von 1618 und Wildberg von 1618 .......................... 1 Ein Mühlenverzeichnis von 1895 ........... 3 Konfirmation und Kommunion - m Stadtarchiv von Bad Königshofen befindet die Entwicklung der Industrialisierung. Das zwei hohe Festtage ................................. 4 sich ein Mühlenbuch, das Eintragungen ab Zunftwesen in Europa wird im 19. Jahrhun- Sonderaustellung Weihnachtszeit in 1618I enthält. Es wurde begonnen, als sich die dert allmählich abgeschafft. Dies ist besonders Bad Königshofen .................................... 6 Müller der beiden fürstbischöflichen Ämter auf die Ausstrahlungskraft der Französischen Heinrich Richter schuf 1933 der Cent Königshofen und der Cent Wildberg Revolution zurückzuführen. Heute stehen die den Kreuzweg ........................................ 7 bei Sulzfeld entschlossen, eine Zunft zu bil- Innungen für freiwillige berufliche Zusammen- Die Türkenkriege und das Grabfeld ....... 8 den. In einem Schreiben an Johann Gottfried schlüsse. Ablösung der Grundlasten in von Aschhausen, von 1617 - 1622 Bischof Zurück zu Müllerzunft von Königshofen/ Großeibstadt 1848 ................................... 9 zu Bamberg und Würzburg und Herzog zu Wildberg. -

DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT „HOHE RHÖN“ M Birx M Erbenhausen M Frankenheim M Stadt Kaltennordheim M Oberweid
RHÖNER NACHRICHTEN AMTSBLATT DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT „HOHE RHÖN“ m Birx m Erbenhausen m Frankenheim m Stadt Kaltennordheim m Oberweid Jahrgang 27 Freitag, den 6. März 2020 10. Woche / Nr. 3 Verwaltungsgemeinschaft „Hohe Rhön“ Sprechzeiten Neue Öffnungszeiten für die Verwaltungsgemeinschaft „Hohe Rhön“ Montag 8:30 - 12:00 Uhr Dienstag 8:30 - 12:00 Uhr 13:30 - 16:00 Uhr Mittwoch 8:30 - 12:00 Uhr Donnerstag 8:30 - 12:00 Uhr 13:30 - 18:00 Uhr Freitag 8:30 - 12:00 Uhr Diese Sprechzeiten gelten seit dem 01.02.2020 für beide Standorte der VG „Hohe Rhön“ sowie die Stadtverwaltung Kaltennordheim. Sprechzeiten der Bürgermeister Erbenhausen 1. und 3. Montag 20:00 - 21:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Erbenhausen (unterer Eingang) im Monat Frankenheim jeden Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr Oberweid jeden Donnerstag 18:00 - 20:00 Uhr Nächster Redaktionsschluss Nächster Erscheinungstermin Montag, den 23.03.2020 Freitag, den 03.04.2020 Rhöner Nachrichten vom 06.03.2020 - 2 - Nr. 3/2020 Veranstaltungen Veranstaltungskalender Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort Veranstalter 07.03.2020 20.00 Uhr Tullifelder Männerballetttreffen Saal der UCC Rhönmöbel Unterweid 10.03.2020 Frauentagsfeier in Gerbershausen Seniorenservice im Eichsfeld - Landgasthof „Zum Kaltennordheim/Kaltenlengsfeld Blauen Bock“ mit Mittagsessen sowie Kaffee und Kuchen + Unterhaltungsprogramm 13.03.2020 Frauentagsfeier in Oberkatz Bürgerhaus Oberkatz Dorfladenverein und Ortsteilrat 17.03.2020 17.00 - Blutspende Dorfgemeinschaftshaus Institut für Transfusionsmedizin 20.00 Uhr Kaltenlengsfeld Suhl gGmbH 21.03.2020 13.00 - Kinder- und Babybasar Dorfgemeinschaftshaus Gemeinde Oberweid 16.30 Uhr Oberweid 22.03.2020 10.00 Uhr Radtour rund um Kaltennordheim Geschäft: Fahrrad Fuchs Anmeldung bei Heiko Fuchs, Kaltennordheim, Tel. -

AGREEMENT Between the European Community and the Republic Of
L 28/4EN Official Journal of the European Communities 30.1.2002 AGREEMENT between the European Community and the Republic of South Africa on trade in wine THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as the Community, and THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, hereinafter referred to as South Africa, hereinafter referred to as the Contracting Parties, WHEREAS the Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part, has been signed on 11 October 1999, hereinafter referred to as the TDC Agreement, and entered into force provisionally on 1 January 2000, DESIROUS of creating favourable conditions for the harmonious development of trade and the promotion of commercial cooperation in the wine sector on the basis of equality, mutual benefit and reciprocity, RECOGNISING that the Contracting Parties desire to establish closer links in this sector which will permit further development at a later stage, RECOGNISING that due to the long standing historical ties between South Africa and a number of Member States, South Africa and the Community use certain terms, names, geographical references and trade marks to describe their wines, farms and viticultural practices, many of which are similar, RECALLING their obligations as parties to the Agreement establishing the World Trade Organisation (here- inafter referred to as the WTO Agreement), and in particular the provisions of the Agreement on the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as the TRIPs Agreement), HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 Description and Coding System (Harmonised System), done at Brussels on 14 June 1983, which are produced in such a Objectives manner that they conform to the applicable legislation regu- lating the production of a particular type of wine in the 1. -

Verbiss- Und Schälinventur 2016 Verfahren Und Ergebnisse Für Den Landkreis Schmalkalden-Meiningen
Verbiss- und Schälinventur 2016 Verfahren und Ergebnisse für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen Thüringer Forstamt Schmalkalden, 2016 Gutachten zur Erfassung und Bewertung der Situation der Waldverjüngung und des Umfangs der Schälschäden nach § 32 (1) ThJG im Landkreis Schmalkalden-Meiningen für das Jahr 2016 Vorbemerkung Anlass des Gutachtens ist der Gesetzesauftrag nach § 32 (1) ThJG zur periodischen Erstellung eines Gutachtens zur Erfassung und Bewertung der Situation der Waldverjüngung und des Umfangs der Schälschäden. In dieses Gutachten gehen die Teilgutachten der im Landkreis Schmalkalden-Meiningen zuständigen Forstämter Kaltennordheim, Oberhof, Heldburg und Schmalkalden ein. Am Gutachten haben mitgewirkt Verfasser: Jörn Ripken, Thüringer Forstamt Schmalkalden, Verfasser der FoA-Gutachten: Forstamtsleiter Wilhelm (FoA Oberhof), Forstamtleiter Wollschläger (FoA Heldburg) Forstamtsleiter Marbach (FoA Kaltennordheim) Forstamtsleiter Ripken (FoA Schmalkalden) Datengrundlage: Inventur im Zeitraum März bis April 2016 durch Mitarbeiter der jeweiligen Forstämter, sowie stichprobenartige Kontrolle auf 10 % der Fläche durch die Inspektion. 1 Allgemeine Beschreibung der Waldfläche sowie der jagdlichen Verhältnisse im Landkreis Schmalkalden-Meiningen Die folgende Beschreibung des Landkreises Schmalkalden-Meiningen ist der Internetseite der TLUG entnommen. Die Beschreibung zeigt augenfällig die große naturräumliche Breite des Landkreises. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen liegt im Südwesten Thüringens. Begrenzt wird er im Norden vom Wartburgkreis -
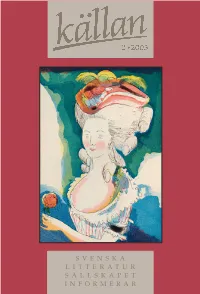
S V E N S K a L I T T E R a T U R S Ä L L S K a P E T I N F O R M E R
SVENSKA LITTERATUR SÄLLSKAPET INFORMERAR Innehåll Håkan Andersson: Mot en fördjupad bild av J. L. Runeberg. Svenska litteratursällskapet inför Runebergjubileet 2004 ....... 1 Föreläsningar, seminarier, utställningar och böcker. Svenska litteratursällskapet i Finland firar Runeberg 2004.................... 3 Sari Hilska: Flera hundra Runebergevenemang. Ett nationellt jubileum på två språk ................................................................... 5 Yrsa Lindqvist: Siden, sammet, trasa, lump ... Folkkultursarkivet insamling om förhållandet till kläder ........................................ 7 Carola Ekrem: Barnavård och barnuppfostran. Folkkultursarkivets pristävling nr 44 ............................................................................ 25 Meta Sahlström: Samarbetsprojektet Österbottniskt 1900-tal ........ 30 Bettina Wulff: Bokmässornas poetik ................................................. 34 Heliga Birgitta 700 år.......................................................................... 40 Anna Perälä: Zachris Topelius böcker i värdefull donation .......... 41 Ingalill Ihrcke-Åberg: Webbplatsen – ett visitkort ............................ 44 Nya böcker ........................................................................................... 46 Svenska litteratursällskapets väggkalender 2004 .......................... 55 Föreläsningsserie våren 2004 ............................................................ 56 Medverkande i detta nummer .......................................................... 57 Omslagsbild: -

Kulm Community Homeland Book Translator: Allen E
Translated By: Missionary Allen E. Konrad Kulm Community Homeland Book Translator: Allen E. Konrad Heimatbuch der Gemeinde Kulm P.O. Box 205 26 June, 2005 Rowley, Iowa 52329 TRANSLATOR'S FORWARD The following is a translation of the German book Heimatbuch der Gemeinde Kulm, H.G. Gachet & Company, Langen Bez. Frankfurt/Main. This English translation was printed in serial form in the Germans from Russia Heritage Society [GRHS] journal Heritage Review. The serialized form can be located in the following issues from 1983-1985…Vol. 13:4 (pp 3-23); Vol. 14:2 (pp 19-36); Vol. 14:3 (pp 52-60); Vol. 14:4 (pp 33-43); Vol. 15:2 (pp 30-43) and Vol. 15:3 (pp 23-35). Of the 284 pages of this German book, I translated the first 224 pages. At that point, I stopped translating for the GRHS Journal because, beginning with page 225, the book goes on with pages and pages of lists of names and some paragraphs pertaining to the 150th Anniversary celebration of the Kulm, Bessarabia people. It was my feeling that I didn't think that Heritage Review would want to fill its pages with lists of names when there might be many other articles of interest to the readers. I was mistaken. Mr. Armand Bauer, of the GRHS, felt the information was significant and took the initiative to translate and include pages 225-237 in the serialized printing. In re-typing the original series for digital formatting in 2004-2005, some revisions were made to what I considered to be awkward translations. -

Legend: BV=A German Village Near the Black Sea
AHSGR American Historical Society of Germans From Russia Germanic Origins Project Legend: BV=a German village near the Black Sea . FN= German family name. FSL= First Settlers’ List. GL= a locality in the Germanies. GS= one of the German states. ML= Marriage List. RN= the name of a researcher who has verified one or more German origins. UC= unconfirmed. VV= a German Volga village. A word in bold indicates there is another entry regarding that word or phrase. Click on the bold word or phrase to go to that other entry. Red text calls attention to information for which verification is completed or well underway. Push the back button on your browser to return to the Germanic Origins Project home page. Le-Lhz last updated March 2015 Lea?{Anton}: said by Recruiter Beauregard’s list to have been fromUC Stein (Lk61). Not found in any FSL and I could not find them or any likely descendant associated with any Volga colony. Lebach?, [Kur-]Trier: an unidenified place said by the Hoelzel FSL to be homeUC to a Schaefer family. This likely would have been 26 miles SE of Trier city. LebbenGL: see Lebbin. LebbinGL, [Kur-]Brandenburg: is some 27 miles SE of Berlin city center, and said by the Dinkel FSL to be homeUC to a Reinhard family. Said by the Jost FSL to be homeUC to Jerke and Meisner families. Luebben?GL, Brandenburg: said by the Jost FSL to be homeUC to an Eismann family; I am guessing this was Lebbin, since the only Luebben I can find was in Kursachsen. -

The Role of the Kalevala in Finnish Culture and Politics URPO VENTO Finnish Literature Society, Finland
Nordic Journal of African Studies 1(2): 82–93 (1992) The Role of the Kalevala in Finnish Culture and Politics URPO VENTO Finnish Literature Society, Finland The question has frequently been asked: would Finland exist as a nation state without Lönnrot's Kalevala? There is no need to answer this, but perhaps we may assume that sooner or later someone would have written the books which would have formed the necessary building material for the national identity of the Finns. During the mid 1980s, when the 150th anniversary of the Kalevala was being celebrated in Finland, several international seminars were held and thousands of pages of research and articles were published. At that time some studies appeared in which the birth of the nation state was examined from a pan-European perspective. SMALL NATION STATES "The nation state - an independent political unit whose people share a common language and believe they have a common cultural heritage - is essentially a nineteenth-century invention, based on eighteenth-century philosophy, and which became a reality for the most part in either the late nineteenth or early twentieth century. The circumstances in which this process took place were for the most part marked by the decline of great empires whose centralised sources of power and antiquated methods of administrations prevented an effective response to economic and social change, and better education, with all the aspirations for freedom of thought and political action that accompany such changes." Thus said Professor Michael Branch (University of London) at a conference on the literatures of the Uralic peoples held in Finland in the summer of 1991. -

B COMMISSION DECISION of 23 May 2005 On
2005D0393 — EN — 02.03.2007 — 009.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COMMISSION DECISION of 23 May 2005 on protection and surveillance zones in relation to bluetongue and conditions applying to movements from or through these zones (notified under document number C(2005) 1478) (Text with EEA relevance) (2005/393/EC) (OJ L 130, 24.5.2005, p. 22) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Commission Decision 2005/434/EC of 9 June 2005 L 151 21 14.6.2005 ►M2 Commission Decision 2005/603/EC of 4 August 2005 L 206 11 9.8.2005 ►M3 Commission Decision 2005/763/EC of 28 October 2005 L 288 54 29.10.2005 ►M4 Commission Decision 2005/828/EC of 23 November 2005 L 311 37 26.11.2005 ►M5 Commission Decision 2006/64/EC of 1 February 2006 L 32 91 4.2.2006 ►M6 Commission Decision 2006/268/EC of 5 April 2006 L 98 75 6.4.2006 ►M7 Commission Decision 2006/273/EC of 6 April 2006 L 99 35 7.4.2006 ►M8 Commission Decision 2006/572/EC of 18 August 2006 L 227 60 19.8.2006 ►M9 Commission Decision 2006/591/EC of 1 September 2006 L 240 15 2.9.2006 ►M10 Commission Decision 2006/633/EC of 15 September 2006 L 258 7 21.9.2006 ►M11 Commission Decision 2006/650/EC of 25 September 2006 L 267 45 27.9.2006 ►M12 Commission Decision 2006/693/EC of 13 October 2006 L 283 52 14.10.2006 ►M13 Commission Decision 2006/761/EC of 9 November 2006 L 311 51 10.11.2006 ►M14 Commission Decision 2006/858/EC of 28 November 2006 L 332 26 30.11.2006 ►M15 Commission Decision 2007/28/EC of 22 December