Chronik Résumé En Français
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Schifffahrt Titelbild Umschlag: Kursschiff Auf Der Fahrt Nach Horgen, 2011
Horgner Jahrheft 2012 Schifffahrt Titelbild Umschlag: Kursschiff auf der Fahrt nach Horgen, 2011. Horgner Jahrheft 2012 Inhalt Schifffahrt Seite Vorwort 3 Theo Leuthold Die Verkehrsschifffahrt 5 Andrea Mader Schiffswartehallen am Zürichsee 14 Andrea Mader Zürichseekapitän Ernst Rimensberger 26 James J. Frei Die «schwimmende Brücke» über den Zürichsee 30 Die Crew auf dem Fährschiff Die Leute im Hintergrund Albert Caflisch Bootsplätze 36 Monika Neidhart Max Bachmann: Mit «Pollan» unterwegs 40 Hans Erdin Die Kreuzerpokal-Regatta 43 Doris Klee Flugtag 1921 in Horgen 46 Doris Klee Horgen im Jahr 2011 48 Chronik, Sportlerehrungen und Bevölkerungsstatistik Marianne Sidler und Albert Caflisch Bibliografie, Bildnachweis und Impressum 56 Die Redaktionskommission (von links nach rechts): Hans Erdin, Monika Neidhart, James J. Frei, Doris Klee, Albert Caflisch, Marianne Sidler und Theo Leuthold. Vorwort Schifffahrt – auch für Horgen von Bedeutung Liebe Leserinnen, liebe Leser Einmal mehr halten Sie das neue Jahrheft in Händen, und schon das Titelbild versetzt uns in eine besondere Stimmung. Der Raddampfer, der auf uns zufährt, lädt uns ein, ins neue Jahrheft einzutauchen. Heute ist es die Seesicht, die unsere Gemeinde zu einer höchst begehrten Wohnlage macht; früher war es der See, der als Verkehrsachse von grosser Bedeutung war. Wer die Geschichte von Horgen etwas genauer verfolgt, der weiss natürlich, dass unser Ortsmuseum – die Sust – ehemaliger Warenumschlagplatz war und wesentlich zur Entwicklung von Horgen beigetragen hat. Wir müssen aber gar nicht so weit zurück- blicken. Schlagen Sie das Jahrheft auf Seite 17 auf und bewundern Sie unseren Bahnhofplatz samt «Minischiffsteg», wie er sich vor gut 100 Jah- ren präsentiert hat – er hätte auch einen Preis verdient. -

Stadtarchiv Zürich
Stadtarchiv Zürich Stadtarchiv Zürich Jahresbericht 2009 /2010 Haus zum Untern Rech, Neumarkt 4, CH-8001 Zürich Telefon +41 (0)44 266 86 46 Telefax +41 (0)44 266 86 49 /2010 E-Mail-Adresse: [email protected] Internet-Adresse: www.stadt-zuerich.ch/stadtarchiv Öffnungszeiten des Lesesaals (3. Stock): Dienstag bis Freitag von 0800 bis 1700 Uhr (über Mittag 1200 bis 1300 Uhr keine Fachauskünfte) Vorausbestellungen von Büchern und Archivalien sind er- wünscht Bücher- und Aktenbestellungen vom Archivlager am Neu- markt werden ausgeführt: 0830, 0930, 1030, 1130, 1330, 1430, 1530 Uhr Aktenbestellungen aus Aussenlagern: Vorausbestellungen Jahresbericht 2009 bis Mittwochabend auf Dienstag folgender Woche Das Stadtarchiv Zürich ist eine Abteilung des Präsidialdepartements der Stadt Zürich Stadtarchiv Zürich Stadtarchiv STADTARCHIV ZÜRICH JAHRESBERICHT 2009 /2010 1 Herausgeberin Stadt Zürich Stadtarchiv Zürich Haus zum Untern Rech Neumarkt 4 CH-8001 Zürich [email protected] Redaktion Anna Pia Maissen, Max Schultheiss Text Anna Pia Maissen, Max Schultheiss, Karin Beck, Nicola Behrens, Christian Casanova, Robert Dünki, Roger Peter, Halina Pichit, Kerstin Seidel, Caroline Senn Lektorat Andrea Linsmayer, Max Schultheiss, Anna Pia Maissen Layout Mario Florin, Zürich Druck Staffel Druck, Zürich Auflage 1000 Exemplare Preis CHF 10.–; ältere Jahresberichte gratis solange Vorrat © Stadtarchiv Zürich 2011 Bild Umschlag vorne Firmenprospekt der Mechanischen Papierfabrik an der Sihl für «Fein Post Papier» (undatiert). 2 INHALT Einleitung 5 Personal -

Arboretum Zürich Oststaaten USA Kanada
Arboretum Zürich Oststaaten USA Kanada Analyse und Empfehlungen ZHAW IUNR :: URBAN FORESTRY :: UI16 :: 11.01.2019 :: FACHKORREKTOREN: A. HEINRICH, A.SALUZ AUTOREN: O.BACHMANN, P.HELLER, L.JENAL, L.OTT -02 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 03 1.2 Zielsetzung 03 2 Analyse 04 2.1 Standort 04 2.2 Klima 05 2.3 Wurzelraum 06 2.4 Boden 06 2.5 Wasserhaushalt 06 2.6 Lichtverhältnisse 07 2.7 Nutzungsdruck 08 2.8 Weitere Umwelteinflüsse 08 3 Ausgangslage 09 3.1 Situationsplan 09 3.2 Baumbeurteilung 11 4 Sanierung 13 4.1 Konzept 20 4.2 Unterpflanzung 21 4.3 Kosten 24 5 Diskussion 26 6 Verzeichnisse 27 7 Anhang 29 -03 1 Einleitung Urbane Räume stellen Extrembedingungen für Vegetation 1.1 Arboretum jeglicher Art dar. Hohe Schadstoffbelastungen, Salzeinträge, Das Arboretum ist ein Teil der Quaianlagen der Stadt Zürich. erhöhte Durchschnittstemperaturen, Trockenheit, unge- Gegen die Stadt wird es abgegrenzt durch den General- nügend grosser Wurzelraum sowie zahlreiche bau- und Guisan- und den Mythenquai, heute zwei stark frequentierte sicherheitstechnische Vorgaben führen in ihrer Gesamtheit Autostrassen. Die Idee, ein Teil der Quaianlagen zu einem dazu, dass die bestehende grüne Infrastruktur unter Arboretum auszugestalten, stammte von Dozierenden der enormem Druck steht und neue Pflanzungen immer öfter ETH, welche sich eine nach wissenschaftlichen Aspekten versagen. Trotzdem sind Grünstrukturen, insbesondere gestaltete Sammlung von Bäumen aus verschiedenen Stadtbäume und -parks, von essentieller Bedeutung für pflanzengeographischen, systematischen, und pflanzen- den urbanen Raum. Sie erbringen überlebensnotwendige geschichtlichen Bereichen wünschten (Schleich, 1986). Ökosystemdienstleistungen. Darunter zu verstehen sind Das Arboretum konnte 1885 eingeweiht werden. Von den beispielsweise die Bindung von CO2 und die damit anfänglich 750 gepflanzten Bäumen starben zwei Drittel einhergehende Sauerstoffproduktion, Kühlung des Aussen- und ein Drittel hat heute das natürliche Alter erreicht. -
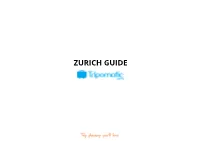
Zurich Guide Zurich Guide Money
ZURICH GUIDE ZURICH GUIDE MONEY Money can be best exchanged at railway station Essential Information kiosks and in the banks (they charge a commis- Money 3 sion fee). Traveler’s checks are up for a slightly better exchange rate. ATMs are abundant and Communication 4 Everyone knows Lake Zurich, Swiss watches also offer great exchange rates. and chocolate, but there’s so much more to Holidays 5 Zurich. As well as being the main cultural hub Switzerland is significantly more cash-oriented than other countries, however cards are accepted Transportation 6 of the German-speaking part of the Switzer- land, it is a leading financial center with one of in large stores; the most popular ones being Visa Food 8 the world’s most important stock exchanges. and Mastercard – always check the stickers on the The wealthy city is not afraid to show off its door of the store for those card accepted. ATMs Events During The Year 9 prosperity – there are majestic and almost lav- are readily available almost everywhere. ish buildings, ornate mansions and streets full 10 Things to do of luxurious shops and boutiques. Prices Zurich also has plenty to offer culture-lovers. Meal, inexpensive restaurant – 20 CHF DOs and DO NOTs 11 There are many amazing museums and gal- Meal for 2, mid-range restaurant, three-courses- Activities 13 leries showcasing renowned historical artworks 100 CHF as well as new and emerging contemporary Combo Meal at McDonalds – 12 CHF . artists. Fans of theatre and music will have Bottle of water at supermarket – 1 CHF hard time making an itinerary too – there are Domestic beer (0.5 liter, draught) – 6 CHF so many cultural events of all genres taking Cappuccino – 4.50 CHF place every night. -

Meilensteine Der Stadtentwicklung
Informationen für die Lehrpersonen Meilensteine der Stadtentwicklung Jahr Bauwerk Hinweis Vorrömische Keltische Siedlung Keltische Siedlung auf und um den Lindenhof (Helve- Zeit tier). Die Funde lassen auf eine florierende Siedlung schliessen, mit Handwerk und der Verarbeitung land- wirtschaftlicher Produkte. Funde von Tüpfelplatten zur Herstellung von Geld geben den Hinweis, dass die Siedlung Zentralort für die weitere Umgebung war. Ein hinter der Oetenbachgasse gefundener spitzförmiger Graben lässt auf einen Kultplatz schliessen. Weitere Keltenfunde gibt es vom Üetliberg oder vom Hönggerberg, welche aber noch älter sind. Ab 58 v.Chr. waren die Helvetier Bündnispartner von Rom und zu Tributzahlungen verpflichtet. So dürfte das römische Militär ab etwa 40 v. Chr. In Zürich prä- sent gewesen sein. Römische Besetzung Besetzung Helvetiens durch die Römer unter Kaiser Epoche Helvetien Augustus. Errichtung der Zollstation Turicum. ab Zollstation Turicum Im 2. Jahrzehnt nach Christus wurde die Absenkung 40/15 v. Chr. des Seespiegels um rund 4.5 m veranlasst, um neuen Baugrund zu gewinnen (Entfernen des stauenden Sihl-Geschiebes). Der Seespiegel lag dann auf etwa 403.5 m.ü.M. was rund 2.5 m tiefer ist als heute. So lag etwa die heute nicht mehr sichtbare Insel Grosser Hafner frei, und darauf dürfte ein römischer Tempel gestanden sein. Ebenfalls nicht mehr überschwemmt waren Münsterhof und Umgebung sowie der Wein- platz. «Gang dur Züri» 2016 D.8.1. Meilensteine der Stadtentwicklung 1/ 16 Jahr Bauwerk Hinweis Um 70/ 75 entstand beim heutigen -

Vertikal Und Horizontal
NahReisen 2017: vertikal und 8. Mai bis 11. Juli horizontal Anmeldung ab 25. April auf www.nahreisen.ch vertikal und horizontal oder über 044 319 80 61 (Wochentage, 8–12 und 13–17 Uhr) NahReisen führen in die Höhe und in die Tiefe: Auf den Swissmill Tower an der Limmat und die Kanzel des Sendeturms Anmeldung erforderlich bei: auf dem Uetliberg, auf Dachgärten im Toni-Areal und in Altstetten, in einen 01 Käpfnach Leitungsschacht unter der Löwenstrasse, einen 1940 gegrabenen Bunker und mit 02 Tüfels Chile der Stollenbahn in ein ehemaliges Kohlen- bergwerk. Sie ermöglichen den Blick 04 Kornhaus auf Stadt und Region aus der Falken- Perspektive und zeigen, wie sich Rehe 05 Biber & Greif durch die Landschaft und Glühwürmchen durch die Luft bewegen. Ausstellungs- 06 Natürliche Stadtrundfahrt besuche und Ausflüge führen zum be- rühmten begrünten Gerüst des MFO-Parks, 07 Grün vertikal und horizontal zu neuartigen Vertikalbegrünungen an Fassaden und der bemoosten Stufen- 13 Untergrund landschaft eines Tuffsteinbruchs. Auf einer Stadtrundfahrt im Tram, im histo- 15 Vernetzte Landschaft rischen Greifensee-Dampfer und zu Fuss gelangen wir zu Lebensräumen von Bibern, 16 Toni Dachsen und Menschen und sehen uns die alten Bäume im Arboretum an. In der Binz und der Herdern besichtigen wir Im Verhinderungsfall bitte Anmeldung unbedingt stornieren, damit frei gewordene Plätze wieder besetzt werden können! aktuelle Bauprojekte, bei deren Realisie- rung auf die bestehende Grünsubstanz Programmheft bestellen, weitere Informationen: Rücksicht genommen wurde. www.nahreisen.ch/18/program, [email protected] oder 044 319 80 61 Die Teilnahme an den Veranstaltungen der NahReisen geschieht NahReisen vertikal und horizontal auf eigene Gefahr und Verantwortung. -

Projektarbeit Kulturlandschaftwandel
Projektarbeit Kulturlandschaftwandel See- und Limmatuferentwicklung in Zürich 1814 bis 2005 Autoren: Stephanie Matthias, Pascal Minder, Martin Neuenschwander, Sara Zingg Leitung: Prof. Dr. L. Hurni Betreuung: Stefan Räber, Institut für Kartographie ETH-Hönggerberg Sommersemester 2005 Projektarbeit Kulturlandschaftswandel Technischer Bericht 1 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ....................................................................................2 2. Gesamtüberblick der See- und Limmatuferentwicklung ................3 2.1. Übersicht Zustand 1867 – Zustand heute.................................... 3 2.2. Zustand 1899 ............................................................................. 3 2.3. Zustand 1937 ............................................................................. 4 2.4. Zustand 1956 ............................................................................. 5 2.5. Zustand 1976 ............................................................................. 5 2.6. Zustand heute ............................................................................ 6 3. Bürkli (1860-1900) .......................................................................6 3.1. Historischer Hintergrund ............................................................ 6 3.2. Kartografische Veränderungen .................................................... 7 3.3. Ausgewählte bauliche Veränderungen ......................................... 9 4. Landi (1939) ...............................................................................11 -

Einführung Bürkliplatz : Weshalb Die Bahnhofstrasse Im See Versinkt
Einführung Bürkliplatz : weshalb die Bahnhofstrasse im See versinkt Autor(en): Huber, Werner Objekttyp: Article Zeitschrift: Hochparterre : Zeitschrift für Architektur und Design Band (Jahr): 17 (2004) Heft [15]: Zwei Brennpunkte : elf Projekte in Stahl und Holz für Zürich PDF erstellt am: 11.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-122500 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch S «Zu den schönsten vor allen in der Schweiz gehören diejenigen Städte, welche an einem See und an einem Flusse zugleich liegen, so dass sie wie ein weites Tor am Ende des Sees unmittelbar den Fluss aufnehmen, welcher mitten durch sie in das Land hinauszieht», schrieb Gottfried Keller 1854/55 in der ersten Fassung des (Grünen Heinrich). -

Visionen Zum Seeufer 250304.Indd
Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort 3 2 Ausgangslage 4 3 Fragestellungen und Zielsetzung 11 4 Vorgehen und AdressatInnen 12 5 Projektablauf 12 6 Beteiligte 13 7 Teambeiträge Gesamtvision 7.1 Team Bosshard + Luchsinger 14 7.2 Team Bolles + Wilson 24 7.3 Team West 8 32 8 Teambeiträge Bereich Kongresshaus 8.1 Team Bosshard + Luchsinger 50 8.2 Team Bolles + Wilson 52 8.3 Team West 8 54 9 Erkenntnisse, Folgerungen und mögliche nächste Schritte 58 10 Anhang (diverse Übersichten) 67 Herausgeberin: Stadt Zürich Hochbaudepartement Amt für Städtebau (Stadtplanung) Konzeptstudien, Pläne und Fotos: Bosshard + Luchsinger Architekten ETH, Luzern Bolles + Wilson Architekten, Münster, Deutschland West 8 urban design & landscape architecture, Rotterdam, the Netherlands Moderation Workshops: Franz Eberhard, Direktor Amt für Städtebau Regula Lüscher Gmür, Bereichsleiterin Stadtplanung, stv. Dir. Amt für Städtebau Projektleitungsteam Amt für Städtebau: Frank Argast (Projektleitung) Peter Noser Cornelia Taiana-Schweizer Jean-Daniel Gross (Denkmalpflege) Auswertung und Schlussfolgerungen: Regula Lüscher Gmür, Bereichsleiterin Stadtplanung, stv. Dir. Amt für Städtebau Frank Argast, Amt für Städtebau Peter Noser, Amt für Städtebau Paul Bauer, Leiter Planung und Bau, Grün Stadt Zürich Cordula Weber, Leiterin Freiraumplanung, Grün Stadt Zürich Ueli Baumgartner, Verkehrsplanung, Tiefbauamt der Stadt Zürich Matthias Grieder, Chef Wasserschutzpolizei der Stadt Zürich Fritz Schaad, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich Felix Blindenbacher, Amt für Raumordnung und Vermessung des Kantons Zürich Fotos: DesAir Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich Amt für Städtebau Postkarte (Titelbild) Druck: GeoPrintShop Gestaltung: David Janczak, Amt für Städtebau Bezugsquelle: Amt Für Städtebau Lindenhofstrasse 19 Postfach 8021 Zürich Telefon: 01 216 26 83 [email protected] 1 Vorwort Drei Visionen zum Seeufer liegen vor. -

Kantonaler Gestaltungsplan «Seilbahn Mythenqual-Zürlhorn» (Züribahn) - Festsetzung
Kanton Zürich Nr. 0456 / 19 Baudirektion Li Verfügung Amt für Raumentwicklung vom 26. April 2019 Raumplanung Referenz-Nr.: ARES-BATK3D / ARE 19-0456 Kontakt: Julia Wienecke, Gebietsbetreuerin Richt-/Nutzungsplanung, Stampfenbachstrasse 12, 8090 Zürich Telefon +41 43 259 43 11, Www.are.zh.ch 1/5 Kantonaler Gestaltungsplan «Seilbahn Mythenqual-Zürlhorn» (ZüriBahn) - Festsetzung Gemeinde Zürich Lage Kat.-Nrn. R14672, R14671, R14449, EN2569, W05560, EN2567 und R15126 Massgebende Situationsplan und Längenprofil im Mst. 1:2500 vom 25. März 2019 Unterlagen - Detailplan im Mst. 1:500 vom 25. März 2019 Gestaltungsplanvorschriften (GPV) vom 25. März 2019 - Bericht im Sinne von Art. 47 RPV vom 25. März 2019 - Bericht zu den nicht berücksichtigen Einwendungen vom 25. März 2019 Zuständigkeit Mit der am 21. Juni 2017 vom Regierungsrat festgesetzten Gesamtrevision des regiona- len Richtplans der Stadt Zürich (RRB Nr. 576/2017) wurde der Eintrag Nr. 61 «Seilbahn / Gondelbahn Bereich Landiwiese / Belvoirpark bis Zürichhorn» als eine auf maximal fünf Jahre befristete Seilbahnverbindung über den See eingetragen. Damit ist die Baudirektion gemäss § 2 lit. b des Planungs- und Baugesetzes (PBG) für die Festsetzung eines Ge- staltungsplanes nach § 84 Abs. 2 PBG zuständig. Sachverhalt Ausgangslage Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) feiert 2020 ihr 150-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass plant sie eine temporäre Seilbahn zwischen den Gebieten Mythenquai und Zürichhorn über den Zürichsee. Die Seilbahn soll für eine Dauer von längstens fünf Jahren betrieben werden. Sie wird anschliessend rückgebaut. Die durch die Bahn beanspruchten Flächen werden wiederhergestellt. Die Seilbahn dient als Freizeitverbindung und touristische Attraktion und soll der Zürcher Bevölkerung sowie Touristen ein einmaliges Erlebnis vermitteln. Die Seilbahn soll ferner als Impulsgeber für ein neues Verkehrssystem im urbanen Raum dienen und im Sinne einer verkehrstechnischen Vision in die Zukunft weisen. -

Die Flora Des Kantons Zürich
Arbeit aus den botanischen Museen beider Hochschulen Zürichs. Die Flora des Kantons Zürich. I. Teil. Die Ruderal- und Adventivflora des Kantons Zürich. Von O. Naegeli und A. Thellung. Vorbemerkung. Im VIII. Bericht der zürch. bot. Gesellschaft (1901-1903) hatten wir be- reits eine 'Publikation der kantonalen Novitäten auf dem Gebiete der Ruderal- und Adventivflora in einer besondern Schrift in Aussicht gestellt; wir gedachten damals nur unsere eigenen neuen Funde zu publizieren. Doch war es schon bei diesem Umfang der gestellten Aufgabe von Interesse, zu untersuchen, ob und wo die von uns gefundenen Arten etwa früher schon im Kanton beobachtet werden waren, und so kamen wir dazu, den Rahmen der Arbeit zu erweitern und die gesamte bisher im Gebiet beobachtete Ruderal- und Adventivflora im Zusammenhang zu publizieren. Die folgende Zusammenstellung bildet den ersten Bestandteil der in Arbeit begriffenen Flora des Kantons Zürich. — Als Quellen haben uns gedient (neben den zahlreichen eigenen Beobachtungen in den letzten Jahren): die Herb arien ,der Universität und des Polytechnikums in Zürich; Köllikers „Verzeichnis der phanerogamischen Gewächse des Kantons Zürich" 1829; Jäggis Aufsatz : „Eglisau in botanischer Beziehung" in: Taschen- buch für Eglisau, Zürich bei S. Höhr 1883; R. Kellers Flora von Winterthur I. (1891); Hegis floristische und pflanzengeographische Arbeit über das Zürcher Oberland (Bull. Herb. Boiss., 1902) und andere kleinere Publikationen, die sich teilweise auf unser Gebiet beziehen; ferner handschriftliche Verzeichnisse der Herren Baumann, Hanhart, Meister, Dr. Forrer, Dr. Volkart, Lehrer Bosshard etc. ; endlich mündliche und schriftliche Mitteilungen der Herren Prof. Dr, H. Schinz, Prof. Dr. C. Schiröter, Dr. M. Rikli. Zu Dank verpflichtet sind wir ausserdem den Direktoren der botan. -

Der Wettbewerb Gross-Zürich Ideen Neuzeitlichen Städtebaus Im Zürich Der 1910Er Jahre
Wahlfacharbeit Der Wettbewerb Gross-Zürich Ideen neuzeitlichen Städtebaus im Zürich der 1910er Jahre David Brunner Deborah Fehlmann Hönggerstrasse 138 Hohlstrasse 333 8037 Zürich 8004 Zürich ETH Zürich Institut für Geschichte und Theorie der Architektur gta Professur für Geschichte des Städtebaus Prof. Dr. Ing. Vittorio Magnago Lampugnani betreut durch Harald Robert Stühlinger eingereicht im Mai 2013 Inhalt Vorwort und Fragestellung 1 1 Vorgeschichte 3 1.1 Zürich von 1830 bis 1910 3 1.2 Wege zum "neuzeitlichen Städtebau" 5 2 Der Wettbewerb Gross-Zürich - Ein Vergleich der drei Erstprämierten 8 2.1 Wie es zum Wettbewerb Gross-Zürich kam 8 2.2 Wettbewerbsprogramm: Anforderungen des neuzeitlichen Städtebaus 10 2.3 Zerlegung eines Ganzen: Analyse der Übersichtspläne 1:10'000 13 2.3.1 Ausgangslage und Fragestellung 13 2.3.2 Methodik 14 2.3.3 Nutzungsverteilung und bauliche Dichte 14 2.3.4 Grünräume und Gewässer 18 2.3.5 Verkehrssysteme 25 2.4 Die neue Rolle der alten Stadt: Die City 27 2.4.1 Ausgangslage und Fragestellung 27 2.4.2 Methodik 27 2.4.3 Innerstädtische Verkehrsordnung 28 2.4.4 Architektur der Repräsentation 43 2.5 Zusammenfassende Bemerkungen 49 3 Die Zeit nach dem Wettbewerb 51 3.1 Auswirkungen auf das gebaute Gross-Zürich in der Zwischenkriegszeit 51 3.2 Einfluss auf die Disziplin des Städtebaus in der Schweiz 56 4 Quellenverzeichnis 57 4.1 Literatur 57 4.2 Archivquellen 57 Anhang I - III: Kopien der Allgemeinen Übersichtspläne im Massstab 1:25'000 IV - VI: Überzeichnungen der allgemeinen Übersichtspläne im Massstab 1:60'000 VII: Arbeitsmaterial Vorwort und Fragestellung Die Industrialisierung bescherte den grossen Städten Europas sowie Amerikas in der zweiten Hälfte des 19.