Stadtarchiv Zürich
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Stadtbäche – Entdecken Sie Zürichs Grüne Oasen. Bachspaziergänge
1 Stadtbäche – entdecken Sie Zürichs grüne Oasen. Bachspaziergänge Jahre Bachkonzept 25 der Stadt Zürich 2 Gemeinsam für die saubere Zuk unft von Zürich Unser Engagement dient dem Schutz des Wasserkreislaufs. Wir pflegen das Entwässerungsnetz der Stadt Zürich, leiten das Abwasser rasch und sicher ins Klärwerk Werd- hölzli, reinigen es und geben das saubere Wasser der Limmat zurück. Wir sorgen dafür, dass sich die Menschen in der Stadt Zürich wohl und sicher fühlen: Indem wir zu jeder Jahreszeit Strassen und Park- anlagen reinigen, den Abfall aus Containern und Sammelstellen ent- sorgen und uns um Zürichs Bäche und den See kümmern. 3 Gemeinsam für die saubere Zuk unft von Zürich Dank unserem Einsatz können wir der Stadt mit Zürich Wärme die beste Heizenergie bieten: Sie ist bis zu 80 Prozent CO2-neutral und trotzdem günstig. So kann die Stadtbevölkerung einheimische Wärme geniessen, gleichzeitig das Klima schonen und Geld sparen. 4 Seite Bachkonzept Stadt Zürich – 25 Jahre Erfolgsgeschichte 6 Friesenbergbach 8 Dorfbach Albisrieden 16 Holderbach 24 Wehrenbach 32 Bombach 42 Hochwasserschutz für Natur und Bevölkerung 48 Neophyten – Exkurs Problempflanzen 50 Impressum 51 Jahre Bachkonzept 25 der Stadt Zürich 5 Natur ganz nah für Jung und Alt Seit 25 Jahren bringt ERZ Entsorgung + Recycling Zürich verborgene natürliche Gewässer zurück ins Stadtbild und schafft damit Oasen der Erholung. Denn viele von Zürichs Bächen waren wegen des Baubooms in der Stadt ab Ende des 19. Jahrhunderts unter Überbauungen und Verkehrswege verlegt worden. 18 Kilometer in Röhren verborgene Bachläufe hat ERZ wieder ans Tageslicht geführt und rund 3 Kilometer bestehende Bäche in den vergangenen 25 Jahren renaturiert. -

Kanton Zürich Gratis Zum Mitnehmen
swissportrait WWW.BESTOFZUERICH.COM | AUSGABE 2/2018 BEST OF KANTON ZÜRICH GRATIS ZUM MITNEHMEN Bligg Seite 9 Peter Pfändler Seite 17 Seite 97 Peter Marvey Foto: Aura.ch © Schweizerisches Nationalmuseum ENERGIE DURCH LEIDENSCHAFT ELEKTROINSTALLATIONEN AG REAKTIONSSCHNELL, AUSDAUERND UND FOKUSSIERT IN UNSEREN DISZIPLINEN... ELEKTROINSTALLATIONEN NETZWERKINSTALLATIONEN Service, Unterhalt und Renovationen Verlegen und anschliessen aller Netzwerkarten TELEMATIK GEBÄUDEAUTOMATION Vernetzen aller Kommunikationssysteme Neuinstallation und Unterhalt von Gebäudeautomationssystemen (KNX) Brem + Schwarz AG · Baslerstrasse 125 · 8048 Zürich · Tel. 044 438 62 32 · [email protected] · www.brem-schwarz.ch «So isch Züri.» Zürich ist grossartig. Eine perfekte Stadt zum Leben, Arbeiten oder Ferien machen. Ich bin seit mehr als 15 Jahren in der Stadt Zürich zu Hause. Ich liebe die zentrale Lage, den See und den Kontrast zwischen pittoresker Altstadt und modernen Quartieren. Immer wieder entdecke ich neue Kulturveranstaltungen und neue Aus- flugsziele. Das Angebot ist gross und strahlt weit über die Stadtgrenzen hinaus. Ich wünsche mir, dass Zürich in den Gastronomisch hat Zürich sehr viel zu bieten. Das riesige Restaurant- nächsten Jahrzehnten weiterhin einen Angebot reicht vom Gourmet-Tempel über historische Traditionshäu- der obersten Ränge der Mercer-Studie ser bis zu temporären Einrichtungen in stillgelegten Fabrikhallen. Aktuelle Themen wie Fair Trade, Bio und Food Waste werden von zur Lebensqualität belegt. Zürcher Gastronomen aufgenommen und umgesetzt. Regionalität, Frische und Nachhaltigkeit ist den Zürcherinnen und Zürchern immer wichtiger. Gourmands und Feinschmecker aus aller Welt fi nden in Zürich ein Restaurant, das ihre Leibspeise zubereitet. Ich geniesse gerne den Zürcher Klassiker, das traditionelle Fleischgericht Zürcher Als Stadtrat und Vorsteher des Stadtzürcher Gesundheits- und Um- Kalbsgeschnetzeltes mit Rösti. -

Stadt Zürich | Zurich City
Stadt Zürich | Zurich City Zürich Tarifzone 110 Flughafen 111 121 Fare zone 110 REGENSDORF S5 10 111 Glattbrugg 762 116 768 Halden 764 12 S16 KATZENSEE 110 Im Ebnet Bhf. Lätten- 115 162 Zentrumwiesen 161 Käshaldenstr. S2 114 Birch-| 113 124 160 Köschenrüti Glatttalstr. Post 118 163 Leimgrübelstr. 123 Schönauring Ausser- 112 dorfstr. 120 164 S6 Mühlacker 117 742 Ettenfeld 761 S7 761 Bärenbohlstr.UnteraffolternSchwandenholzWaidhof Frohbühl- 111 170 37 121 122 171 str. Bhf. Opfikon Chrüzächer Holzerhurd Seebach 184 Friedhof OPFIKON 154 110 130 135 172 32 Schwandenholz Buhnstr. Hertenstein- 131 Aspholz 29 str. Lindbergh- Giebeleichstr. 140 173 Fronwald Staudenbühl platz 155 132 Blumen- 75 150 142 133 feldstr. 141 Bahnhof 143 134 111 Lindbergh-Allee 156 491 61 768 151 Hungerbergstr. Affoltern Stierenried 180 Himmeri Chavez-Allee 152 Seebacherplatz Glattpark 182 183 154 62 Hürstholz 29 Wright-Strasse 153 181 Zehntenhausplatz 75 Bhf. Seebach 61 S6 Fernsehstudio Einfangstr.Glaubtenstr. 64 12 ENGSTRINGEN Neun- Felsenrain- 111 110 Maillart- brunnen Kehricht- Grünwald str. str. 11 Bollinger- verbrennung Schauen- 32 berg weg Bhf. Oerlikerhus Orionstr. Mötteliweg 14 Heizenholz Oerlikon Leutschen- Auzelg Lerchenhalde Riedbach Rütihof weg Nord bach WALLISELLEN Lerchen- 62 Chalet- 75 781 rain Hagenholz 79 Herti Belair Giblenstr. Schumacher- Auzelg Ost 46 weg Glaubten- 80 Bahnhof Geeringstr. 485 Schützenhaus str. Süd Bhf. Wallisellen Höngg Birchstr. 80 Oerlikon S8 S14 Riedhofstr. Neu- Platz 61 Ost 37 Oberwiesen-Max-Bill- S8 Friedhof str. Hallenbad RiedgrabenSaatlenstr.Dreispitz Aubrücke 89 affoltern Hönggerberg Bahnhof 94 Oerlikon 94 Flora- 308 40 Oerlikon str. 63 Schürgi- 304 Michelstr. Althoos Frankental ETH 11 str. 110 121 Segantinistr.Singlistr. Hönggerberg Messe|Hallenstadion Wiesler- Maienweg 62 63 Luchs- Herzogenmühlestr. -

Schifffahrt Titelbild Umschlag: Kursschiff Auf Der Fahrt Nach Horgen, 2011
Horgner Jahrheft 2012 Schifffahrt Titelbild Umschlag: Kursschiff auf der Fahrt nach Horgen, 2011. Horgner Jahrheft 2012 Inhalt Schifffahrt Seite Vorwort 3 Theo Leuthold Die Verkehrsschifffahrt 5 Andrea Mader Schiffswartehallen am Zürichsee 14 Andrea Mader Zürichseekapitän Ernst Rimensberger 26 James J. Frei Die «schwimmende Brücke» über den Zürichsee 30 Die Crew auf dem Fährschiff Die Leute im Hintergrund Albert Caflisch Bootsplätze 36 Monika Neidhart Max Bachmann: Mit «Pollan» unterwegs 40 Hans Erdin Die Kreuzerpokal-Regatta 43 Doris Klee Flugtag 1921 in Horgen 46 Doris Klee Horgen im Jahr 2011 48 Chronik, Sportlerehrungen und Bevölkerungsstatistik Marianne Sidler und Albert Caflisch Bibliografie, Bildnachweis und Impressum 56 Die Redaktionskommission (von links nach rechts): Hans Erdin, Monika Neidhart, James J. Frei, Doris Klee, Albert Caflisch, Marianne Sidler und Theo Leuthold. Vorwort Schifffahrt – auch für Horgen von Bedeutung Liebe Leserinnen, liebe Leser Einmal mehr halten Sie das neue Jahrheft in Händen, und schon das Titelbild versetzt uns in eine besondere Stimmung. Der Raddampfer, der auf uns zufährt, lädt uns ein, ins neue Jahrheft einzutauchen. Heute ist es die Seesicht, die unsere Gemeinde zu einer höchst begehrten Wohnlage macht; früher war es der See, der als Verkehrsachse von grosser Bedeutung war. Wer die Geschichte von Horgen etwas genauer verfolgt, der weiss natürlich, dass unser Ortsmuseum – die Sust – ehemaliger Warenumschlagplatz war und wesentlich zur Entwicklung von Horgen beigetragen hat. Wir müssen aber gar nicht so weit zurück- blicken. Schlagen Sie das Jahrheft auf Seite 17 auf und bewundern Sie unseren Bahnhofplatz samt «Minischiffsteg», wie er sich vor gut 100 Jah- ren präsentiert hat – er hätte auch einen Preis verdient. -

Stadtarchiv Zürich
Stadtarchiv Zürich Stadtarchiv Zürich Jahresbericht 2009 /2010 Haus zum Untern Rech, Neumarkt 4, CH-8001 Zürich Telefon +41 (0)44 266 86 46 Telefax +41 (0)44 266 86 49 /2010 E-Mail-Adresse: [email protected] Internet-Adresse: www.stadt-zuerich.ch/stadtarchiv Öffnungszeiten des Lesesaals (3. Stock): Dienstag bis Freitag von 0800 bis 1700 Uhr (über Mittag 1200 bis 1300 Uhr keine Fachauskünfte) Vorausbestellungen von Büchern und Archivalien sind er- wünscht Bücher- und Aktenbestellungen vom Archivlager am Neu- markt werden ausgeführt: 0830, 0930, 1030, 1130, 1330, 1430, 1530 Uhr Aktenbestellungen aus Aussenlagern: Vorausbestellungen Jahresbericht 2009 bis Mittwochabend auf Dienstag folgender Woche Das Stadtarchiv Zürich ist eine Abteilung des Präsidialdepartements der Stadt Zürich Stadtarchiv Zürich Stadtarchiv STADTARCHIV ZÜRICH JAHRESBERICHT 2009 /2010 1 Herausgeberin Stadt Zürich Stadtarchiv Zürich Haus zum Untern Rech Neumarkt 4 CH-8001 Zürich [email protected] Redaktion Anna Pia Maissen, Max Schultheiss Text Anna Pia Maissen, Max Schultheiss, Karin Beck, Nicola Behrens, Christian Casanova, Robert Dünki, Roger Peter, Halina Pichit, Kerstin Seidel, Caroline Senn Lektorat Andrea Linsmayer, Max Schultheiss, Anna Pia Maissen Layout Mario Florin, Zürich Druck Staffel Druck, Zürich Auflage 1000 Exemplare Preis CHF 10.–; ältere Jahresberichte gratis solange Vorrat © Stadtarchiv Zürich 2011 Bild Umschlag vorne Firmenprospekt der Mechanischen Papierfabrik an der Sihl für «Fein Post Papier» (undatiert). 2 INHALT Einleitung 5 Personal -

Swiss: 1,600 Kilometres Long, It Spans Four 4 /XJDQR࣠±࣠=HUPDWW Linguistic Regions, Five Alpine Passes, P
mySwitzerland #INLOVEWITHSWITZERLAND GRAND TOUR The road trip through Switzerland Whether you’re travelling by car or by motorcycle – mountain pass roads like the Tremola are one of the highlights of the Grand Tour of Switzerland. Switzerland in 10 stages Marvel at the sunrise over the 1 =XULFK࣠±࣠$SSHQ]HOO Matterhorn at least once in your lifetime. p. 12 Don’t miss wandering through the vine- yards of the winemaking villages of the 2 $SSHQ]HOO࣠±࣠6W0RULW] Lavaux. Or conquering the cobblestoned p. 15 Tremola on the south side of the Gotthard Pass. The Grand Tour of Switzerland is a 3 6W0RULW]࣠±࣠/XJDQR magnificent holiday and driving experi- p. 20 ence – and a concentration of all things Swiss: 1,600 kilometres long, it spans four 4 /XJDQR࣠±࣠=HUPDWW linguistic regions, five Alpine passes, p. 24 12 UNESCO World Heritage Properties and 22 stunning lakes. MySwitzerland is happy 5 =HUPDWW࣠±࣠/DXVDQQH to present a selection of highlights from p. 30 10 fascinating stages. Have fun exploring! 6 *HQHYD±࣠1HXFKkWHO p. 32 7 Basel 7 ࣠±࣠1HXFKkWHO 1 2 p. 35 10 8 9 8 1HXFKkWHO࣠±࣠%HUQ p. 40 3 9 %HUQ࣠±࣠/XFHUQH 6 5 4 p. 42 10 /XFHUQH±࣠=XULFK You will find a map of the Grand Tour at the back of the magazine. For more information, p. 46 please see MySwitzerland.com/grandtour 3 Grand Tour: people and events JUST LIKE OLD FRIENDS The Grand Tour of Switzerland is a journey of sights and discoveries. You will meet many different people along the tour, and thus enjoy the most enriching of experiences. -

WAGNER Die Walküre
660172-74 bk Walküre US 17/7/06 10:28 Page 16 3 CDs Recorded at the Staatsoper Stuttgart, Germany, WAGNER on 29th September 2002 and 2nd January 2003. General Director: Prof. Klaus Zehelein Die Walküre Executive Producers: Dr Reinhard Ermen (SWR Radio), Gambill • Jun • Rootering • Denoke • Behle • Vaughn Dr Dietrich Mack (SWR TV) and Paul Smaczny (EuroArts) Staatsoper Stuttgart • Staatsorchester Stuttgart Producer: Thomas Angelkorte Editor: Irmgard Bauer Lothar Zagrosek Engineers: Brigitte Hermann and Karl-Heinz Runde This performance of Die Walküre is the second part of Wagner’s Ring cycle recorded live during Stuttgart Opera’s 2002/2003 season. For the first time in the history of the Ring cycle each of the four operas was staged with separate producers and casts. A production of EuroArts Music International GmbH and Südwestrundfunk in co-operation with ARTE Gefördert von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg 8.660172-74 16 660172-74 bk Walküre US 17/7/06 10:28 Page 2 Die Walküre Stuttgart Staatsorchester (The Valkyrie) Established in 1589 as the Court Orchestra of Württemberg, the Württemberg Stuttgart State Orchestra has a history The First Day of over four hundred years. Over the generations there have been collaborations with musicians of distinction, among them Leonhard Lechner, the Frobergers, Niccolò Jommelli, Johann Rudolf Zumsteeg, Konradin Kreutzer, of Johann Nepomuk Hummel and Carl Maria von Weber. Berlioz praised the orchestra, when he appeared with it as Der Ring des Nibelungen conductor, and in the 1880s Stuttgart was one of the first to stage the complete Ring cycle, conducted by the then (The Ring of the Nibelung) General Music Director Herman Zumpe, who had assisted Wagner at the first Bayreuth Festival. -

Zürich Card» Gratis
Schöne Aussichten! EINZIGARTIGES S-Bahnen, Busse und Schiffe ERLEBNIS Rotenflue ob Schwyz FÜR DIE GANZE Dein S-Bahn trains, buses and boats FAMILIE Zurich Erlebnisflughafen. Thayngen thalen Herblingen l Feuer Schaffhausen Langwiesen by lake. hlatt arinenta Sc Neuhausen Kath Neuhausen Rheinfall St. Kleine Rundfahrt (1. 5 h) – DiessenhofenhlattingenStein am Rhein Sc WWW.HOELLGROTTEN.CH mit der «Zürich Card» gratis. Schloss Laufen Etzwilen Oder Sie leisten sich etwas am Rheinfall Stammheim Exklusives: einen Abend Region Zürichsee Jestetten (D) Dachsen Region Zug auf unseren Traumschiffen. S9 Marthalen www.rotenfluebahn.ch Vielfältige Naturlandschaften Lottstetten (D) Ossingen Naherholungsziel Zug www. zsg.ch Rund um den Zürichsee erleben Sportler, Geniesser und rf h Rafz S29 Zug begeistert durch vorzügliche Restaurants, historische ac n Andelfingen Entdecker eine vielfältige Naturlandschaft. Wassersport, z on on AG S8 Gebäude und ein vielseitiges Kulturangebot. Durch die ein- RUNDum mehr erleben Erholung an grünen Seeufern, regionale Kulinarik, Famili- blen blenz Do malige Landschaft mit zwei Seen ist Zug ein beliebtes Waldshut Ko Ko Rietheim Bad Zurz Rekingen AGMellik Rümik KaiserstuhlZweidle AG Hüntwangen Thalheim-Altikon S30 Inserat Regionenkarte.indd 1 02.12.2016 10:30:46 enaktivitäten oder einzigartige Festivals mit Seeblick: Die Weinfelden Naherholungsziel. Henggart Dinhard im Winter und im Sommer! Region um den Zürichsee hält für jeden etwas bereit. S41 Eglisau Märstetten S19 Müllheim-Wigoltingen Klingnau -Wil Seuzach Altstadt und Design Beliebtes Ausflugsziel Glattfelden Hüttlingen-Mettendorf Ein Rundgang durch die malerische Altstadt führt zum Hettlingen S12 Hier wird gebadet, im Boot oder auf dem Pedalo der See Felben-Wellhausen Zuger Wahrzeichen, dem «Zytturm», der kostenlos begeh- Döttingen S24 Reutlingen erkundet, und lauschige Plätzchen wie die Insel Lützelau s Frauenfeld bar ist. -

Johannes Brahms the Symphonies
G010002682211D BRAHMS SYMPHONIES 1–4 Johannes Brahms · Caricature by Otto Boehler · © Lebrecht Music & Arts TONHALLE ORCHESTRA ZURICH P & © 2011 Sony Music Entertainment (Switzerland) GmbH www.sonymusicclassical.ch DAVID ZINMAN Sinfonie Nr. 3 F-Dur op. 90 JOHANNES BRAHMS Symphony No. 3 in F major · 3e Symphonie en fa majeur 1–4 (1833–1897) 9 I. Allegro con brio 13.11 SYMPHONIES 10 II. Andante 7.57 11 III. Poco allegretto 6.15 12 IV. Allegro 8.51 1 68 Sinfonie Nr. c-Moll op. 4 98 Symphony No. 1 in C minor · 1ère Symphonie en ut mineur Sinfonie Nr. e-Moll op. Symphony No. 4 in E minor · 4e Symphonie en mi mineur 1 I. Un poco sostenuto – Allegro 15.24 2 II. Andante sostenuto 8.37 13 I. Allegro non troppo 12.41 3 III. Un poco allegretto e grazioso – Trio 4.26 14 II. Andante moderato 10.44 4 IV. Finale: Adagio – Più Andante – Allegro non troppo 15 III. Allegro giocoso – Poco meno presto – Tempo I 6.10 ma con brio - Più Allegro 16.30 16 IV. Allegro energico e passionato. Più allegro 9.42 Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73 TONHALLE ORCHESTRA ZURICH Symphony No. 2 in D major · 2e Symphonie en ré majeur 5 I. Allegro non troppo 20.37 DAVID ZINMAN 6 II. Adagio non troppo 10.11 Recorded: 14, 15 April 2010, Tonhalle Zurich, Switzerland · LIVE Recording 7 III. Allegretto grazioso (quasi andantino) – Executive Producer: Elmar Weingarten · Recording Producer: Chris Hazell Sound Engineer & Editing: Simon Eadon · Assistant Engineer: Will Brown · CD Mastering: Abbas Records Presto ma non assai 5.08 Cover and booklet design: Christine Schweitzer, Cologne 8 IV. -

Viel Natur, Tolle Ausblicke Natur, Tolle Viel Bietet – Je Nach Saison – Eine Schiffs –Eine Saison Nach –Je Bietet Einmal Hinauf
o Schulreisen in den Kanton Zürich Kurz vor dem Etappenziel Pfannenstiel: Ein toller Ausblick eröffnet sich Richtung Osten. Viel Natur, tolle Ausblicke Pfannenstiel. Eine abwechslungsreiche S-Bahnen bis «Zürich Stadelhofen». Un- tung Meilen. Wo der Jakob-Ess-Weg Wanderung hinauf und hinunter bietet mittelbar vor dem Bahnhof Stadelhofen nach links abzweigt, hält man rechts und die dreistündige Tour zwischen Forch fährt die rote S-Bahn Richtung Forch und kommt durch das Naturreservat Rappen- und Meilen, die über den Pfannenstiel Esslingen. Die Fahrt bis zur Station Forch tobel in den Weiler Toggwil, zu dem auch führt. dauert etwa zwanzig Minuten, schnell das Restaurant Alpenblick gehört. Einmal wird die Szenerie ländlich. Von der Sta- die Strasse überqueren und dann würde Uetliberg, Etzel, Bachtel, Adlisberg, Lä- tion Forch aus folgt man dem Wanderweg ein abenteuerliches Stück Weg beginnen: gern – wer gerne etwas höher hinaus will, über den bäuerlichen Weiler Chaltenstein Derjenige durch das Meilemer Tobel. Auf kann dies rund um Zürich problemlos Richtung Pfannenstiel. Der Weg führt zu www.wegwandern.ch ist dazu zu lesen: tun. Auch der Pfannenstiel ist einer der Beginn auf asphaltierten Strassen, aber «Ein schattiger, abwechslungsreicher Bergrücken im Kanton Zürich, der zwi- bald schon erreicht man den Waldrand, Tobelweg schlängelt sich dem Bach ent- schen Meilen und Egg liegt mit einer wo nach wenigen Metern zwei Wegweiser lang und an vielen Findlingen, umge- Höhe von max. 853 m ü. M. Der Pfannen- Richtung Pfannenstiel zeigen: Es lohnt stürzten Bäumen, ausgehölten Felsplat- stiel, dessen Name mal mit ie, mal nur sich, denjenigen über den Weiler Gulde- ten, Steinen, Wasserfällen vorbei, mit mit i geschrieben wird und der wahr- nen zu wählen, denn dieser ist an einem lauschigen Plätzchen am Bachufer, eine scheinlich von der Geländeform inspiriert kleinen, idyllischen Moorfeld gelegen. -

Arboretum Zürich Oststaaten USA Kanada
Arboretum Zürich Oststaaten USA Kanada Analyse und Empfehlungen ZHAW IUNR :: URBAN FORESTRY :: UI16 :: 11.01.2019 :: FACHKORREKTOREN: A. HEINRICH, A.SALUZ AUTOREN: O.BACHMANN, P.HELLER, L.JENAL, L.OTT -02 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 03 1.2 Zielsetzung 03 2 Analyse 04 2.1 Standort 04 2.2 Klima 05 2.3 Wurzelraum 06 2.4 Boden 06 2.5 Wasserhaushalt 06 2.6 Lichtverhältnisse 07 2.7 Nutzungsdruck 08 2.8 Weitere Umwelteinflüsse 08 3 Ausgangslage 09 3.1 Situationsplan 09 3.2 Baumbeurteilung 11 4 Sanierung 13 4.1 Konzept 20 4.2 Unterpflanzung 21 4.3 Kosten 24 5 Diskussion 26 6 Verzeichnisse 27 7 Anhang 29 -03 1 Einleitung Urbane Räume stellen Extrembedingungen für Vegetation 1.1 Arboretum jeglicher Art dar. Hohe Schadstoffbelastungen, Salzeinträge, Das Arboretum ist ein Teil der Quaianlagen der Stadt Zürich. erhöhte Durchschnittstemperaturen, Trockenheit, unge- Gegen die Stadt wird es abgegrenzt durch den General- nügend grosser Wurzelraum sowie zahlreiche bau- und Guisan- und den Mythenquai, heute zwei stark frequentierte sicherheitstechnische Vorgaben führen in ihrer Gesamtheit Autostrassen. Die Idee, ein Teil der Quaianlagen zu einem dazu, dass die bestehende grüne Infrastruktur unter Arboretum auszugestalten, stammte von Dozierenden der enormem Druck steht und neue Pflanzungen immer öfter ETH, welche sich eine nach wissenschaftlichen Aspekten versagen. Trotzdem sind Grünstrukturen, insbesondere gestaltete Sammlung von Bäumen aus verschiedenen Stadtbäume und -parks, von essentieller Bedeutung für pflanzengeographischen, systematischen, und pflanzen- den urbanen Raum. Sie erbringen überlebensnotwendige geschichtlichen Bereichen wünschten (Schleich, 1986). Ökosystemdienstleistungen. Darunter zu verstehen sind Das Arboretum konnte 1885 eingeweiht werden. Von den beispielsweise die Bindung von CO2 und die damit anfänglich 750 gepflanzten Bäumen starben zwei Drittel einhergehende Sauerstoffproduktion, Kühlung des Aussen- und ein Drittel hat heute das natürliche Alter erreicht. -
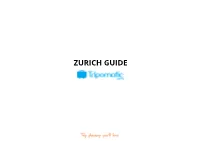
Zurich Guide Zurich Guide Money
ZURICH GUIDE ZURICH GUIDE MONEY Money can be best exchanged at railway station Essential Information kiosks and in the banks (they charge a commis- Money 3 sion fee). Traveler’s checks are up for a slightly better exchange rate. ATMs are abundant and Communication 4 Everyone knows Lake Zurich, Swiss watches also offer great exchange rates. and chocolate, but there’s so much more to Holidays 5 Zurich. As well as being the main cultural hub Switzerland is significantly more cash-oriented than other countries, however cards are accepted Transportation 6 of the German-speaking part of the Switzer- land, it is a leading financial center with one of in large stores; the most popular ones being Visa Food 8 the world’s most important stock exchanges. and Mastercard – always check the stickers on the The wealthy city is not afraid to show off its door of the store for those card accepted. ATMs Events During The Year 9 prosperity – there are majestic and almost lav- are readily available almost everywhere. ish buildings, ornate mansions and streets full 10 Things to do of luxurious shops and boutiques. Prices Zurich also has plenty to offer culture-lovers. Meal, inexpensive restaurant – 20 CHF DOs and DO NOTs 11 There are many amazing museums and gal- Meal for 2, mid-range restaurant, three-courses- Activities 13 leries showcasing renowned historical artworks 100 CHF as well as new and emerging contemporary Combo Meal at McDonalds – 12 CHF . artists. Fans of theatre and music will have Bottle of water at supermarket – 1 CHF hard time making an itinerary too – there are Domestic beer (0.5 liter, draught) – 6 CHF so many cultural events of all genres taking Cappuccino – 4.50 CHF place every night.