Readingsample
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

PRESSEMITTEILUNG WAS Neue Ausstellung „Peter Suhrkamp. Lebenswege“ WANN 20. November 2016 Bis 5. Februar 2017 Eröffnung
PRESSEMITTEILUNG WAS Neue Ausstellung „Peter Suhrkamp. Lebenswege“ WANN 20. November 2016 bis 5. Februar 2017 Eröffnung am 20. November um 16 Uhr WO Galerie im Park am Klinikum Bremen- Ost Klinikum Bremen-Ost gGmbH Am Krieg zerbrochen Züricher Str. 40 28325 Bremen Galerie im Park zeigt Ausstellung über den Verleger Peter Suhrkamp „Ich hatte den Krieg an schwersten Stellen und in exponierten Lagen mitgemacht, war 1918 völlig an ihm zerbrochen Telefon gewesen. Kurz gesagt: er hatte mich ins Irrenhaus gebracht“. Peter Suhrkamp 0421/408-1757 Der Verleger Peter Suhrkamp zählte zu den bedeutendsten Persönlichkeiten im Telefax deutschen Verlagsleben. Er legte die Grundlagen für die legendäre „Suhrkamp-Kultur“0421/408 -2898 mit herausragenden Autoren wie Bertolt Brecht, Max Frisch und Hermann Hesse. Aber wie sah sein persönlicher Lebensweg aus? Dieser Frage geht die Wanderausstellung Kultur@ „Peter Suhrkamp. Lebenswege“ zu Suhrkamps 125. Geburtstag nach, die ab dem 20 . klinikum-bremen-ost.de November Station in der Galerie im Park am Klinikum Bremen-Ost macht. Die Ausstellung wird an Orten gezeigt, die in Suhrkamps Leben eine prägende Rolle spielten. „Aber nur wenige wissen, dass dazu auch das damalige St.-Jürgen-Asyl und heutige Klinikum Bremen-Ost gehörte“, sagt Achim Tischer, Leiter der KulturAmbulanz. Hier sei der traumatisierte Soldat Suhrkmap1918 behandelt worden. Bis zum 5. Februar 2017 zeigt die Galerie im Park diese wechselvolle Lebensgeschichte Suhrkamps zwischen dem Kaiserreich, Nationalsozialismus und Nachkriegsdeutschland. Zur Eröffnung am 20. November um 16 Uhr wird nicht nur die Kuratorin Etta Bengen sprechen, sondern auch die Enkelin Raphaela Suhrkamp. Außerdem liest der Bremer Schauspieler Rainer Iwersen Texte von Peter Suhrkamp. -

Lebenswege Z L O H R E T Wanderausstellung Zum S O 125
Veranstalter KulturAmbulanz • Züricher Str. 40 • 28325 Bremen Telefon: 0421/408-1757 • [email protected] Die KulturAmbulanz ist eine Einrichtung der Gesundheit Nord Öffnungszeiten Krankenhaus-Museum/Galerie im Park Mi – So 11:00 – 18:00 Uhr • Eintritt: 4,-/2,- € Ausstellungsorte Rathaus Hatten (3.4. - 15.5.2016), Eisenhütte (4.6. - 24.8.2016), Landesbibliothek Oldenburg (9.9. - 12.11.2016), Krankenhaus-Museum Bremen (20.11. 2016 - 5.2. 2017), Sylter Heimatmuseum (in Planung) Projektträger Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde e.V. Mit freundlicher Unterstützung von EWE, oldenburgische Landschaft, LzO, Suhrkamp, Eisen- hütte, Gemeinde Hatten, LB Oldenburg, Landkreis Ammerland, Landkreis Oldenburg, Heimatverein Kirchhatten Haltestelle Graubündener Straße Straßenbahnlinie 1 Züric her Straß e Haltestelle Buslinie 25 Peter Suhrkamp (1891 – 1959) e Haltestelle ß a r Poggenburg t s Haltestelle d Buslinien n a Buslinie 37 L 33, 34 r Klinikum Bremen-Ost e LEBENSWEGE z l o h r e t Wanderausstellung zum s O 125. Geburtstag Peter Suhrkamp, 1949 Oster holzer Heerstraße (Foto Englert, Suhrkamp-Verlags-Archiv) 20. November 2016 – 5. Februar 2017 Mi – So 11.00 – 18.00 Uhr facebook.de/KulturAmbulanz Galerie im Park Titel: Peter Suhrkamp, 1949 (Suhrkamp-Verlags-Archiv) www.kulturambulanz.de www.kulturambulanz.de Peter Suhrkamp (1891 - 1959) Wer war Peter Suhrkamp? Veranstaltungen Der Erste Weltkrieg, in den der junge Suhrkamp als Freiwil- So 20.11.2016 ERöffNUNG MIT GÄSTEN LEBENSWEGE liger zog, hinterließ wie bei vielen anderen Kriegsteilnehmern 16.00 Uhr Peter Suhrkamp (1891 - 1959) – Lebenswege tiefe Wunden. Suhrkamp zerbrach an den Anstrengungen der Galerie im Park Es sprechen: Achim Tischer (KulturAmbulanz), Wanderausstellung zum 125. Geburtstag Grabenkämpfe und wurde 1918 nach erfolglosen Sanatori- Eintritt frei Etta Bengen (Kuratorin), Raphaela Suhrkamp 20. -

Print Version
Deutsche Biographie – Onlinefassung NDB-Artikel Suhrkamp, Peter (eigentlich Johann Heinrich) Verleger, Schriftsteller, * 28. 3. 1891 Kirchhatten (Oldenburg), † 31. 3. 1959 Frankfurt/Main, ⚰ Keitum (Sylt). (evangelisch) Genealogie Aus seit d. 16. Jh. im Oldenburgischen nachweisbarer Fam.; V →Johann Friedrich (1855–1932, Landwirt, Tischler in K.; M Elise Katharina Lange (1868–1959; 3 B, 2 Schw; – ⚭ 1) 1913 ⚮ 1918 Ida Plöger († 1918), Lehrerin in Wilhelmshaven, 2) 1919 ⚮ 1923 Irmgard Karoline Lehmann (* 1889), 3) 1923 ⚮ 1924 →Fanny Cleve (1893–1971), aus Ybbs/Donau, Opernsängerin (s. Gr. Sängerlex.), T d. →Adolf Löwy, Rabbiner, u. d. Theresa Freund, 4) 1935 Annemarie (Mirl) (1895–1959, ⚭ 1] →Anthony van Hoboken, 1887–1983, aus Rotterdam, Musikaliensammler u. Musikbibliograph, 1927 Gründer d. Archivs f. Photogramme musikal. Meister- Hss. b. d. Österr. Nat.bibl., seit 1938 in d. Schweiz, s. Schweizer Lex.; Hist. Lex. Wien), T d. →Hermann Seidel (1855–95 Freitod), aus sächs. Pfarrerfam., Dr. med., 1886–95 Inh. e. chirurg. Privatklinik in Braunschweig, seit 1892 Leiter d. hzgl. Krankenhauses ebd., 1894 Prof. (s. Pagel; Braunschweig. Biogr. Lex.), u. d. Emmy Loesevitz (1861–1945; 1 T aus 1) Ursula (1914–36), 1 S aus 2) Klaus Peter (* 1920); Schwagerin →Ina (Johanna Mathilde) Seidel (1885–1974, Schriftst. (s. NDB 24). Leben Als Ältester von sechs Geschwistern sollte S. nach dem Willen des Vaters den elterlichen Bauernhof in Kirchhatten übernehmen; als er dies verweigerte, mußte er 1905 den Hof verlassen. Er zog eine Lehramtsausbildung vor, besuchte das Oldenburger Lehrerseminar 1905–11 und nahm schon vor Ende der Ausbildung Lehrerstellen in Augustfehn und Idafehn an. 1914 legte er in Bremerhaven das Staatsexamen als Volksschullehrer ab und holte im selben Jahr sein Abitur als Externer am Realgymnasium in Bremen nach. -

On the Epistolary Exchange Between Gershom Scholem and Siegfried Unseld Liliane Weissberga a University of Pennsylvania Published Online: 30 Sep 2014
This article was downloaded by: [Eastman Dental Institute] On: 10 August 2015, At: 12:39 Publisher: Routledge Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: 5 Howick Place, London, SW1P 1WG The Germanic Review: Literature, Culture, Theory Publication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.tandfonline.com/loi/vger20 Scenes from a Friendship: On the Epistolary Exchange between Gershom Scholem and Siegfried Unseld Liliane Weissberga a University of Pennsylvania Published online: 30 Sep 2014. Click for updates To cite this article: Liliane Weissberg (2014) Scenes from a Friendship: On the Epistolary Exchange between Gershom Scholem and Siegfried Unseld, The Germanic Review: Literature, Culture, Theory, 89:3, 334-340, DOI: 10.1080/00168890.2014.932201 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00168890.2014.932201 PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE Taylor & Francis makes every effort to ensure the accuracy of all the information (the “Content”) contained in the publications on our platform. However, Taylor & Francis, our agents, and our licensors make no representations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness, or suitability for any purpose of the Content. Any opinions and views expressed in this publication are the opinions and views of the authors, and are not the views of or endorsed by Taylor & Francis. The accuracy of the Content should not be relied upon and should be independently verified with primary sources of information. Taylor and Francis shall not be liable for any losses, actions, claims, proceedings, demands, costs, expenses, damages, and other liabilities whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with, in relation to or arising out of the use of the Content. -

William Collins Donahue
William Collins Donahue 816 North St. Peter Street ● South Bend, IN 46617 Email: [email protected] Cell: 919.428.5829 Department of German & Russian Languages & Literatures University of Notre Dame ● 318 O’Shaughnessy Hall Notre Dame, IN 46556 ● 574.631.5572 Current Appointments University of Notre Dame: Director, Nanovic Institute for European Studies John J. Cavanaugh, C.S.C., Professor of the Humanities Professor of German Concurrent Professor of Film, Television, and Theatre Duke University Adjunct Professor of German Studies and Member of the Duke Graduate School Faculty (2015 – present) University of North Carolina – Chapel Hill: Member, Graduate School Faculty (2011 – present) Employment History University of Notre Dame: Chair, Department of German & Russian, July, 2015 – December, 2018 Fellow of the Nanovic Institute for European Studies, 2015-18 Duke University Bishop-MacDermott Family Professor of Germanic Languages & Literature (2013-15) Member, Bass Society of Fellows (2013-15) Chair, Department of Germanic Languages and Literature (2008 – 2014) Professor, Germanic Languages & Literature (2011-15) Professor, The Program in Literature (2011-15) Member of the Faculty of Jewish Studies (2006-15) and the Jewish Studies Executive Committee (2006—2014) Academic Director, Duke in Berlin (semester, year, and engineering programs; 2006- 15). Advising, Curriculum and Instructional Review, Program design, Personnel Review, Assessment. Duke Today story about Duke in Berlin press coverage in Berlin’s Der Tagesspiegel: http://today.duke.edu/2012/10/germancoverage Director and Founder, Duke-Rutgers Summer in Berlin (2006-15). Six week summer program. University of North Carolina – Chapel Hill: Member, Graduate School Faculty (2011 – present) Adjunct Professor of German Studies (2011-15) Adjunct Associate Professor of German Studies (2008–11). -

Biographisches Handbuch Zur Geschichte Des Landes Oldenburg
ein geregeltes Klassen- oder Kurssystem Suhrkamp, Johann Heinrich (genannt Pe unmöglich machte. S. dürfte lange Zeit ter), Verleger, * 28. 3. 1891 Kirchhatten, eine Art Einzelunterricht erteilt haben, der * 31. 3. 1959 Frankfurt a. M. zumindest den Vorteil hatte, daß dabei die In seinem Nachruf auf Peter S. schrieb unterschiedliche Vorbildung der Schüler Theodor W. Adorno 1959: „Selten fehlt der besser berücksichtigt werden konnte. De Hinweis darauf, daß er ein oldenburgi ren oft mangelhafte Grundkenntnisse ver- scher Bauer war. Er hat das weder ver anlaßten ihn, eine allen Knaben ab dem schwiegen noch viel Wesens daraus ge 10. Lebensjahr zugängliche Nebenschule macht; doch hätte er jederzeit den väterli einzurichten, an der Mathematik sowie die chen Hof übernehmen und führen können. für Seeleute notwendigen Fremdsprachen Aber wie sehr unterschied er sich von je gelehrt wurden. Trotz aller Bemühungen nen, die aus ihrem Bauernblut ein Ver S.s konnte unter diesen Bedingungen das dienst machen, für sich die Stimme des Ur Anspruchsniveau der Schule nicht beson sprungs beanspruchen. Er hat von seiner ders hoch sein und auch die Prüfungen Herkunft sich emanzipiert, sich standhaft entsprachen nicht den Anforderungen, die losgemacht, ohne die leiseste Konzession beispielsweise im benachbarten Bremen an die Ideologie von Blut und Boden ... In gestellt wurden. Die ständig steigenden einem schönen Prosastück, dessen Worte Ansprüche an das seemänische Personal lange Strecken von Schweigen mitkompo und die neuen Bremer Ausbildungsvor schriften führten schließlich dazu, daß die oldenburgische Regierung 1856 die pri vate Navigationsschule übernahm und von Grund auf umgestaltete. Der inzwischen 67jährige S. wurde bei dieser Gelegenheit in den Ruhestand versetzt, den er in Els fleth verbrachte. -
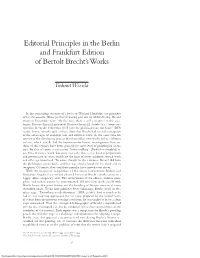
06 Wizisla 32-39
Editorial Principles in the Berlin and Frankfurt Edition of Bertolt Brecht’s Works Erdmut Wizisla In the concluding sentence of a letter to Wieland Herzfelde, the publisher of his Gesammelte Werke [collected works] put out by Malik-Verlag, Brecht wrote in December : “By the way, there is still a misprint in the cata- logue: Kuratier [kuratii] instead of Kuriatier [kuriatii]. Surely that’s been cor- rected in the book? Otherwise we’ll have the philologists on our backs” (BFA :). Ironic remarks such as these show that Brecht had no real conception of the advantages of academic text and editorial work. At the same time his interest in the developing process that formed his own works led to a lifetime archive, which actually laid the foundation for literary investigations. Few au- thors of this century have been granted the same level of philological atten- tion. By that of course is not meant “letter-sniffling” [Buchstabenschnüffelei], to use Elias Canetti’s word, but pure research, that is, the kind of preparation and presentation of texts, which are the basis of every academic textual work and often go unnoticed. To come straight to the outcome: Brecht did have the philologists on his back, and that was a lucky break for his work and its reception. Of course, they could occasionally have moved even closer. With the imminent completion of the Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, the involved editorial history of Brecht’s works comes to a happy, albeit temporary, end. The achievement of the editors, volume com- pilers, and readers cannot be overestimated. -
![Søren Dosenrode [Ed.]](https://docslib.b-cdn.net/cover/4920/s%C3%B8ren-dosenrode-ed-5184920.webp)
Søren Dosenrode [Ed.]
Søren Dosenrode [Ed.] Freedom of the Press On Censorship, Self-censorship, and Press Ethics Nomos Søren Dosenrode [Ed.] Freedom of the Press On Censorship, Self-censorship, and Press Ethics Nomos © Foto Cover: istockphoto.com Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Die Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data is available in the Internet at http://dnb.d-nb.de. ISBN 978-3-8329-5184-9 1. Auflage 2010 © Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2010. Printed in Germany. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier. This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically those of translation, reprinting, re-use of illustrations, broadcasting, reproduction by photocopying machine or similar means, and storage in data banks. Under § 54 of the German Copyright Law where copies are made for other than private use a fee is payable to »Verwertungsgesellschaft Wort«, Munich. Table of Contents Preface ............................................................................................ 7 Søren Dosenrode Section One Kaj Munk Chapter One: Approaching the Questions of Freedom of the Press, Censorship, Self-Censorship, and Press Ethics .................................... -

Germany's Cultural Ideology of Bildung
GERMANY’S CULTURAL IDEOLOGY OF BILDUNG 1870-1945 A dissertation submitted to Kent State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy by Hans-Henning Bunge August, 2015 © Copyright All rights reserved except for previously published materials. Dissertation written by Hans-Henning Bunge M.S. Lack Igenieur Schule, Germany M.A., Kent State University Ph.D., Kent State University, 2015 Approved by _________________________, History, Chair Doctoral Dissertation Committee Richard Steigmann-Gall _________________________, History, Member, Doctoral Committee Timothy Scarnecchia _________________________, University of Akron, Member, Doctoral Committee Shelley Baranowski _________________________, Geology, Member, Doctoral Committee Alison Smith _________________________, Graduate Faculty Representative Sue Ellen Wright Accepted by _________________________, Chair, Department of History Kenneth Bindas _________________________, Dean, College of Arts and Sciences James Blank TABLE OF CONTENTS LIST OF TABLES ...............................................................................................................v ACKNOWLEDGEMENTS ............................................................................................... vi Chapter Page INTRODUCTION ...............................................................................................................1 Purpose of Dissertation ..............................................................................................3 Existing Literature -

I Sofia Bach 28 May 2020 Hermann Hesse's Orient: Western Crisis and Eastern Redemption a Thesis Submitted to Fulfil Requireme
i Sofia Bach 28 May 2020 Hermann Hesse’s Orient: Western Crisis and Eastern Redemption A thesis submitted to fulfil requirements for the degree of Master of Philosophy Under the supervision of: Professor Peter Morgan Faculty of Arts and Social Sciences Department of European Studies School of Languages and Cultures The University of Sydney i Statement of originality This is to certify that to the best of my knowledge, the content of this thesis is my own work. This thesis has not been submitted for any degree or other purposes. I certify that the intellectual content of this thesis is the product of my own work and that all the assistance received in preparing this thesis and sources have been acknowledged. Translations by Sofia Bach unless otherwise indicated. ii Abstract The German-born Nobel-Laureate author Hermann Hesse enjoyed three major waves of popularity in the twentieth century. The first surge in reception took place in the Weimar Republic following the Great War. The second, arose mostly in Germany during the period of Nazi rule and just after the Second World War. Finally, the third surge happened in the 1960s and 1970s, when Hesse reached a large readership at the time of the American Counterculture movement. In all these receptions, Hesse’s novels were seen as guides to help navigate crises in western civilisation. The resolutions offered in Hesse’s novels, particularly Demian, Siddhartha, Steppenwolf and The Indian Life (the appendix to The Glass Bead Game) are either anchored in a narrative Orient, or influenced by Vendānta and Buddhist philosophies. -

Download This PDF File
Before the ‘Nooteboom Effect’ - Dutch Literature at the Suhrkamp Publishing House Vóór het Nooteboom-effect. Nederlandse literatuur in de uitgeverij Suhrkamp Pawel Zajas, Adam Mickiewicz University in Poznań Abstract: The present article analyses factors related to the functioning of the publishing field, which have contributed to the relatively important place of Dutch literature on the German book market. The reconstruction of decision-making with regard to translations of Dutch literature spans a period from the early 1960s until 1993, when the Netherlands and Flanders were the guests of honour at the International Book Fair in Frankfurt am Main. The data for the study have been drawn from the publishing archives of the Suhrkamp Verlag, which were purchased by the German Literature Archive (Deutsches Literaturarchiv) in Marbach am Neckar. The Suhrkamp archive data provide an insight into the manufacture of the translation of Dutch literature and, in a broader methodological perspective, offer a unique laboratory environment perfectly suited for the study of the microsociology of literary transfer. In this environment, it is possible to reconstruct the selection, review and acceptance/rejection processes that have taken place within a relatively small team. Moreover, marketing strategies for aesthetic commodities may also be analysed. Keywords: Sociology of Literary Translation, Publishing Field, German Book Market, Suhrkamp Verlag, sociologie van literaire vertalingen, productie van literatuur, de Duitse boekenmarkt, Suhrkamp Verlag, -

Languages of Exile Formatted Proof
!"#$%& '%&& (e Linguistic Outlaw: Peter Weiss’s Return to German as Literary Language In )*+, Peter Weiss makes his -rst public entrance into the postwar German literary landscape – not as a writer, but as a translator. (e short story ‘Der Verurteilte’ [(e Convict] was published in the spring issue of Die Neue Rundschau, a literary journal of the Bermann-Fischer publishing house, whose main of -ce was at the time still located in Stockholm.. Originally titled ‘Den dödsdömde’ [(e Man Condemned to Death] and written by the Swedish literary prodigy Stig Dagerman ()*/0–1+), the story features human isolation and failed communication, themes close to the heart of the 0)-year-old Peter Weiss.2 ) Stig Dagerman, ‘Der Verurteilte’, trans. Peter Weiss, Die neue Rundschau )3 ()*+,), pp. )5+–,+. All translations by the author unless otherwise noted. In )*06 the pub- lishing house Samuel Fischer Verlag in Berlin was divided into two companies, due to the increasing pressure from the Nazi regime: Samuel Fischer Verlag, led by Peter Suhrkamp, and Bermann Fischer Verlag, led by Bermann Fischer. Fischer was allowed to leave Germany with the legal rights to authors banned by the Nazis, such as (omas Mann, Hugo von Hofmannsthal, and Carl Zuckmayer. He established himself in Vienna, while Suhrkamp continued to work with authors whose work was still tolerated in Germany, among them Hermann Hesse. Due to the Anschluss of Austria in )*0,, Berman Fischer Verlag was re-established in Stockholm, where it would remain until )*+,. (e publishing house’s history is covered in Murray G. Hall, Österreichische Verlagsgeschichte !"!#–!"$# (Vienna, )*,1), also available online: Heading ‘Band II’, ‘Bermann Fischer Verlag’, accessed // April /3)0.