Konsequenter Antifaschismus?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
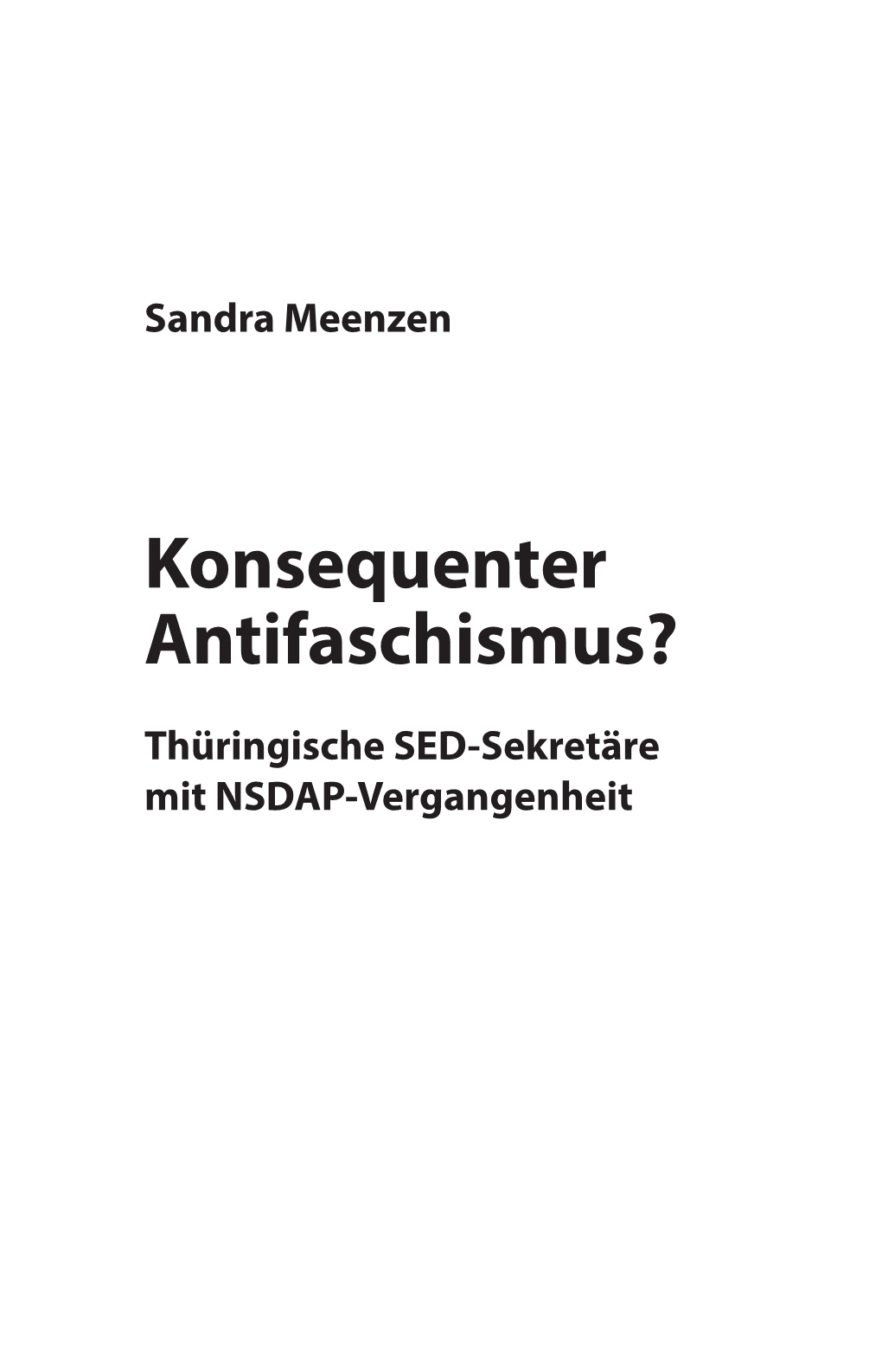
Load more
Recommended publications
-

Bildungs- Und Veranstaltungsprogramm 2021 Inhaltsverzeichnis
DRK-Landesverband Brandenburg e. V. DRK-Service GmbH / A. Zelck © Bildungs- und Veranstaltungsprogramm 2021 Inhaltsverzeichnis 3 Ansprechpartner 5 Rahmenbedingungen 10 Fach- und Gemeinschafts übergreifend 32 Erste Hilfe und Sanitätsdienst 52 Leitungskräfte 56 Bereitschaften 72 Wasserwacht 83 Jugendrotkreuz 92 Mitarbeiter-Qualifizierung 115 Rettungsdienst Beachten Sie bitte auch unser Angebot an Online-Seminaren unter: www.online-akademie.drk-learning.de Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist nur mit Genehmigung des Herausgebers gestattet. Hinweis: Der Einfachheit und der besseren Lesbarkeit dieser Veröffentlichung zufolge, wurde für Personen- und Funkti- onsbezeichnungen überwiegend die männliche Form gewählt, welche sich selbstverständlich auch immer auf die weibliche Form bezieht. Ansprechpartner DRK-Landesverband Brandenburg e. V. Fachbereich Ansprechpartner Abteilung Bildung Steffen Pluntke Abteilungsleiter Bildung Tel.: 0331 / 2864-145 Fax: 0331 / 2864-134 [email protected] Bildungsreferentin Abteilung Bildung Elsa Coppoletta Bildungsreferentin Tel.: 0331 / 2864-118 Fax: 0331 / 2864-134 [email protected] Sachbearbeitung Abteilung Bildung Ina Jasper Tel.: 0331 / 2864-140 Fax: 0331 / 2864-134 [email protected] Abteilung Nationale Hilfsgesellschaft Gordon Teubert Abteilungsleiter Nationale Hilfsgesellschaft Landeskatastrophenschutzbeauftragter Tel.: 0331 / 2864-133 Fax: 0331 / 2864-134 [email protected] Gremienarbeit Jugendrotkreuz, Denise Senger -

Lt. (Jg), Us:M 10 November 1945
I NTH E I~ITERNATIONAL MILITARY TRIDUNAL TRIAL BRIEF CRDHNALITY 0;;' DAS KORPS DER.. FDLITISCHE' !EITER Dill HATIONAlSOZIAL- ISTISCrlliN DEUTSCHEN k1BEITERPARTEI I (LEADERSHIP CORPS OF THE K\ZI PARTY) FOR ROBERT H. JACKSON UNITED STATES CHIEF OF COUNSEl BY THOYtAS F. W.BERT, .ill, Lt. (jg), us:m 10 November 1945 OFFICE OF U.S. CHIEF OF CourSEL SECTIO~! 6 GEORGE E. SEAY LT. COL., A.C. CHIZF OF SECTION I..BGAL S'.".'lFF T1UAL O::CA:r:r:ZATJO!'T INDEX TOPICAT INDEX Page No. Section of Indictment. .. .. ... xii Count One, IV (H), Sentence 2 .. .. xii Appendix. B••..•••••••• xii legal Ref~rences •••••••.....•.•••• • xiii ChQrter of Intern~tion~l .:ilitQry Tribunal . • • ·. Article 6 (n), (b), & (c) .. ... .. ·. .. xiii J.rticle 9 xiv OP13l.I :G STATEf.'.E 'T . .. 1 1 :,iTj.Ti:L::JJT OF EVIDENCE . .. •• 2 - 72 I. Composition, Functions and Powers of the LCQdership Corps of the Nazi Party · . ·2 12 ~. Definition of the Loadership Corps • 2 B. Hierarchical Organization of the leadership Corps .••.......... 2 - 7 1. Th-.; :r.eichsl(;itl.:r (Reich !GC1.ders) • 2 - 4 2. The GC'uleiter (District I,e<.'.ders) 4 - 5 3. Th(; l~reisleiter (County lenders) •• · ... 5 4. The Ortsgruppenleiter (Local Chapter leaders) ••• 5 - 6 5. The Zellenleiter (Cell ~~~ders) 6 6. Tht; :310c ~leiter (Dlock J.eaders) .. .. 6 - 7 C. The "Hoheitstmger" ("Bearers of :;overeignty") • '1 - 8 D. Org~nization of l~~dership Corps under the ''It;Qdership Principle" 9 - 10 1. Provisions of P~rty !.{anu.:'..l . .. · . 9 2. Oath of ~olitic['J. Leaders to Hitler ·... 9 3. Appointm",nt of PoliticnJ. -

Heimatblaetter 2016
Nummer 1/2016 Beilage BadKreuznacher Bad Kreuznach Heimatblätter Vom Kirchhof zum Friedhof Die Verlegung der Begräbnisplätze in den Außenbereich der Ortschaften – dargestellt am Beispiel Frei-Laubersheim VON DIPL.-HDL. WOLFGANG ZEILER, FREI-LAUBERSHEIM Vorbemerkungen Nur noch in wenigen Gemeinden in un- serer Region liegen die Begräbnisstätten un- mittelbar an der Kirche. Solche Kirchhöfe finden sich zum Beispiel noch in Weinsheim oder Bingen-Büdesheim. In den meisten Ort- schaften liegen die Begräbnisplätze jedoch außerhalb der örtlichen Bebauungsgrenzen. Die Art der Bauweise sowie das verwendete Material zeigen, dass diese Friedhöfe alle re- lativ zeitgleich errichtet wurden. Die Grün- de und der Ablauf der Verlegung werden in den einzelnen Ortschaften im Detail zwar Teil des ehemaligen Kirchhofs in Frei-Laubersheim (heutiger Zustand). Foto: Wolfgang Zeiler, Frei-Laubersheim nicht identisch, aber doch denen in der rheinhessischen Gemeinde Frei-Laubers- heim ähnlich gewesen sein. Politisch gehörte Frei-Laubersheim zu hungsweise um die Kirche herum – „im Hof In den französischen Gemeinden selbst sah Beginn des 19. Jahrhunderts, wie alle links- der Kirche“. Dadurch, dass man die Toten man dies jedoch offenbar ganz anders. Eine rheinischen Gebiete, seit dem Vertrag von unmittelbar an der Kirche beerdigte, blie- offizielle Befragung französischer Bürger- Lunéville (1801) zum französischen Staats- ben die Verstorbenen im Ort und waren da- meister zu gesundheitlichen Problemen auf gebiet. Mit der Gründung der Provinz mit weiterhin eingebunden -

Wolfgang Stelbrink: Die Kreisleiter Der NSDAP in Westfalen Und Lippe
Die Kreisleiter der NSDAP in Westfalen und Lippe VERÖFFENTLICHUNGEN DER STAATLICHEN ARCHIVE DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN REIHE C: QUELLEN UND FORSCHUNGEN BAND 48 IM AUFTRAG DES MINISTERIUMS FÜR STÄDTEBAU UND WOHNEN, KULTUR UND SPORT HERAUSGEGEBEN VOM NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN STAATSARCHIV MÜNSTER Die Kreisleiter der NSDAP in Westfalen und Lippe Versuch einer Kollektivbiographie mit biographischem Anhang von Wolfgang Stelbrink Münster 2003 Wolfgang Stelbrink Die Kreisleiter der NSDAP in Westfalen und Lippe Versuch einer Kollektivbiographie mit biographischem Anhang Münster 2003 Die Deutsche Bibliothek – CIP Eigenaufnahme Die Kreisleiter der NSDAP in Westfalen und Lippe im Auftr. des Ministeriums für Städtebau und Wohnung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-West- falen hrsg. vom Nordrhein-Westfälischen Staatsarchiv Münster. Bearb. von Wolfgang Stelbrink - Münster: Nordrhein-Westfälischen Staatsarchiv Münster, 2003 (Veröffentlichung der staatlichen Archive des Landes Nordrein-Westfalen: Reihe C, Quellen und Forschung; Bd. 48) ISBN: 3–932892–14–3 © 2003 by Nordrhein-Westfälischen Staatsarchiv, Münster Alle Rechte an dieser Buchausgabe vorbehalten, insbesondere das Recht des Nachdruckes und der fotomechanischen Wiedergabe, auch auszugsweise, des öffentlichen Vortrages, der Übersetzung, der Übertragung, auch einzelner Teile, durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übertragung auf Datenträger. Druck: DIP-Digital-Print, Witten Satz: Peter Fröhlich, NRW Staatsarchiv Münster Vertrieb: Nordrhein-Westfälischen Staatsarchiv Münster, Bohlweg 2, 48147 -

Mitgliederbrief KV FS 04 2019 Q18.Qxp Beihefter 04/2019 18.11.19 15:37 Seite 1
Mitgliederbrief_KV_FS_04_2019_q18.qxp_Beihefter 04/2019 18.11.19 15:37 Seite 1 MITGLIEDERBRIEF 24. Jahrgang / 4. Quartal 2019 Große Ausbildungsübung der DRK- Gemeinschaften in Dahme-Spreewald DRK-Kreisverband Fläming-Spreewald e.V. Einsatzkräfte und Technik auf dem ehemaligen Flugplatz Löpten Um unsere Aufgaben als Hilfsorganisation im Katastro- Rettungsschwimmer oder Taucher – es sind Ehrenamtli- phenschutz verlässlich erfüllen zu können, sind eine gute che, die die Einsatzeinheiten stellen und das Zusammen- Ausbildung und ein ernsthaftes Training der hierfür not- spiel mit unterschiedlichen Akteuren ermöglichen. Damit wendigen Fähigkeiten eine wichtige Voraussetzung. Dabei alles reibungslos funktioniert, bilden sich unsere Helfer gibt es eine große Vielfalt: Ob im Sanitätsdienst, bei der ständig fort und haben sich über ein Jahr lang intensiv auf technischen Unterstützung, dem Umgang mit Betroffenen die Übung vorbereitet. Eine vergleichbare Übung fand be- oder der Verpflegung – oder, wenn es sich um Schadens- reits 2016 statt. Ziel dieser Ausbildungsübungen ist es, für lagen auf dem Wasser handelt, Motorrettungsbootführer, den Ernstfall gerüstet zu sein. Lesen Sie weiter auf den Seiten 4 bis 5 1 Mitgliederbrief_KV_FS_04_2019_q18.qxp_Beihefter 04/2019 18.11.19 15:37 Seite 2 kurz & knapp notiert … Ereignisse und Aktionen im DRK-Kreisverband Fläming-Spreewald e.V. Finanzielle Hilfe zur Geburt eines der Wohlfahrts- und Sozialarbeit: Men- Kindes schen, die ihre Zeit und ihr persönliches Die Bundesstiftung „Mutter und Kind“ un- Engagement in ein Ehrenamt einbringen, terstützt schwangere Frauen beim Kauf müssen, damit sie dies gut tun können, der Babyerstausstattung durch einen fi- ausgebildet und ausgestattet werden. nanziellen Zuschuss. Dieser Zuschuss Dafür wird die finanzielle Unterstützung kann über die Psychosoziale Beratungs- unserer Fördermitglieder dringend benö- stelle für Schwangere und Familien des tigt. -

Das Reichsministerium Des Innern Unter Heinrich Himmler 1943–1945
639 Der Name Himmler wird gemeinhin mit der SS in Verbindung gebracht wie über- haupt mit dem nationalsozialistischen Terrorapparat, mit dem Holocaust und dem ideo- logischen Kern der NS-Bewegung. Weniger bekannt ist dagegen, dass Himmler – neben vielem anderen – auch noch den Posten des Reichsinnenministers übernahm, wenn auch erst spät, im Jahr 1943. Welche Folgen ergaben sich aus dieser Zäsur und vor allem: welche Konsequenzen hatte das für dieses Ressort? Stephan Lehnstaedt Das Reichsministerium des Innern unter Heinrich Himmler 1943–1945 Als Heinrich Himmler am 26. August 1943 neuer Reichs- und Preußischer Mini- ster des Innern wurde1, löste er mit Wilhelm Frick einen nationalsozialistischen Minister der ersten Stunde ab. Schon 1933 war der promovierte Jurist von Hitler ernannt worden und hatte dem Reichskabinett über zehn Jahre angehört. In sein Ressort fielen nicht nur die Innenverwaltung, sondern auch die Polizeigewalt und die Aufsicht über das Gesundheitswesen, das ein eigenes Staatssekretariat im Ministerium bildete. Mit diesen Kompetenzen konnte Frick die Rechtsetzung maßgeblich beeinflussen und für den nationalsozialistischen Staat so wichtige Richtlinien wie die Erbgesundheitsgesetze und die Nürnberger Rassengesetze federführend gestalten. Zu Fricks anfänglich recht bedeutsamer Stellung trug auch die Übernahme des Preußischen Innenministeriums 1934 im Zuge der Beseitigung der Länderhoheit bei, so dass ab diesem Augenblick die vollständige Weisungshoheit für die Landes- und Kommunalbehörden in seiner Hand war. Ferner sorgte -

Volltext (14Mb)
Schriftenreihe der Stiftung Schulgeschichte des Bezirksverbandes Weser-Ems der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Herausgeber Klaus Klattenhoff im Auftrag des Kuratoriums der Stiftung Schulgeschichte Hans-Gerd de Beer Josef Kaufhold, Klaus Klattenhoff, Stefan Störmer, Friedrich Wißmann Mit der Schriftenreihe Regionale Schulgeschichte werden Theorie und Praxis der Pädagogik und Schule in ihren konkreten Handlungs- bezügen und Bezugsfeldern vorgestellt. Geschich te der Pädagogik war lange Zeit Geschichte der die Erziehung bewegenden Ideen. Geschichte der Schule war – wenn sie überhaupt geschrieben wurde – meistens Staats- und Ländergeschichte, Geschichte der Schulorganisation und Schulverwaltung, nicht zuletzt also Geschichte staatlicher Macht- politik. Regionale Schulgeschichte stellt den Betrachtungswinkel enger. Dadurch rücken die Einzelheiten und die vor Ort handelnden Personen deutlicher ins Bild. „Geschichten des Schulwesens einzelner Städte und Länder; Lebens- beschreibungen von Lehrern und Schülern, vor allem Biographien hervorragen der Schulmänner, Rektoren, Schulräte, Organisatoren ... daran fehlt es sehr“, fand vor mehr als hundert Jahren Friedrich Paulsen im Vorwort zur zweiten Auflage seiner berühmten „Geschichte des gelehrten Unterrichts“. Noch mehr fehlt es an solchen Darstellungen für das Elementar- und Schulwesen, zumal auf dem Lande und in unserer Nord-West-Region zwischen Weser und Ems. Vieles von dem ist in Orts- und Schulchroniken, Kirchenbüchern, privaten Sammlungen und persönlichen Erinnerungen festgehalten. Diese -

German Documents Among the War Crimes Records of the Judge Advocate Division, Headquarters, United States Army, Europe
Publication Number: T-1021 Publication Title: German Documents Among the War Crimes Records of the Judge Advocate Division, Headquarters, United States Army, Europe Date Published: 1967 GERMAN DOCUMENTS AMONG THE WAR CRIMES RECORDS OF THE JUDGE ADVOCATE DIVISION, HEADQUARTERS, UNITED STATES ARMY, EUROPE Introduction Many German documents from the World War II period are contained in the war crimes case files of Headquarters, United States Army Europe (HQ USAREUR), Judge Advocate Division, dated 1945-58. These files contain transcripts of trial testimony, clemency petitions, affidavits, prosecution exhibits, photographs of concentration camps, etc., as well as original German documents used as evidence in the prosecution of the numerous war crimes cases, excluding the Nuremberg Trials, concerning atrocities in concentration camps, atrocities committed on Allied military personnel and Allied fliers who crash landed in Germany, and other crimes. Only the German documents predating May 8, 1945, have been included in this filming project. A data sheet describing the material in each folder microfilmed is included before the items filmed. The Judge Advocate Division file number has been used to identify each item wherever given. In other instances whatever identifying information is available, such as the case or exhibit number, has been given as the item number. Overall provenance for the records is HQ USAREUR. Judge Advocate Division, as all German documents in the files were made a permanent part of the records of that office; however, the original German provenance of the items filmed is given as the provenance on the data sheets. CONTENTS Roll Description 1 000-50-2, Vol. 1 [No Title] Correspondence, reports, memoranda, scientific theses, and other data exchanged among Dr. -

Cordula Tollmien Nationalsozialismus in Göttingen (1933-1945)
Cordula Tollmien Nationalsozialismus in Göttingen (1933-1945) Cordula Tollmien Nationalsozialismus in Göttingen (1933-1945) Diese Arbeit wurde im November 1998 von der Philosophischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen als Dissertation angenommen. Cordula Tollmien, geb. 1951 in Göttingen, Studium der Mathematik, Physik und Geschichte; seit 1987 freie Schriftstellerin und Wissenschaftlerin. Von Cordula Tollmien gibt es eine Vielzahl von zum Teil preisgekrönten Kinder- und Jugend- büchern, außerdem zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen, insb. zur Göttinger Stadt- und Universitätsgeschichte. Zur Autorin siehe auch http://www.hann-muenden.net/spontan/tollmien.htm Ó Die Rechte für den "Göttingen 1933 bis 1945" betitelten zweiten Teil der hier vorlie- genden Dissertation liegen beim Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. Der Verlag hat der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen das Recht zur freien elektronischen Publikation im Internet und zur Archivierung auf ihrem Dokumen- tenserver übertragen. Alle weiteren Rechte für die Verwertung des genannten Teils die- ser Arbeit verbleiben beim Verlag Vandenhoeck & Ruprecht. Dieser wird den genannten Teil Ende 1999 in einem Band der Göttinger Stadtgeschichte mit dem Titel „Göttingen Geschichte einer Universitätsstadt Band 3: Von der preußischen Mittelstadt zur südniedersächsischen Großstadt“ (herausgegeben von Rudolf von Thadden und Günter Trittel) publizieren. Ó Für die Teile 1 und 3 hat die Autorin das Recht zur freien elektronischen Publikation -

Königsberg–Kaliningrad, 1928-1948
Exclave: Politics, Ideology, and Everyday Life in Königsberg–Kaliningrad, 1928-1948 By Nicole M. Eaton A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Yuri Slezkine, chair Professor John Connelly Professor Victoria Bonnell Fall 2013 Exclave: Politics, Ideology, and Everyday Life in Königsberg–Kaliningrad, 1928-1948 © 2013 By Nicole M. Eaton 1 Abstract Exclave: Politics, Ideology, and Everyday Life in Königsberg-Kaliningrad, 1928-1948 by Nicole M. Eaton Doctor of Philosophy in History University of California, Berkeley Professor Yuri Slezkine, Chair “Exclave: Politics, Ideology, and Everyday Life in Königsberg-Kaliningrad, 1928-1948,” looks at the history of one city in both Hitler’s Germany and Stalin’s Soviet Russia, follow- ing the transformation of Königsberg from an East Prussian city into a Nazi German city, its destruction in the war, and its postwar rebirth as the Soviet Russian city of Kaliningrad. The city is peculiar in the history of Europe as a double exclave, first separated from Germany by the Polish Corridor, later separated from the mainland of Soviet Russia. The dissertation analyzes the ways in which each regime tried to transform the city and its inhabitants, fo- cusing on Nazi and Soviet attempts to reconfigure urban space (the physical and symbolic landscape of the city, its public areas, markets, streets, and buildings); refashion the body (through work, leisure, nutrition, and healthcare); and reconstitute the mind (through vari- ous forms of education and propaganda). Between these two urban revolutions, it tells the story of the violent encounter between them in the spring of 1945: one of the largest offen- sives of the Second World War, one of the greatest civilian exoduses in human history, and one of the most violent encounters between the Soviet army and a civilian population. -

BMI-Projekt Abschlussbericht 151029
VORSTUDIE – STAND: 29.10.2015 Abschlussbericht der Vorstudie zum Thema Die Nachkriegsgeschichte des Bundesministeriums des Innern (BMI) und des Ministeriums des Innern der DDR (MdI) hinsichtlich möglicher personeller und sachlicher Kontinuitäten zur Zeit des Nationalsozialismus Leitung Prof. Dr. Frank Bösch (ZZF Potsdam) Prof. Dr. Andreas Wirsching (IfZ München-Berlin) VORSTUDIE – STAND: 29.10.2015 Abstract 4 I. Einleitung 5 1. Fragestellung 5 2. Begrifflichkeiten und Quellen 7 3. Forschungsstand 10 II. Bundesministerium des Innern 21 1. Vorgeschichte und Entwicklung 21 2. Personalpolitik (Irina Stange) 23 3. Bereiche 37 a) Oberste Leitungsebene und Zentralabteilung (Irina Stange) 37 b) Verfassung, Staatsrecht und Verwaltung (Frieder Günther) 44 c) Innere Sicherheit (Dominik Rigoll) 55 d) Gesundheits- und Sozialwesen (Maren Richter) 66 e) Kultur, Medien, Wissenschaft und Sport (Stefanie Palm) 79 f) Die Abteilungen „Beamtenrecht, öffentlicher Dienst, Wiedergutmachung“ und „Zivilschutz“ (Jan Philipp Wölbern) 94 III. Ministerium des Innern der DDR 111 1. Vorgeschichte und Entwicklung 111 2. Das leitende Personal: Arbeitsstand und methodische Probleme 116 3. Bereiche 117 a) Oberste Leitungsebene 117 b) Innere Sicherheit (Franziska Kuschel) 120 c) Die zivilen Verwaltungen und wissenschaftlichen Dienste (Lutz Maeke) 130 IV. Zusammenfassung 141 Anhang 146 VORSTUDIE – STAND: 29.10.2015 Abstract Unser Bericht dokumentiert nach zehn Monaten Forschung erste Befunde zur Geschichte der beiden deutschen Innenministerien in Bonn und Ost-Berlin von 1949 bis circa 1970 vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Diktatur. Ausgehend von der Frage, welche Kontinuitäten beziehungsweise Diskontinuitäten gegenüber der Zeit des Nationalsozialismus bestanden, verfolgt die Vorstudie einen dreifachen Zugriff. Erstens wurde die formal greifbare NS-Belastung des leitenden Personals in beiden Ministerien von über 1 100 Mit- arbeitern analysiert (ab Referatsleiter), die sich in früheren Mitgliedschaften in der NSDAP und in den nationalsozialistischen Parteiorganisationen fassen lässt. -
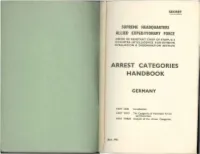
Arrest Categories Handbook
SECRET SUPREME HEADQUARTERS ALLIED EXPEDITIONARY FORCE OFFICE OF ASSISTANT CHIEF OF STAFF, G-2 COUNTER-INTELLIGENCE SUB-DIVISION EVALUATION & DISSEMINATION SECTION ARREST CATEGORIES HANDBOOK GERMANY PART ONE Introduction. PART TWO The Categories of Automatic Arrest and Detention. PART THREE Analysis of the Arrest Categories. .April, 1945 2 3 the Interior, the Nazi Police are thoroughlv permeated by the SS. All person~el of the Gestapo are members o( the SS, and carry SS as PART ONE well as Police ran~; furthe_nnore, m_embership of the SS is a prerequisite for advancement m the Krzpo, and, m general, also in the Orpo. INTRODUCTION 5. Persons _will be subject to arrest: if they have at any time held a _rank or ap~mtment falling ·within the automatic arrest categories, 1. The object of this handbook is to enlarge on the categories with the followmg exceptions :- laid down in the Mandaton- Arrest Directive, and to assist Counter Intelligence staffs in carrying out the arrest policy. (a) Persons dismissed by the Xazis, on grounds of political unreliability 2. The handbook comprises :- (b) Persons who retired from such an appointment before 1933. (a) A statement of the categories included in the :\laudatory 6. The fact that a person does not fall within the automatic arrest Arrest Directi,·e categories does not exempt him from arrest if he is indiddually suspect. (b) A brief appreciation of each category, together with a detailed breakdown by rank and/or function of persons 7. It should be noted that feminine counterparts exist for many falling within the category. of the male ranks listed in PART THREE, especially in the Police and the Civil Service.