Masterplan 100% Klimaschutz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Presseinformation
Presseinformation 27. April 2018 / 013hr Feiern mit Freunden Hessischer Rundfunk hr lädt zu Fernsehshows, Konzerten und Diskussionen auf den Hessentag Anstalt des öffentlichen Rechts Pressestelle Zehn Tage lang lädt der Hessische Rundfunk (hr) während des 58. Hessentags Postfach zu insgesamt rund 80 Veranstaltungen und Programmpunkten nach Korbach 60222 Frankfurt am Main Bertramstraße 8 ein. Im Mittelpunkt steht dabei das Areal des Hessischen Rundfunks, der „hr- 60320 Frankfurt am Main Treff“ am Riesenrad im Stadtpark direkt an der Heerstraße. Vom 25. Mai bis zum 3. Juni können Hessentagsbesucher hier unter dem Motto „Feiern mit Sebastian Hübl Telefon 069 155-3789 Freunden“ von mittags bis in die Nacht Fernsehshows, Konzerte, Diskussio- Mobil: 0175 9357175 nen, Partys und einen chilligen Beach-Club erleben – das alles bei freiem Ein- [email protected] tritt. Marco Möller Telefon 069 155-4401 Mobil: 0170 2121753 „hr3-Festival“-Wochenende mit Sunrise Avenue, Adel Tawil und Revolverheld [email protected] presse.hr.de Das Highlight in der Continental-Arena ist das große „hr3-Festival“ am ersten twitter.com/hrPresse Wochenende des Hessentags. Gemeinsam mit der Stadt Korbach holt hr3 am Freitag, 25. Mai, die finnische Rockband Sunrise Avenue mit Frontsänger Samu Haber in die Hessentags-Arena. Am Samstag, 26. Mai, steht der Deutsch-Pop-Poet Adel Tawil auf der Bühne, am Sonntag feiert die Rockband Revolverheld mit ihren Fans. Direkt nach den Konzerten geht es im „hr-Treff“ mit den Aftershow-Partys weiter, der Eintritt hierzu ist frei. Am Montag, 28. Mai, lädt das Moderatoren-Duo Sonya Kraus und Tobias Kämmerer zum Ab- schluss des Festivals – ebenfalls bei freiem Eintritt – zur TV-Sendung „hr3- Festival – die Show“ in den „hr-Treff“. -

The Self-Perception of Chronic Physical Incapacity Among the Labouring Poor
THE SELF-PERCEPTION OF CHRONIC PHYSICAL INCAPACITY AMONG THE LABOURING POOR. PAUPER NARRATIVES AND TERRITORIAL HOSPITALS IN EARLY MODERN RURAL GERMANY. BY LOUISE MARSHA GRAY A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the University of London. University College, London 2001 * 1W ) 2 ABSTRACT This thesis examines the experiences of the labouring poor who were suffering from chronic physical illnesses in the early modern period. Despite the popularity of institutional history among medical historians, the experiences of the sick poor themselves have hitherto been sorely neglected. Research into the motivation of the sick poor to petition for a place in a hospital to date has stemmed from a reliance upon administrative or statistical sources, such as patient lists. An over-reliance upon such documentation omits an awareness of the 'voice of the poor', and of their experiences of the realities of living with a chronic ailment. Research focusing upon the early modern period has been largely silent with regards to the specific ways in which a prospective patient viewed a hospital, and to the point in a sick person's life in which they would apply for admission into such an institution. This thesis hopes to rectif,r such a bias. Research for this thesis has centred on surviving pauper petitions, written by and on behalf of the rural labouring poor who sought admission into two territorial hospitals in Hesse, Germany. This study will examine the establishment of these hospitals at the onset of the Reformation, and will chart their history throughout the early modern period. Bureaucratic and administrative documentation will be contrasted to the pauper petitions to gain a wider and more nuanced view of the place of these hospitals within society. -
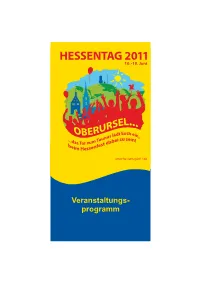
Veranstaltungs- Programm
Veranstaltungs- programm 1 Inhaltsverzeichnis Millionen Grußworte 4 Veranstaltungen 6 gewinnen. Landesausstellung Jeden Mittwoch. Jeden Samstag. Forum von Landesregierung und Landtag 114 Ausstellungen 124 Nichtöffentliche Veranstaltungen Fach- und Arbeitstagungen 134 Sonstiges 140 hr-Treff 148 Rund um den Hessentag 156 Verkehrsleitplan 160 Übersicht Bus- und Bahnlinien 162 Stadtplan/Veranstaltungsorte 164 Hessentagsstadt Oberursel 166 Dank an die Sponsoren 178 Impressum 181 *Der Eintritt zu allen Veranstaltungen, mit Ausnahme der besonders gekennzeichneten, ist frei! Änderungen vorbehalten Nur wer mitspielt kann gewinnen. Spielteilnahme ab 18 Jahren. LOTTO kann süchtig machen. Rat und Hilfe unter: www.spielen-mit-verantwortung.de. Infotelefon: 0800 1 372700. 3 Grußwort Grußwort Liebe Oberurseler und Gäste, Liebe Hessentagsgäste, längst ist der Hessentag nicht nur das „…das Tor zum Taunus lädt Euch ein, traditionsreichste, sondern auch das beim Hessenfest dabei zu sein“ – unter größte Landesfest in Deutschland. diesem Motto begrüßen wir, gemein- Darauf sind wir Hessen stolz. Mehrere sam mit der Hessischen Landesregie- hunderttausend Besucher zieht der rung, alle Besucherinnen und Besucher Hessentag jedes Jahr in eine andere anlässlich des 51. Hessentags in Ober- Region unseres schönen Hessenlan- ursel (Taunus). Eingebettet zwischen des. In diesem Jahr präsentiert sich der Großstadt Frankfurt am Main und den grünen Taunushügeln bietet Ober- Hessen am Rande des Taunus, vom ursel im Rhein-Main-Gebiet ideale Ver- 10. bis 19. Juni ist das „Fest aller kehrsanbindungen und ist aus allen Hessen“ in Oberursel zu Gast. hessischen Himmelsrichtungen bequem zu erreichen. Direkte Organisationen, Verbände, Vereine und Initiativen aus der Anbindung an die A661, S- und U-Bahnverbindungen oder – aus Gastgeberstadt Oberursel und aus ganz Hessen haben ge- M#$- meinsam seit Monaten an einem beeindruckenden Programm wegenetz – Ihrem Besuch steht nichts im Weg! gearbeitet und werden das Landesfest mit Leben füllen. -

Einleitung Von Roland Koch, Hessischer Ministerpräsident Vom
Einleitung von Roland Koch, Hessischer Ministerpräsident Vom Frankfurter Wecker bis zu P!NK Der Hessische Rundfunk auf dem Hessentag von Dr. Helmut Reitze, Intendant des Hessischen Rundfunks Geschichte des Hessentags von Hans Sarkowicz, Publizist 1. Die Idee 19 2. Das Gerüst trägt bis heute 21 3. Integration und Wiederaufbau 1961 -1965 Alsfeld, Michelstadt, Hanau, Kassel, Darmstadt 27 4. Fortschritt und Wandel 1966-1970 Friedberg, Bad Hersfeld, Viernheim, Gießen, Wiesbaden 39 5. Hessen in der Gemeinschaft Europas 1971 -1975 Eschwege, Marburg, Pfungstadt, Fritzlar, Wetzlar 47 6. Dabeisein wird immer wichtiger 1976 -1980 Bensheim, Dreieich, Hofgeismar, Friedberg, Grünberg 55 7. Auf dem Hessentag fallen politische Entscheidungen 1981 -1985 Bürstadt, Wächtersbach, Lauterbach, Lampertheim, Alsfeld 63 8. Die Welt im Umbruch 1986 -1990 Herborn, Melsungen, Hofheim, Frankenberg, Fulda 73 9. Hessen, eine Heimat für alle 1991 -1995 Lorsch, Wolfhagen, Lieh, Groß-Gerau, Schwalmstadt 83 10. Der Hessentag als Publikumsmagnet 1996 - 2000 <D Gelnhausen, Korbach, Erbach, Baunatal, HünfelHünfe d 91 N S-4 11. Begeisterte Gäste kommen wieder 2001 - 2005 43 Dietzenbach, Idstein, Bad Arolsen, Heppenheim, Weilburg 99 ai g 12. Auf dem Weg in die Zukunft Hessisch Lichtenau, Butzbach, Homberg (Efze), Langenselbold, Stadtaliendorf 109 Bibliografische Informationen digitalisiert durch http://d-nb.info/1002095093 Chronik 1961 Alsfeld 18 1986 Herborn 68 1962 Michelstadt 20 1987 Melsungen 70 1963 Hanau 22 1988 Hofheim 72 1964 Kassel 24 1989 Frankenberg 74 1965 Darmstadt -

Jahresbericht 2008 2 Inhalt
Jahresbericht 2008 2 Inhalt Vorworte 4 Rechtliche Verhältnisse im Berichtszeitraum 9 Gesetz über den Hessischen Rundfunk 10 Satzung des Hessischen Rundfunks 16 Die Organe des Hessischen Rundfunks 22 Ausschüsse des Rundfunkrats 28 Ausschuss des Verwaltungsrats 29 Redaktioneller Teil Der Sender für Hessen 30 Meinungsbildend 45 Erste Liga – Zwei Orchester 52 Statistiken Hörfunk-Statistiken 56 Fernseh-Statistiken 59 Empfangsgeräte und Befreiungen 62 Personal Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 64 Freie Mitarbeiter 70 Lagebericht und Jahresabschluss Lagebericht 72 Vermögensrechnung 84 Ertrags- und Aufwandsrechnung 86 Anhang 87 Beteiligungen 91 Anlagenspiegel 92 Abrechnung des Finanzplans 94 Abrechnung des Ertrags- und Aufwandsplans 96 Impressum 97 Organigramm Anhang 3 © hr/Andreas Frommknecht © hr/Andreas Dr. Helmut Reitze Zeiten der Krise sind Zeiten der Rückbesinnung Das Informationsradio hr-info hat im abgelau- Zahl an Beiträgen, Live- Gesprächen und in fenen Jahr über 50 Prozent an Hörern hinzu- verschiedenen Nachrichtenformaten bundes- gewonnen. Unser Internet-Angebot hatte am weit berichtet. Auch an unsere neuen Korres- Wahltag und den besonderen Ereignistagen pondentenplätze in Neu-Delhi (Fernsehen) und der Landespolitik die höchsten jemals erziel- Los Angeles (Hörfunk) waren die Anforde- ten Zugriffswerte, die „Hessenschau“ und die rungen aufgrund der Themenlage von Beginn Sondersendungen im hr-fernsehen erreichten an überdurchschnittlich hoch. Bestwerte bei den Einschaltquoten. Keine Diesem Informationsbedürfnis nachzukom- Frage, das -

Der HBRS Präsentiert Sich Auf Dem Hessentag in Wetzlar
DAS MAGAZIN DES HESSISCHEN BEHINDERTEN- UND REHABILITATIONS-SPORTVERBANDS E.V. In Kooperation mit dem Herz- und Kreislaufzentrum Rotenburg a. d. Fulda Ausgabe 3/2012 IN DIESER AUSGABE Hessentag 2012 ...................... 4 Tischtennis HBRS erfolgreichster Verband Deutschlands ........................... 8 Rollstuhlbasketball Team Hessen einfach grandios 8 Leichathletik Süddeutsche Meisterschaften in Heusenstamm ..................... 9 Special Olympics Medaillen für die Judoka des Budo Club Mühlheim ...... 10 Judo Bundesweiter Judoschnupper- lehrgang in Ilvesheim .............11 Aus den Bezirken Bezirksmeisterschaften im Bosseln ..............................12 Bezirkswandertag 2012 des Bezirks Bergstraße ............12 RÜCKBLICK Reha-Abteilung der UTSG Der HBRS präsentiert sich auf feiert 20-jähriges Jubiläum .....13 Budo Club Mühlheim erhält Verstärkung ............................14 dem Hessentag in Wetzlar Seite 4 Integrativer Bärenpokal im Judo ..................................14 Süddeutsche Integrativer Meisterschaften Seite 9 Bärenpokal Seite 14 HBRSdirekt VORWORT Ausgabe 3/2012 Liebe Leserinnen, liebe Leser, um in die aktuelle Diskussion Schüler. Sie alle haben dazu beigetragen, dass der um das Thema „Inklusion“ ein- Sport für Menschen mit einer Behinderung auch beim zustimmen, möchte ich die größten Volksfest der Hessen positiv wahrgenommen stark verkürzten Defi nition „Teilhabe und mitten drin“ wird. benutzen. Das größte Volksfest der Hessen, unser In dieser Ausgabe haben Sie die Möglichkeit, unsere „Hessentag“, bietet seit Jahren -

JAHRESBERICHT 2019 Jahresbericht 2019 Inhalt Inhalt
JAHRESBERICHT 2019 Jahresbericht 2019 Inhalt Inhalt 4 Wir sind deins 26 Programmschwerpunkte 2019 74 Information und Orientierung 116 Organe des 76 Hessisches aus einer Hand Hessischen Rundfunks Höhepunkte 2019 28 Programm auf digitalen Wegen 78 Crossmediale Recherche-Projekte 118 Mitglieder des Rundfunkrats 6 Mittendrin – 30 Der hr und die ARD-Mediathek 80 Veränderungen im hr-fernsehen 122 Mitglieder des Verwaltungsrats Flughafen Frankfurt 32 Die ARD-Audiothek 82 hr-Dokumentationen für 123 Die Geschäftsleitung des 8 Tatort 34 Podcasts ARD, ARTE und KiKA Hessischen Rundfunks 10 Unterricht ungenügend 36 Digitale Projekte 86 Wetter für Hessen und die ARD 124 Ausschüsse des Rundfunkrats 12 Europa Open Air 38 Der hr bei YouTube, Instagram & Co 88 Regionale Verkehrsinformationen 126 Ausschuss des Verwaltungsrats 14 Wir hören dich 40 „funk“ im hr 90 Sport 126 Neuer Ombudsmann 16 ARD-Wetterkompetenzzentrum 41 Intern: Strategie und Veränderungen 92 ARD-aktuell 44 Kultur für alle 93 Intern: Strategie und Veränderungen 127 Rechtliche Verhältnisse 18 Der hr in Hessen 46 Besondere Konzerterlebnisse 94 Bildung, Wissen und Engagement Tarifstruktur und Bezüge 50 Kultur im Radio ... 96 Netzwerk hr@schule Vorworte 128 der Geschäftsleitung des 52 ... und im Fernsehen 98 Wissen zum Hören 20 Intendant Manfred Krupp Hessischen Rundfunks 54 Kultur in Hessen fördern 100 ARD-Themenwoche Bildung „Unser Auftrag gilt für die 130 Bezüge, Leistungen und 55 Bücher, Bücher 101 Education-Projekte der hr-Orchester gesamte Gesellschaft“ Tarifstrukturen der Angestellten -
Veranstaltungs- Programm Konzerte, Ausstellungen, Mitmachaktionen Und Vieles Mehr
Veranstaltungs- programm Konzerte, Ausstellungen, Mitmachaktionen und vieles mehr... www.Hessentag2017.de Inhaltsverzeichnis Grußworte 2 Rüsselsheim stellt sich vor 8 Veranstaltungen 14 Rund um den Hessentag 166 Mobilitätsinformationen 171 Verkehrsleitplan 175 Unsere Sponsoren 176 Impressum 178 Geländeplan / Veranstaltungsorte 180 Hessentags-Hotline (06142) 83-2017 während des Hessentags 24 Stunden täglich erreichbar Der Eintritt zu allen Veranstaltungen, mit Ausnahme der besonders gekennzeichneten, ist frei. Änderungen vorbehalten. Stand: April 2017 www.hessentag2017.de www.hessentag2017.de Hessentag 2017 9. bis 18. Juni 1 Grußwort Grußwort Liebe Besucherinnen und Besucher, Liebe Hessentagsgäste, Respekt und der Zusammenhalt in ich heiße Sie herzlich willkommen in der Gesellschaft sind untrennbar mit- Rüsselsheim am Main! Sie sind einge- einander verbunden. Beides wollen wir laden, den diesjährigen 57. Hessentag 2017 mit dem „Jahr des Respekts“ in mit uns zu feiern. Das größte deutsche Hessen stärken. Die Hessische Lan- Landesfest ist jung geblieben und hat desregierung wirbt damit besonders sich stets weiterentwickelt. Insbeson- für Toleranz und Hilfsbereitschaft im dere die modernen Facetten Hessens Alltag, Rücksichtnahme im Verkehr, sind Schwerpunkte des Hessentags Fairness im Sport, Respekt in den so- 2017, welcher über die Tradition hin- zialen Medien, vor Polizei, Rettungs- aus präsentiert wird: urban, kulturell kräften und Ehrenamtlichen und bei vielfältig und technisch innovativ. In der Integration von Flüchtlingen. Das Motto dieses besonderen Jahres, kaum einer anderen hessischen Stadt lässt sich der Wandel von der „Hessen lebt Respekt“, und der Hessentag passen ideal zueinander, Arbeiterstadt zu einer Denkfabrik für die Technologien von morgen denn das Landesfest führt Menschen zusammen. Und es sind die besser nachvollziehen als in Rüsselsheim am Main. vielen Helferinnen und Helfer, die einen Hessentag erst ermöglichen und denen ich ausdrücklich danken möchte. -

Hessentag 2014: Versteigerung Von Indischer Fahrrad-Rikscha
Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktiengesellschaft Dammstraße 68 64625 Bensheim Pressekontakt: Susanne Schäfer Telefon (0 62 51) 13 01 -190 Telefax (0 62 51) 13 01 –791 E-Mail [email protected] MEDIEN-INFORMATION Nr. 38/2014 Seite 1 / 12.06.2014 Hessentag 2014: Versteigerung von indischer Fahrrad-Rikscha Karl Kübel Stiftung versteigert Fahrrad-Rikscha für den guten Zweck am GGEW Magic Lake Bensheim. Die Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie wird am 14. Juni 2014 ab 19 Uhr am Badesee Bensheim, der sich zum Hessentag in den GGEW Magic Lake verwandelt hat, eine original indische Fahrrad-Rikscha versteigern. Der gesamte Erlös kommt einem sozialen Projekt in Indien zugute. „Die Karl Kübel Stiftung und die „weltwärts“- Freiwilligen laden alle herzlich zu der Versteigerung am GGEW Magic Lake ein. Seien Sie dabei, wenn dieses Unikat versteigert wird“, so Ralf Tepel, Vorstand Karl Kübel Stiftung. Einigen wird das bunte Gefährt aus Indien bereits in den letzten Tagen im Rahmen des Hessentags aufgefallen sein. 160 Kilogramm Lebendgewicht, rein mit Muskelkraft betrieben, ein wahres Wunderwerk der Technik. Puristisch ausgestattet mit Sicherheitsfeatures, die schon unsere Großeltern beglückt haben: mechanische Handbremse, Eingangschaltung, rein mechanisch betriebenes Verdeck. Alles wurde original im ostindischen Chennai (ehemals Madras) gefertigt und über den Seeweg von der Karl Kübel Stiftung importiert. „Wir möchten an dieser Stelle besonders der CURACON GmbH, Darmstadt, danken, die die Beschaffung der Rikscha unterstützt hat“, so Tepel. Außerdem bedankt er sich bei der GGEW AG. „Das ist eine super Aktion und wir hoffen, dass viele Hessentagsbesucher kräftig mitbieten für die gute Sache“, so Susanne Schäfer, Bereichsleiterin Kommunikation GGEW AG. -

Regionales Entwicklungskonzept Odenwald 2014 – 2020 IGO - INTERESSEN GEMEINSCHAFT ODENWALD E.V: Regionales Entwicklungskonzept Odenwald 2014 – 2020 IMPRESSUM
Regionales Entwicklungskonzept Odenwald 2014 – 2020 IGO - INTERESSEN GEMEINSCHAFT ODENWALD E.V: Regionales Entwicklungskonzept Odenwald 2014 – 2020 IMPRESSUM Im Auftrag der Interessengemeinschaft Odenwald e.V. (IGO) Erstellt von neuland+ Tourismus-, Standort- und Regionalentwicklung GmbH & Co. KG Esbach 6, D-88326 Aulendorf Projektleitung: Josef Bühler Bearbeiter: Dr. Christoph Dickmanns Sebastian Dörr Iris Herrmann Gefördert durch: Erbach, 13. April 2015 Version 4.0.3 VORWORT ZUR DRUCKVERSION Die im letzten Jahr erarbeitete Fortschreibung des regionalen Entwicklungskonzeptes Oden- wald war die Voraussetzung dafür, dass die Region Odenwald als Fördergebiet in das eu- ropäische LEADER-Programm 2014-2020 aufgenommen werden konnte. Am 24.02.2015 war es dann soweit: Die hessische Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Priska Hinz, überreichte den Vertreterinnen und Vertretern der Region Odenwald den Anerkennungsbescheid. Das jetzt anerkannte Regionale Entwicklungskonzept Odenwald - kurz: REKO - versteht sich als Arbeitsprogramm aller regionalen Gremien und Institutionen für die nächsten Jahre und wird Grundlage vieler Förderentscheidungen für regionale Projekte sein. Aus diesem Grund hat sich die IGO für einen Druck dieses wichtigen Dokuments entschieden und stellt es im Rahmen ihrer Möglichkeiten denjenigen, die an seiner Erstellung mitgearbeitet haben, den kommunalen Parlamenten und Gremien, den regionalen Multiplikatoren sowie den interessier- ten Bürgerinnen und Bürgern in ausgedruckter Form zur Verfügung. -

Presseinformation Hrfernsehen1
Presseinformation 23. Mai 2017 / 027hr „hr-Treff“ lädt ein zu Fernsehshows, Konzerten und Partys Hessischer Rundfunk hr mit rund 80 Veranstaltungen auf dem Hessentag in Rüsselsheim Anstalt des öffentlichen Rechts Pressestelle Zehn Tage lang lädt der Hessische Rundfunk (hr) während des 57. Hessentags Postfach zu rund 80 Veranstaltungen nach Herborn ein. Damit ist der hr einmal mehr 60222 Frankfurt am Main der größte Einzelveranstalter auf dem jährlichen Landesfest der Hessen. Im Bertramstraße 8 60320 Frankfurt am Main Mittelpunkt steht dabei das Hessentags-Festzelt des Hessischen Rundfunks, der „hr-Treff“ am Riesenrad direkt am Mainufer. Vom 9. bis zum 18. Juni kön- Sebastian Hübl Telefon 069 155-3789 nen Hessentagsbesucher hier von vormittags bis spät in die Nacht Fernseh- [email protected] shows, Konzerte und Partys erleben – und das bei stets freiem Eintritt. Marco Möller Telefon 069 155-4401 Gleich am ersten Hessentagsabend können sich Musikfreunde auf ein beson- [email protected] deres Highlight freuen: Die hr-Bigband bringt gemeinsam mit Joy Denalane presse.hr.de am Freitagabend, 9. Juni, von 20 Uhr an den „hr-Treff“ zum Swingen. twitter.com/hrPresse Am Samstag, 10. Juni, begrüßt Mathias Münch um 20 Uhr auf der Comedy- Newcomer-Bühne im „hr-Treff“ jede Menge Comedy-Nachwuchskünstler mit den besten Ausschnitten aus deren Programmen. Ein weiterer Höhepunkt ist das große Finale der hr-Aktion „Dolles Dorf 2017“. Am ersten Hessentags-Sonntag, 11. Juni, kämpfen unter den Augen von Mo- derator Jens Kölker vier hessische Dörfer um den Sieg. Die Preise werden überreicht von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und hr-Intendant Manfred Krupp. -
Cultural Wealth. Culture Map of Hesse … a Cultural Discovery Tour
www.hessen-tourism.com Preserving our cultural wealth. CULTURE MAP OF HESSE … a cultural discovery tour EUROPEAN UNION Investing in Your Future European Regional Development Fund RZ_Titel_Kulturkarte_engl.indd 1 03.12.2009 12:07:12 Uhr Dear Guest, ... take our suggestions for your cultural adventure through the state of Hesse. Experience the variety and contrast of the enchanting state of Hesse. Hesse´s cultural offer is also distinguished by contrast and variety. 350 castles, over 300 museums, impressive abbeys, attractive parks and gar- dens, picturesque half-timbered towns and fi ve UNESCO-world heritage sites – discover Hesse’s rich past and present. The vibrant theater scene from the Opera House that has already recei- ved multiple awards to modern theater to experimental free theater is compelling. Artists and institutions in music, literature, dance, fi lm and the new media, fi ne arts as well as high-quality exhibitions and festivals also invite you to come to Hesse- the range of subjects is rich and enti- cing, nurtures the mind and senses. This cultural map can provide you with a little cross section of the extensive range of cultural activities in the state of Hesse. For further information please go to the specifi ed Internet addresses. Experience culture in Hesse – We look forward to meeting you! Tip: For information on environmentally-friendly travel to Hesse go to www.bahn.de/ hessen History, Architecture, Townscape Hersfeld and Lorsch must be added to this spectrum. Numerous locations such as the State Archives in Marburg, Darmstadt and Wiesbaden provide information on the shifting political fortunes of the state.