Die Fayencefabrik Matzendorf in Aedermannsdorf Von 1797 Bis 1812
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
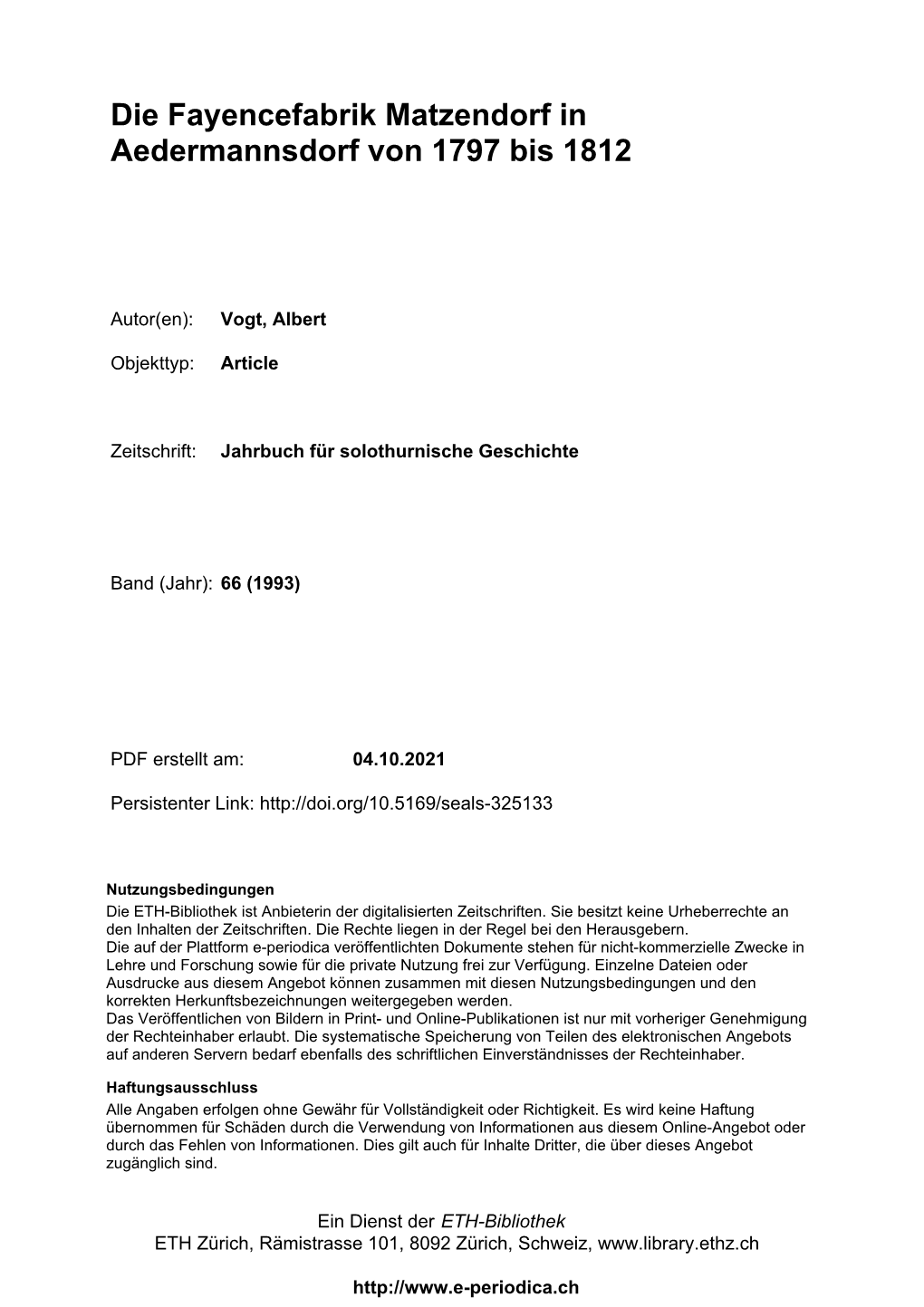
Load more
Recommended publications
-

Local Collaboration Networks and Sustainable Development in Swiss Rural Areas
Strengthening Regional Cohesion: Local Collaboration Networks and Sustainable Development in Swiss Rural Areas Christian Hirschi Institute for Environmental Decisions ETH Zurich 16 September 2009 Abstract This paper makes both a theoretical and empirical contribution to a better understanding of how actor network structures play a crucial role in enhancing sustainable development in rural areas. From a theoretical perspective, the paper discusses the relational aspects of the concepts of sustainability and sustainable development and focuses particularly on the ques- tion, how fragmentation and cohesion of local and regional policy networks may foster or hinder a sustainable development of such regions. Empirically, the paper introduces the new regional park policy in Switzerland in which the federal government aims at a better protec- tion and promotion of rural areas that are of high natural, cultural and scenic value. The paper explores how local and regional collaborative network structures have evolved with two park projects in two Swiss cantons and analyzes these structural configurations using concepts and techniques from Social Network Analysis. Based on two standardized surveys carried out in the two regions, the results show that the projects in both cases mainly strengthened the vertical cooperation between governmental agencies across different administrative levels but horizontal coordination between different societal sectors still remains to be improved and consolidated to meet an important criterion of the concept of sustainable development as defined in the federal government’s Sustainable Development Strategy. Key words Rural sustainable development, cohesion, social network analysis, regional nature parks, Switzerland Contact Dr. Christian Hirschi ETH Zurich Institute for Environmental Decisions Environmental Policy and Economics Universitätstrasse 22, CHN K 76.2 8092 Zurich Switzerland Tel. -

Brass Bands of the World a Historical Directory
Brass Bands of the World a historical directory Kurow Haka Brass Band, New Zealand, 1901 Gavin Holman January 2019 Introduction Contents Introduction ........................................................................................................................ 6 Angola................................................................................................................................ 12 Australia – Australian Capital Territory ......................................................................... 13 Australia – New South Wales .......................................................................................... 14 Australia – Northern Territory ....................................................................................... 42 Australia – Queensland ................................................................................................... 43 Australia – South Australia ............................................................................................. 58 Australia – Tasmania ....................................................................................................... 68 Australia – Victoria .......................................................................................................... 73 Australia – Western Australia ....................................................................................... 101 Australia – other ............................................................................................................. 105 Austria ............................................................................................................................ -

Einwohnergemeinde 4715 Herbetswil
GEMEINDE 4715 HERBETSWIL PROTOKOLL Gemeinderatssitzung 03/21 Vom 25. Februar 2021 19.30 Uhr im Gemeindesaal MZG Herbetswil Vorsitz: Müller Stefan, Gemeindepräsident Protokoll: Allemann Daniela, Gemeindeschreiberin Anwesend: Fluri André, Iseli Martin, Lisser Urs, Müller Stefan, Gautschi Heinz, Allemann Johann Im Weiteren anwesend: Ivo Schindelholz, Natalie Briggeler Entschuldigt: 1. Begrüssung 2. Vergabe Pachtland Obere Wies und Bollenmatt 3. Protokoll der Sitzung vom 28. Januar und Pendenzenliste 4. Vakanzen Kommissionen und Chargen – Stand Anfragen für Besetzung 5. Coronavirus – aktuelle Massnahmen 6. Mitteilungen a. des Gemeindepräsidenten b. aus den Ressorts 7. Rechnungen 8. Geburtstage und Veranstaltungen 9. Verschiedenes 10. Information der Bevölkerung 1. Begrüssung Stefan Müller begrüsst die Ratsmitglieder und insbesondere Natalie Briggeler zur heutigen Sitzung. 2. Vergabe Pachtland Obere Wies und Bollenmatt Stellungnahme und Beschluss Stefan Müller informiert, dass für die Vergabe des Pachtlandes Heinz Gautschi und Johann Allemann nicht in den Ausstand treten müssen, da aufgrund der Bewerbungen beide nicht vom Entscheid betroffen sein werden. Die Öffentlichkeit muss nicht ausgeschlossen werden. Es wurden alle Landwirte angeschrieben, welche eine Gelan-Nummer haben. Stefan Müller sagt, dass André Altermatt in seiner Bewerbung bemängelt, dass ihm bei der Güterregulierung viel Gemeindeland zugeteilt wurde und er deshalb kein weiteres Pachtland von der Gemeinde pachten kann. André Altermatt ist der Meinung, dass nach der Güterregulierung das Gemeindeland auf null gesetzt werden muss. Stefan Müller sagt, dass dieses Vorgehen nicht dem Pachtreglement entsprechen würde und deshalb juristisch angefochten werden könnte. Heinz Gautschi sagt, dass André Altermatt durch die Güterregulierung kein Land verloren hat. Stefan Müller sagt, dass André Altermatt gemäss Reglement kein Gemeindepachtland mehr erhält, da er bei der Güterregulierung viel Gemeindeland erhalten hat. -

Regionaler Richtplan Energie Region Thal Bericht 2
Region Thal Regionaler Richtplan Energie Region Thal Bericht www.bsb-partner.ch 11. November 2015 Regionaler Richtplan Energie Region Thal Bericht 2 Auftraggeber Region Thal Hölzlistrasse 57 4710 Balsthal Patrick Bussmann Verfasser BSB + Partner, Ingenieure und Planer Von Roll-Strasse 29 Tel. 062 388 38 38 Fax 062 388 38 00 E-Mail: [email protected] Tobias Stüdi BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Rev. 3, 11. November 2015 K:\Umweltplanung\Region Thal\21309 Energierichtplan\26 Berichte\Bericht_Energierichtplan_rev3.docx Regionaler Richtplan Energie Region Thal Bericht 3 Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung 8 1 Ausgangslage 9 2 Einleitung 10 2.1 Fragestellung 10 2.2 Vorgehen 10 2.3 Verfahren und Verbindlichkeit 11 3 Grundlagen 12 4 Referenzzustand 14 4.1 Bevölkerung und Arbeitsplätze 14 4.2 Gebäudepark 15 4.3 Wärme- und Prozessenergiebedarf 16 4.3.1 Wohnbereich 16 4.3.2 Dienstleistung, Gewerbe und Industrie 17 4.3.3 Gesamtenergiebedarf Wärme und Prozesse Referenzzustand 18 4.4 Strombedarf Referenzzustand 19 4.5 Bestand Heizungs- und Energieerzeugungsanlagen 20 4.6 CO -Emissionen im Referenzzustand 20 2 4.6.1 CO -Emissionen „Wärme und Prozesse“ 20 2 4.6.2 CO -Emissionen „Strom“ 20 2 4.7 Der Weg zu einer 2000 Watt-Gesellschaft 21 5 Entwicklungsprognose 22 5.1 Bevölkerungs- und Arbeitsplatzentwicklung bis 2035 22 5.2 Bauliche Entwicklung bis 2035 23 5.3 Prognose Wärmeenergiebedarf Wohnbereich: Neubauten bis 2035 24 5.4 Prognose Wärmeenergiebedarf Wohnbereich: Bestand bis 2035 25 5.5 Prognose Wärme- und Prozessenergiebedarf Dienstleistung, Gewerbe und Industrie 26 5.6 Prognose Strombedarf bis 2035 27 6 Energiepotenziale 28 6.1 Sparpotenzial im Wohnbereich 28 6.1.1 Vergleich mit der 2000-Watt-Gesellschaft 31 6.2 Energiepotenziale für Wärme 33 6.2.1 Ortsgebundene hochwertige Abwärme 33 6.2.2 Ortsgebundene niederwertige Abwärme und Umweltwärme 33 BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Rev. -

Einwohnergemeinde Mümliswil-Ramiswil
Verein Region Thal Statutenentwurf Oktober 2012 Beschlossen an der Delegiertenversammlung Verein Region Thal vom 23. Oktober 2012 Zu Handen der Thaler Gemeinden Inhaltsverzeichnis 1. Name, Sitz und Zweck 2. Mitglieder, Austritt 3. Organisation 4. Übergangs- und Schlussbestimmungen; Inkrafttreten 1 Präambel Die in diesen Statuten verwendeten Amts-, Berufs- und Funktionsbezeichnungen gelten in gleicher Weise für Männer und Frauen. 1. Name, Sitz und Zweck § 1 Unter dem Namen „Region Thal“ besteht ein Verein im Sinne von Art. Name und Sitz 60 ff ZGB mit Sitz am Ort der Geschäftsstelle. § 2 Der Verein Zweck a) bezweckt die Vertretung regionaler Interessen nach innen und aus- sen; b) erarbeitet Grundlagen für die kantonale Richtplanung (§ 49 PBG); c) erarbeitet und setzt regionale Entwicklungskonzepte und Leitbilder um; d) bildet die Trägerschaft des regionalen Naturparks und stellt den Betrieb gemäss Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz sicher; e) ist zuständig für die regionale Wirtschaftsförderung in der Region Thal; f) erbringt Dienstleistungen und führt Geschäftsstellen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung auf kommunaler, regionaler und kantona- ler Ebene; g) erbringt Dienstleistungen, bzw. leitet Projekte im Bereich der Neu- en Regionalpolitik des Bundes; h) bearbeitet weitere vom Gesetz vorgesehene oder von Mitgliedern oder dem Vorstand zugewiesene Aufgaben von regionaler Bedeu- tung. 2. Mitglieder, Austritt § 3 1 Der Verein besteht aus den Einwohnergemeinden/Einheitsgemeinden Mitglieder Aedermannsdorf, Balsthal, Gänsbrunnen, Herbetswil, Holderbank, Gemeinden Laupersdorf, Matzendorf, Mümliswil-Ramiswil und Welschenrohr (nachstehend Gemeinden genannt). 2 Mitglied des Vereins kann ferner der Kanton Solothurn sein, vertreten Kanton durch das Bau- und Justizdepartement. Der Regierungsrat entscheidet über die Mitgliedschaft. § 4 1 Der Austritt aus dem Verein ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist Austritt von 12 Monaten auf Ende eines Kalenderjahres zulässig. -

Naturpark Thal
Region Thal SO Streckennetz NaturparkBus © swisstopo (BA 16024) In Kürze Busangebot / Linien NaturparkBus Thal 50.131 Saison 1. Mai – 1. November 2019 Betreiber PostAuto AG , 058 667 13 60 Regionale Partner Naturpark Thal, Raiffeisenbanken Thal, Oensingen-Balsthal-Bahn Auskünfte für Medien Stephan Braun, Projektleiter Tourismus Naturpark Thal, 062 386 12 37 [email protected] sowie Samuel Bernhard (s.u.) Bilder auf Anfrage und in Samuel Bernhard, Geschäftsleiter Bus alpin, 044 430 19 31 hoher Auflösung [email protected] Lage der Linie im Detail (mit ÖV-Haltestellen): www.schweizmobil.ch Touristische Höhepunkte Nahe und gut erreichbare Oase der Ruhe im Einzugsgebiet von Basel, Bern und Zürich Wildromantische Wolfsschlucht mit Höhlen und Auswaschungen Juraweiden mit schönen Ausblicken Detailbeschreibung: siehe www.busalpin.ch Spezielle Angebote / Saisonangebot Fahrgäste gelangen mit dem NaturparkBus neu direkt zu den folgenden Bergwirtschaften: Obere Tannmatt, Hinter Brandberg, Untere Tannmatt, Alpenblick Brunnersberg und Güggel. Wenige Gehmi- nuten von den Haltestellen entfernt befinden sich wei- tere Gasthäuser und Bergwirtschaften. Weitere Infos und Wandervorschläge: www.naturparkthal.ch Nationale Träger Nationale Sponsoren Region Thal SO Fahrplan des NaturparkBus Thal (Linie 131) Balsthal – Matzendorf, Brunnersberg – Aedermannsdorf, Güggel – Balsthal Sonn- und Feiertage 1. Mai bis 1. November 2019, inkl. 1. Mai, 20. Juni, 15. August und 1. November. Hinfahrt mit Bus alpin Balsthal, Bahnhof ab 09.33 12.33 16.33 Laupersdorf, -

BALSTHAL | Solothurn Internet
eLexikon Bewährtes Wissen in aktueller Form BALSTHAL | Solothurn Internet: https://peter-hug.ch/lexikon/balsthal MainSeite 41.144 BALSTHAL 3 Seiten, 1'667 Wörter, 12'099 Zeichen Wappen der Amtei Balsthal. Balsthal, Amtei des Kantons Solothurn. Sie besteht aus den Bezirken (Wahlkreisen) Balsthal-Thal und Balsthal-Gäu. Ersterer wird gebildet durch die Weissenstein-, Hauenstein- und Passwangkette des Juragebirges und durch zwei lange, schmale Thäler. Aus dem Balsthaler-Thal gelangt man durch Klusen in das Guldenthal, in das Gäu und ins Münsterthal. [Karten in der Umgebung].Amtei Balsthal. Auf den Höhen liegen schöne Sennberge (Brunnersberg, Sangetel, Güggel, Tannmatt, Roggen, Passwang, Limmern, Hauberg, Breiten, Fahrnisberg, Schwengimatt etc.), an den Abhängen ausgedehnte Waldungen, zerstreute Höfe und grosse Allmenden. In den Thälern ist das Land, obschon zum grossen Teil uneben, gut angebaut und ertragreich. Durch Korrektion der Dünnern und des Augstbaches (vollendet 1868; Kosten 356519 Fr.) ist viel Kulturland gewonnen worden. Der Bezirk umfasst 13900,55 ha, nämlich 4246,94 ha Wies- und Ackerland, 814,82 ha Allmend, 2707,8 ha Weideland, 6025,14 ha Waldboden und 105,84 ha unkultiviertes Land. Der Wald teilt sich in 135,95 ha Staatswald, 3722,45 ha mehr Gemeindewald, 77,26 ha Korporationswald und 2089,48 ha Privatwald. In der Thalmulde des Balsthaler-Thales liegen fast in gerader Linie die Dörfer Gänsbrunnen, Welschenrohr, Herbetswil, Aedermannsdorf, Matzendorf, Laupersdorf, Balsthal und, östlich auf erhöhter Thalstufe, Holderbank. Im Guldenthal sind Mümliswil und Ramiswil. Zu Laupersdorf gehört der Weiler Hönggen. Die Ortschaft Klus hat eine besondere Schule und besonderes Korporationsvermögen, gehört aber, wie auch St. Wolfgang, zur politischen Gemeinde Balsthal. Ramiswil ist seit 1859 eine besondere Kirchgemeinde und hat eine eigene Schule, gehört jedoch politisch zu Mümliswil. -

Landschaftsqualitätsprojekt Thal
Trägerschaft: Einwohnergemeinden Thal Rev. 22. August 2016 Landschaftsqualitätsprojekt Thal Bild: Archiv Wallierhof Bericht 2 Projekt-Trägerschaft: Einwohnergemeinden des Bezirks Thal (Balsthal, Laupersdorf, Aedermannsdorf, Matzendorf, Herbetswil, Welschenrohr, Gänsbrunnen, Mümliswil-Ramiswil, Holderbank) Arbeitsgruppe Vernetzung Thal (Kurt Bloch, Präsident AG und Gemeindepräsident Mümliswil-Ramiswil und Edgar Kupper, Vizepräsident AG und Gemeindepräsident Laupersdorf) Mitwirkung: Norbert Emch, Amt für Landwirtschaft, Solothurn Thomas Schwaller, Amt für Raumplanung, Solothurn Mark Struch, Amt für Jagd, Wald und Fischerei, Solothurn Martina Ruh, Bildungszentrum Wallierhof, Riedholz Martin Aegerter, Amt für Landwirtschaft, Solothurn Richard Bolli, Leiter Naturpark, Hölzlistrasse 57, 4710 Balsthal Dr. Arianne Hausamman, Pro Natura, Solothurn Peter Brügger, Solothurner Bauernverband SOBV, Solothurn Karl Tanner, Verband Solothurner Einwohnergemeinden VSEG 3 Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeine Angaben zum Projekt ........................................................................................................... 4 1.1. Initiative ............................................................................................................................................ 4 1.2. Projektorganisation .......................................................................................................................... 4 1.3. Projektgebiet ................................................................................................................................... -

Hinterer Brandberg - Herbetswil - Balsthal Balsthal - Brunnersberg - Güggel Stand: 9
FAHRPLANJAHR 2021 50.131 NaturparkBus Thal: Hinterer Brandberg - Herbetswil - Balsthal Balsthal - Brunnersberg - Güggel Stand: 9. November 2020 Montag–Sonntag Montag–Sonntag 13101 13103 13105 13107 13100 13102 13104 Herbetswil, Hinterer Brandberg 12 52 Aedermannsdorf, Güggel 11 00 14 00 Herbetswil, Mieschegg 10 00 13 00 15 00 Matzendorf, Brunnersberg 09 05 11 05 14 05 Herbetswil, Tannmatt 10 01 13 01 15 01 Laupersdorf, Alpenblick 09 08 11 08 14 08 Herbetswil, Untere Tannmatt 10 04 13 04 15 04 Laupersdorf, Stierenberg 09 09 11 09 14 09 Herbetswil, Vorderer Brandberg 10 11 13 11 15 11 Laupersdorf, Bremgarten 09 14 11 14 14 14 Herbetswil, Dorf 10 16 13 16 15 16 Laupersdorf, Höngen 09 19 11 19 14 19 Aedermannsdorf, Staatsstrasse 10 18 13 18 15 18 Balsthal, Zentrum 09 24 11 24 14 24 Matzendorf, Mühle 10 20 13 20 15 20 Balsthal, Bahnhof 09 27 11 27 14 27 Laupersdorf, Dorf 10 22 13 22 15 22 Balsthal ab 09 32 11 32 14 32 Balsthal, Bahnhof 10 27 13 27 15 27 Oensingen an 09 40 11 40 14 40 Balsthal ab 10 32 13 32 15 32 Oensingen ab 09 18 11 18 14 18 Oensingen an 10 40 13 40 15 40 Balsthal an 09 26 11 26 14 26 Oensingen ab 08 18 10 18 13 18 Balsthal, Bahnhof 09 31 11 31 14 31 Balsthal an 08 26 10 26 13 26 Laupersdorf, Dorf 09 36 11 36 14 36 Balsthal, Bahnhof 08 31 10 31 13 31 Matzendorf, Mühle 09 38 11 38 14 38 Balsthal, Zentrum 08 33 10 33 13 33 Aedermannsdorf, Staatsstrasse 09 40 11 40 14 40 Laupersdorf, Höngen 08 38 10 38 13 38 Herbetswil, Dorf 09 42 11 42 14 42 Laupersdorf, Bremgarten 08 43 10 43 13 43 Welschenrohr, Zentrum 09 47 11 47 14 47 Laupersdorf, Stierenberg 08 48 10 48 13 48 Welschenrohr, Lochboden 09 54 11 54 14 54 Laupersdorf, Alpenblick 08 49 10 49 13 49 Herbetswil, Mieschegg 10 00 12 00 15 00 Matzendorf, Brunnersberg 08 52 10 52 13 52 Herbetswil, Hinterer Brandberg 12 09 Aedermannsdorf, Güggel 10 58 13 58 Zeichenerklärung vom 2.5.–31.10. -

Zonenplan Bern Libero
Zonenplan Waldenburg Langenbruck Egerkingen Passwang 282 Breitenbach Zwingen Mümliswil Holderbank Ramiswil Industrie Olten Oberbuchsiten Laupersdorf Matzendorf Balsthal Thalbrücke 281 Aedermannsdorf Neuendorf 280 Klus Olten Herbetswil Nieder- Unterdorf 279 Oensingen buchsiten Moutier Welschenrohr Zone 250: Niederbipp Industrie Kestenholz Niederbipp Rain Nur für Abonnemente Vorder- Wolfwil Olten sowie Tageskarten Oberbalmberg Balmberg Wolfisberg Oberbipp Gänsbrunnen Farnern Holzhäusern ALLE ZONEN gültig Balm Längmatt Rumisberg Olten b. Günsberg Wiedlisbach 215 Günsberg Oberdorf SO Bannwil Murgenthal Grenchenberg Moutier 201 Niederwil Aarwangen Rüttenen Attiswil Vorstadt Roggwil – Wynau Im Holz Langendorf Hubersdorf Flumenthal Walliswil b.W. 193 Hard-Mumenthal Kaltenherberg Lommiswil St. Niklaus SO Wangen Roggwil Dorf Holzerhütte Allmend Riedholz an d. Aare Gaswerk Hubel Amthaus- Heimenhausen IndustrieLangenthal Nord St. Urban platz Däderiz Studen Baseltor Feldbrunnen Wangenried Breitenfeld Allmend Ziegelei 216 Bützberg Lingeriz Selzach West Deitingen Röthenbach b.H. 190 191 250 Solothurn Süd Obersteckholz Bellach Zuchwil Luterbach- Lotzwil Grenchen Attisholz Sonnmatt Brühl Inkwil Am Wald Nord Bettlach Gutenburg Lengnau 201 Wanzwil Rotwald Monbijou Grenchen 200 Subingen Etziken Bolken Bleienbach Niederönz Madiswil Biel/Bienne Industrie Altreu Lüsslingen Horriwil ThunstettenThörigen Derendingen Hüniken Herzogenbuchsee Melchnau Grenchen Süd Ost Nennigkofen Lindenholz Biberist RBS Aeschi 192 BBZ 201 Oekingen Oberönz Oberdorf Altbüron Flughafen -

JAHRESBERICHT 2018 Impressum
JAHRESBERICHT 2018 Impressum Verein Region Thal Hölzlistrasse 57 4710 Balsthal Telefon 062 386 12 30 [email protected] www.regionthal.ch www.naturparkthal.ch Redaktion Bruno Born, Jasmine Hartmann Coverbild La Route Verte Design Javier Alberich Satz Jasmine Hartmann Druck Grico-Druck AG, Welschenrohr Auflage 100 Exemplare INHALTSVERZEICHNIS VORWORT DES PRÄSIDENTEN................................................................................................................................................ 5 NATURPARK THAL ...................................................................................................................................................................... 6 1. Personelles ...................................................................................................................................................................... 6 2. Erneuerung Label Regionaler Naturpark ............................................................................................................... 6 3. Wirtschaft ........................................................................................................................................................................ 6 4. Natur und Landschaft ...................................................................................................................................................7 5. Tourismus ..........................................................................................................................................................................7 -

Netzplan Region Thal
525 eufelsschlucht Olten T Hägendorf Schulhaus Spitzacker Weinhalden Allerheiligenberg Rank Allerheiligenberg Allerheiligenberg Restaurant Höhenklinik Allerheiligenberg Gnöd Olten 501 505 aldenburg Solothurnerstrasse W Gässli Olten 555 513 Olten Liestal aldenburg W 555 525 Bahnhof94 07 5 Revue Thommen Bärenwil HägendorfHalbrüti Hägendorf Bodenmatt Bahnhof Bürgerschopf 501 Hauenstein Kappel Schulhaus Spittel Thalrich Egerkingen Dürrenberg Kappel Kreuz Briefzentrum Gunzgen Industrie 94 Bielgraben Gunzgen Unterdorf Passhöhe 555 LangenbruckLangenbruck Dorf Gäupark Gunzgen Zentrum Gäupark Kreisel Härkingen Pflug Zentrum 501 528 Widenfeld Altgraben Lischmatte 507 507 Pfannenstiel Härkingen Lamm 525 Egerkingen Bahnhof Neuendorf Unterdorf Unterdorf Langenbruck Steinbruch Holderbank SO Neuendorf Olten Ramelen Migrosstr. Schulhaus Weier Holderbank SO Dorfplatz 126 126 126 Löwen Bifang Neuendorf Hardeck Ramiswil Seblenhof 126 528 Oberbuchsiten Ganggeler Migros Industrie Niederbuchsiten Linde Mümliswil Balsthal Neuendorf olfwil Alpenblick MümliswilMümliswil SchulhausKammfabrik PostLobisei 127 124 Neuendorf Kirche Niederbuchsiten Sonne W 525 Pfadiheim Roggen Passwang Bahnhof Kestenholz Mühle Neu Bechburg . Scheltenstrasse Zentrum Balsthal BalsthalPost Bahnhof Schlossstrasse Oberbuchsiten Kastanienbaum 115 Ramiswil Dorf 505 115 94 Bifang Oberbuchen Oensingen 127 127 Schule Oberdorf dorf Abzw Brauerei 115 Jurastrasse Fulenbacherstrasse Netzplan RegionNeuhüsli Thal St. Wolfgang Gallihof 129 Bubenrain Oensingen Rain olfwil Schulhaus Oberbeinwil Kapelle