Geschichtliche Zusammenfassung Des Ehem
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
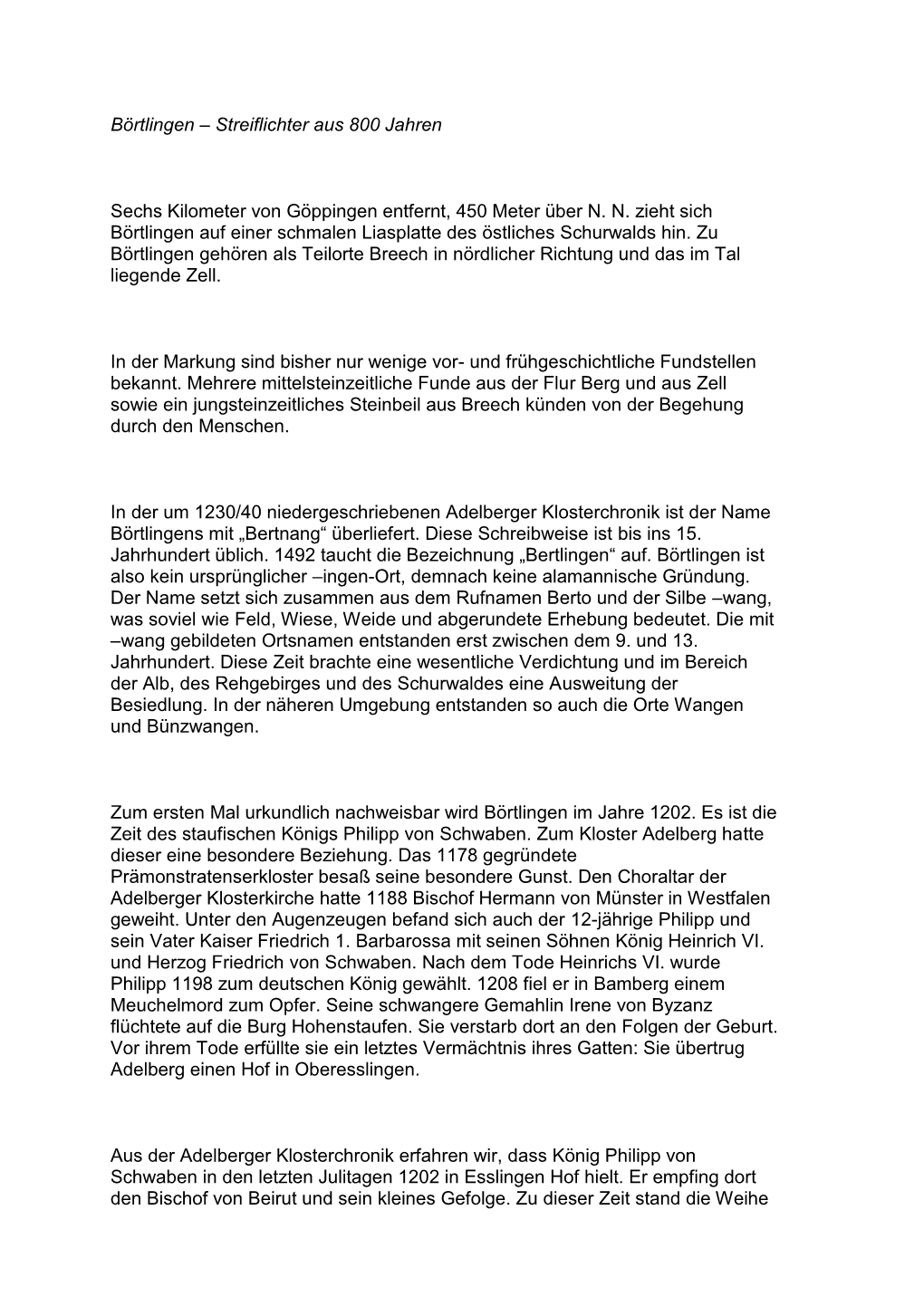
Load more
Recommended publications
-

Liste Ambulante Pflegedienste Im Landkreis Göppingen
Ambulante Pflegedienste im Landkreis Göppingen Stand Mai 2021/ Angaben ohne Gewähr Gemeinde Pflegedienst Kontakt Einzugsgebiet Bad Boll Diakoniestation Raum Bad Boll Telefon: Aichelberg, Bad Boll, Dürnau, Gammelshausen, Blumhardtweg 30 07164/2041 Hattenhofen, Zell unter Aichelberg. 73087 Bad Boll www.diakoniestation-badboll.de E-Mail: [email protected] Bad Überkingen Pflegedienst Mirjam Care GmbH & Co. Telefon: Bad Ditzenbach und Teilorte, Bad Überkingen KG 07331/951520 und Teilorte, Deggingen mit Reichenbach, Amtswiese 2 Drackenstein, Geislingen und Teilorte, 73337 Bad Überkingen E-Mail: Gruibingen, Hohenstadt, Kuchen, Mühlhausen, www.mirjam-care.de [email protected] Wiesensteig Böhmenkirch Pflegedienst Mirjam Care Böhmenkirch Telefon: Böhmenkirch und Teilorte, Donzdorf und GmbH 07332/9247203 Teilorte, Geislingen und Teilorte, Lauterstein Buchenstraße 44 89558 Böhmenkirch E-Mail: www.mirjam-care-boehmenkirch.de info@mirjam-care- boehmenkirch.de 1 Gemeinde Pflegedienst Kontakt Einzugsgebiet Deggingen Sozialstation Oberes Filstal Telefon: Bad Ditzenbach und Teilorte, Deggingen mit Am Park 9 07334/8989 Reichenbach, Drackenstein, Gruibingen, 73326 Deggingen Hohenstadt, Mühlhausen, Wiesensteig www.sozialstation-deggingen.de E-Mail: sozialstation-deggingen@t- online.de Donzdorf Sozialstation St. Martinus Telefon: Böhmenkirch und Teilorte, Donzdorf und Hauptstraße 60 07162/912230 Teilorte, Lauterstein 73072 Donzdorf www.sozialstation-donzdorf.de E-Mail: [email protected] Ebersbach Dienste für Menschen gGmbH Telefon: -

S BLÄTTLE Gut Informiert
t Gut informier rauf uber s Leben am Albt s BLÄTTLE RAUM BAD BOLL AMTLICHES MITTEILUNGSBLATT DER GEMEINDEN AICHELBERG BAD BOLL | DÜRNAU | GAMMELSHAUSEN | HATTENHOFEN | ZELL U. A. 52. Jahrgang, Nummer 13 Donnerstag, 1. April 2021 Einzelpreis 0,70 € „Ostern ist eine Zeit, in der man sich mit dem Leben entzünden kann. Lebe mit neuer Hoffnung und frischem Licht!“ Das ist die Botschaft von Ostern. An Ostern geht es um das Leben. Ostern ist die Einladung, einen neuen Anfang zu wagen. Ostern ist die Einladung, neu zu beginnen durch alle Dunkelheiten, Traurigkeiten, Ängste und Einsamkeiten hindurch. Und dieses Fest ist die Zusage, dass das letzte Wort immer die Hoffnung und die Liebe hat. Liebe Bürgerinnen und Bürger im Raum Bad Boll, wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest, lassen Sie es sich gut gehen und genießen Sie die Tage! Ihre Bürgermeister Seite 2 ’s Blättle Informationsseite Nr. 13 / 1. April 2021 ständig von Montag bis Donnerstag jeweils von 18.00 bis 8.00 Uhr Aus dem Inhalt: Seite am Folgetag und am Freitag von 16.00 bis 8.00 Uhr am Folgetag. An Wochenenden und Feiertagen: Gemeinsame amtliche Bekanntmachungen 1 Ärztlicher Bereitschaftsdienst durch die Notfallpraxis in Kirchheim Notdienste 2 (auf dem Gelände des Kreiskrankenhauses) an Samstagen, Sonn- Sonstige Mitteilungen 5 und Feiertagen von 8.00 bis 23.00 Uhr. Gemeinde Aichelberg 6 Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gemeinde Bad Boll 10 Gemeinde Dürnau 26 … für Bad Boll, Dürnau, Gammelshausen, Hattenhofen, Gemeinde Gammelshausen 33 Zell u. A.: Gemeinde Hattenhofen 36 An Werktagen von Montag bis Freitag: Gemeinde Zell u. A. 43 Unter obiger Rufnummer ist der ärztliche Bereitschaftsdienst er- reichbar. -

Freizeit FÜHRER
Freizeit FÜHRER Sehenswertes im Landkreis Göppingen – Entdecken und Erleben an Albtrauf, Fils und im Stauferland. IMPRESSUM Herausgeber Landratsamt Göppingen Büro für Kreisentwicklung und Kommunikation Lorcher Straße 6, 73033 Göppingen Telefon 07161 202-1007 [email protected] www.landkreis-goeppingen.de Konzept, Kartografie & Gestaltung MORETTI.world Jasmin Moretti & Manuel Moretti GbR www.moretti.world Bildnachweise Andreas Schober, Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Erlebnisregion Schwä bischer Albtrauf, fotolia: Bluepilot, cut, Melima, SusaZoom; Gerhard Skutta, Giacinto Carlucci, göppingercity e.V., Hannes Köble, Heiko Hermann, Heiner Späth, Kaiser Brauerei, Kunstgießerei Strassacker, Landrats amt Göppingen, Martin Paule, Reha klinik Bad Boll, Stadt marketing Göppingen, Städte und Gemeinden aus dem Landkreis Göppingen, Stephan Durant, stock.adobe.com: Kzenon, Martina Berg, yanlev, Romolo Tavani; Straubmühle, Susanne Rauh / Göppinger Technikforum e.V., Tobias Fröhner, Touristik- gemeinschaft Staufer land e.V., Vinzenz Therme Bad Ditzenbach, Walter A. Schaefer, Winfried Tommerdich, WMF AG ©Landratsamt Göppingen 2. Auflage, Oktober 2019 Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der genannten Angaben übernommen. Auszüge und Veröffentlichungen aus dieser Broschüre nur mit Genehmigung des Herausgebers. Landkreis Göppingen – Überraschend. Attraktiv. 2 | 3 HERZLICH WILLKOMMEN! Landkreis Göppingen – Überraschend. Attraktiv. INHALTSVERZEICHNIS Landkreis Göppingen – Überraschend. Attraktiv. 06 Daten und Fakten . 07 Touristische Highlights -

PDF "Ortsprospekt Bad Boll 2020-2021"
Bad Boll Ein ganz erstaunlicher Kurort! Ortsprospekt Gastgeberverzeichnis 2020 / 2021 2 3 Herzlich Willkommen Württembergisch‘ Wunderbad ...bei uns in Bad Boll Vom Wunderbad zum modernen Kurort ModerneBad Boll, ein lebendiger Ort, eingebettet in die Natur Bad Boller Jurafango – gewonnen aus den Gesteinsschichten des Schwarzen Jura Moderner Kurort „Württembergisch‘ Wunderbad“ Württembergisch‘ Wunderbad 3 wurde Bad Boll im Volksmund lan- Berta von Boll 4 ge Zeit genannt. Dieser Ausdruck Die Blumhardts 5 stammt aus dem 16. Jahrhundert, Naturerlebnis pur 6 als man bei Grabungsarbeiten Fairtrade Gemeinde 7 erstmals auf Versteinerungen von Meerestieren stieß. Es ist nicht Wohlbefinden das einzige Wunder geblieben. Die moderne Rehaklinik 8 Gleich drei ortsgebundene Heil- MineralTherme und Vitalzentrum 10 mittel weist Bad Boll auf: die jahr- Die drei Heilmittel 11 hundertealte Schwefelquelle, den WALA Heilmittel GmbH 12 Boller Jurafango und das Thermal- Kulturgut Mineralwasser. Evangelische Akademie Bad Boll 14 Kulturgenuss 16 Lebenslust Kleinkunst und Feste feiern 17 Bad Boll ist ein Schmelztiegel vieler geistiger Strömungen und ein Ort mit einer ganz besonderen Geschichte. Hier tref- fen Sie überall auf große Namen und historische Bauwerke, die bis in die Stauferzeit zurückreichen. Durch die Evangelische Naturerlebnis Akademie und viele anthroposophische Einrichtungen, wie die WALA Heilmittel GmbH, die hier ihr Zuhause gefunden hat, ist Löwenpfad Berta-Hörnle-Tour 18 Bad Boll über die Grenzen Europas hinaus bekannt und genießt großes Ansehen. Für Kurgäste, Naturliebhaber, Geschichts- Albtraufgänger 19 interessierte, Fossilienbegeisterte, Tagungs- und Feriengäste ist Bad Boll auf jeden Fall immer einen Besuch wert. Aber auch Freizeitaktivitäten in Bad Boll 20 für alle, die nur in einer anmutigen Kulturlandschaft ausspannen und die Ruhe genießen möchten. -

Gemeinde Birenbach Begrüßt Ihre Neue Erdenbürgerin Aufs Herzlichste
8 Birenbach Schurwaldbote . Nr. 33 . Donnerstag, 16. August 2012 Gemeindehaus: Vermietung, Einführung und Abnahme, Frau Gisela Trunetz: Tel.: 913097 oder e-mail: TSV Adelberg-Oberberken [email protected]. 1891e.V. Pfarrsekretariat: Dienstagvormittags, ab 10.00 h, donners- tagnachmittags ab 16.00 h, Frau Irmtraud Dannenhauer/Frau Der TSV Adelberg-Oberberken gratuliert folgenden Ramona Storkenmaier, Tel. 361, Fax: 91925, Mitgliedern zum Geburtstag: [email protected] Kirchenpflege: Frau Beate Stähle, Tel. 1301, Bürozeiten: Monika Dobler und Reinhilde Schurr. Donnerstags 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr, Wir wünschen beiden von Herzen alles Gute, viel Glück, [email protected], das Büro der Kirchenpflegerin befin- Erfolg und vor allem Gesundheit. det sich in der Hinteren Hauptstraße 12. Der Vereinsvorstand Bankverbindung: Evang. Kirchenpflege Adelberg, Kreissparkasse Göppingen, Kto. Nr. 29146, BLZ 610 500 00 Evangelische Landeskirche Württemberg: www.mehr-als-man-glaubt.de Birenbach Neuapostolische Kirche Adelberg Mittwoch, 15. August Mitteilungen der Gemeinde 20.00 Uhr Gottesdienst Sonntag, 19. August Feuerwerke in Birenbach 9.30 Uhr Gottesdienst Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie gerne über die Dienstag, 21. August 20.00 Uhr Chorprobe allgemeinen Bestimmungen über das Abbrennen pyrotechni- scher Gegenstände informieren: Mittwoch, 22. August 20.00 Uhr Gottesdienst durch Bischof Eberhard Koch Abbrennverbote: Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 (und höher) Weitere Informationen im Internet unter http://adelberg.nak-goeppingen.de sowie dürfen in der Zeit vom 02. Januar – 30. Dezember nicht www.magxonline.de verwendet (abgebrannt) werden. Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr dürfen pyro- technische Gegenstände der Kategorie 2 (und höher) auch Mitteilungen der Vereine am 31. -

Festschrift 50 Jahre Auferstehungskirche Sparwiesen
Festschrift 50 Jahre Auferstehungskirche Sparwiesen Evangelische Kirchengemeinde Uhingen 1960 bis 2010 1 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis: Programm des Festwochenendes Seite 1 Blicke auf die Auferstehungskirche Seite 2 Grußworte Seite 6 Der frühere „Kirchenbezirk“ Uhingen Seite 11 Stationen auf dem Lebensweg: Wie war es früher? Seite 12 Gottesdienste vor 1960 Seite 14 Der Wunsch nach einer Kirche: Baugeschichte Seite 15 Veranstaltungen, Gruppen und Chöre seit 1960 Seite 24 Lebensstationen heute Seite 38 Evangelische Kirchengemeinde heute Seite 40 Konfirmationen durch die Zeit Seite 41 Menschen im Dienst an der Auferstehungskirche Seite 42 Herausgeber: Evangelisches Pfarramt Uhingen Süd Helfensteinstraße 1 73066 Uhingen Redaktionsteam: Werner Litz, Ortsvorsteher Sparwiesen von 1972 bis 2009 Joachim Klein, Pfarramt Uhingen Süd Quellen: Heimatbuch „O Heimatland Sparwiesen“, Otmar Traub, 1994 Festschrift zum 25-jährigen Jubiläum der Auferstehungskirche, Pfarrer Joachim Beck 2 Auferstehungskirche im Winter 2010 Programm des Festwochenendes 23. Juli 2010 bis 25. Juli 2010: Freitag, 23.07.2010: 19.30 Uhr, Auferstehungskirche, Auftaktkonzert unseres Gospelchors „Get Alive“ mit Band Samstag, 24.07.2010: 21.00 Uhr, Kirchplatz „Open-Air-Filmnacht“ (Jugendgruppe „Free9“ und „K.i.A.“-Team des CVJM Uhingen) Sonntag, 25.07.2010: 09.30 Uhr, Auferstehungskirche, Festgottesdienst mit den Kinderkirchen und Kirchenchören 10.30 Uhr, Auferstehungskirche n Eine Runde Rückschau: 1. Taufe am Einweihungstag 18.12.1960 1. Trauung am 07.02.1061 1. Konfirmation -

1. Nachbarschaftshilfen in Den Städten Und Gemeinden
1. Nachbarschaftshilfen in den Städten und Gemeinden Hilfsangebot Kontakt Für wen Was Wo Adelberg Telefon: 07166 910110 Für Menschen mit erhöhtem Einkaufen Adelberg Rathaus Adelberg gesundheitlichem Risiko und Apothekengänge Montag, Mittwoch: 8:00 - 12:00 Uhr für ältere Menschen Dienstag: 10:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr Donnerstag: 10:00 - 12:00 Uhr und 16:00 - 18:00 Uhr Freitag: 10:00 - 12:00 Uhr E-Mail: [email protected] Aichelberg Telefon: 07164 9199344 Für alle, die im Moment nicht Einkäufe aller Art, weitere Aichelberg Evangelische Jugend in selber einkaufen können Besorgungen nach der Kirchengemeinde Montag - Samstag: 10:00 - 14:00 Uhr Absprache Zell u.A. / Aichelberg Albershausen Telefon: 07161 309310 Für Menschen mit erhöhtem Einkäufe aller Art, weitere Albershausen Gemeinde in gesundheitlichen Risiko und für Besprechungen nach Zusammenarbeit mit den Mo, Di, Do 8:00-12:00 Uhr ältere Menschen Di 15:00-18:00 Uhr Absprache Royal Rangers und Do 14:00-16:00 Uhr weiteren Ehrenamtlichen Fr 8:00-11:30 Uhr Email: [email protected] siehe: www.albershausen.de 1 Hilfsangebot Kontakt Für wen Was Wo Bad Boll Telefon: 07164 9279812 Für Menschen, die aus Einkaufen von Ware aus Bad Boll Bad Boller gesundheitlichen Gründen - dem Bad Boller Dorfladen Dorfladen e.G. am besten zwischen 13:30 - 15:00 Uhr entweder weil sie chronisch (auch frankierte Post kann werktäglich, da Kolleginnen im Laden in der krank sind oder zur mitgenommen werden) übrigen Zeit sehr beschäftigt sind Risikopersonengruppe gehören, nicht aus dem Haus können Bestellungen -

Aus Eschenbach & Heiningen Mittwoch, 19
Nummer 25 Mittwoch, 19. Juni 2019 44. Jahrgang Voralb-Blättle Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinden Eschenbach und Heiningen Diese Ausgabe erscheint auch online Eschenbach Heiningen NummeNummer1r144 Mittwoch,Mittwoch, 4.4. AprilApril 20122012 37.37. JahrganJahrgangg An Fronleichnam am Donnerstag, 20. Juni 2019 laden wir alle Gemeindemitglieder unserer Seelsorgeeinheit ganz herzlich nach Heiningen zum Festgottesdienst um 10:30 Uhr in der St. Thilo-Kirche, bei gutem Wetter auf der Pfarrwiese, ein. Anschließend sind Sie zum Gemeindefest bei warmem Mittagessen, Gegrilltem sowie Kaffee und Kuchen im ökumenischen Gemeindehaus oder bei gutem Wetter auf der Pfarrwiese herzlich willkommen. Der Erlös soll an das Caritas Baby Hospital – Kinderhilfe Bethlehem gehen. Erntebittgottesdienst am Sonntag, 23. Juni 2019 10:00 Uhr mit Pfrin. Schieber und Pfr. Hauff und Gästen aus Palästina In der Feldscheune von Fam. Forster, Haagweg (hinter der Alpakafarm) Groß und Klein, Alt und Jung sind herzlich willkommen! Für die Kinder gibt es Kinderkirche! Der Posaunenchor und der Kirchenchor werden den Gottesdienst musikalisch gestalten. Keiner lebt für sich allein Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit zum gemütlichen Beisammensein nach Römer 14,7a beim Kirchencafé und Mittagessen. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Die evang. Kirchengemeinden Eschenbach und Heiningen laden sehr herzlich ein. Gemeinsame Mitteilungen Vorschau: Voralbhalle Freitag, 28.06.2019 Musikverein Heiningen-Eschenbach, Vlado Kumpan und seine Öffnungszeiten Bistro Voralbhalle: Musikanten Samstag, 29.06.2019 Montag: Ruhetag Musikverein Heiningen-Eschenbach, Dorfrausch mit den Party- Dienstag: 17.00 - 22.00 Uhr fürsten Mittwoch bis Freitag: 15.00 - 22.00 Uhr Sonntag, 30.06.2019 Samstag und Sonntag: 11.00 - 20.00 Uhr Musikverein Heiningen-Eschenbach, Filstalmusikerringtreffen Bitte beachten: Weitere Angebote: Die Voralbhalle ist auch dieses Jahr wieder in den Pfingst- Essen, Trinken, Minigolf, Pit-Pat, Kegeln oder einfach nur ferien von Montag, den 10.06. -

Tarifzoneneinteilung Gültigkeit Ab 01.01.2021
Tarifzoneneinteilung Gültigkeit ab 01.01.2021 Geltungsbereich Beilstein 6 Die Tickets des VVS-Gemeinschaftstarifs gelten innerhalb des Verbundgebiets (Landeshauptstadt Stuttgart, Landkreise Böblingen, Esslingen, Ludwigsburg, Göppingen und Rems-Murr-Kreis) in S-Bahn-Zügen und anderen Zügen des Nahverkehrs, Stadtbahnen und Bussen der SSB und Bussen aller privaten und kommunalen Verkehrsunternehmen. Oberstenfeld Hinzu kommen die Bahnhöfe Waldhausen und Lorch im Ostalbkreis. Für Fahrten zwischen den vorgenannten Bahnhöfen und dem VVS-Gebiet gelten alle VVS-Tickets der entsprechenden Preisstufe. Für Fahrten innerhalb des Ostalbkreises Großbottwar Wüstenrot gelten die Tarife von Ostalbmobil. Es gelten die Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen des VVS. Für Ruftaxis gelten teilweise besondere Tarife. Tickets mit einer Gültigkeit bis Betriebsschluss gelten bis 5:00 Uhr des Folgetages. Bönnigheim Kirchheim (N) Gemmrigheim Steinheim (M) 6 Hessigheim Mundelsheim Mainhardt Fahrpreisermittlung Walheim Ingersheim Spiegelberg Besigheim Murr Der Fahrpreis richtet sich nach der Anzahl der Tarifzonen, die befahren werden. Start- und Zielzone zählen mit. Pleidelsheim Häfnerhaslach Erligheim Aspach Haltestellen auf Tarifzonengrenzen zählen zu der Zone, in der die Fahrt durchgeführt wird. Hohenhaslach Sachsenheim Großerlach Ochsenbach Freudental Marbach (N) Sulzbach(M) Spielberg Löchgau Kirchberg (M) Burgstall Oppen- weiler Benningen Erdmannhausen Murrhardt Mitnahmeregelung Sersheim Oberriexingen Erbstetten Strümpfelbach Mit persönlichen Zeittickets (Jahres-, Monats- u. WochenTickets für jedermann, (9-Uhr-) Firmen-Abos, Vaihingen (E) Freiberg (N) Backnang Fornsbach 9-Uhr-Tickets, SeniorenTickets) ist an Sa, So und Feiertagen die unentgeltliche Mitnahme von bis zu 3 Bietigheim-Bissingen Weissach i.T. Kindern (6 –17 Jahre) oder aller eigenen Kinder (6 –17 Jahre) möglich. Erweiterte Mitnahmeregelung für Poppenweiler übertragbare JahresTicketPlus. Unentgeltliche Mitnahme von 1 Hund für Inhaber von gültigen Zeittickets. Tamm Favoritepark Auenwald Hoheneck Maubach Allmersbach i.T. -

Gemeinde Wangen Im Landkreis Göppingen Lebenshilfe Göppingen
www.gemeinde-wangen.de Informationsbroschüre Gemeinde Wangen im Landkreis Göppingen Lebenshilfe Göppingen Ziel der Lebenshilfe ist es, das Wohl von Menschen mit Behinderung und ihrer Familien zu fördern. Sie setzt Auf dem Wangener Albert-Rapp-Hof entsteht derzeit das jüngste sich dafür ein, dass jeder Mensch mit Projekt der Lebenshilfe Göppingen: ein Bio-Bauernhof mit Arbeits- Behinderung so selbstständig wie plätzen für Mitarbeiter der Lebenshilfe-Werkstätten. möglich leben kann und dass ihm soviel Schutz und Hilfe zuteil wird, Eine Hofgruppe von sechs Mitarbeitern kümmert sich gemeinsam mit den wie er für sich benötigt. Hof- und Gruppenleitern um 60 Ziegen und zukünftig etwa 200 Hühner. Eine tolle Chance und Herausforderung für die Mitarbeiter mit psychischer 1963 als Elternverein gegründet, oder geistiger Behinderung – denn auf dem Hof herrschen ähnliche Arbeits- zählt sie inzwischen rund 600 bedingungen wie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Mitglieder und betreut etwa 1.200 Menschen mit Behinderung. Ab 2015 sollen verschiedene Ziegenspezialitäten produziert Auch wird der Verein durch viele und angeboten werden wie Käse, Joghurt, Milch und Fördermitglieder in seiner Arbeit Ziegenfl eisch; frische Bio-Eier und einiges mehr unterstützt. ergänzen das Sortiment. Die Lebenshilfe begleitet die Schauen Sie vorbei, Menschen mit Behinderung von der wir freuen uns auf Geburt bis zum Ende ihres Lebens Ihren Besuch! mit einer Vielzahl von Angeboten in allen Bereichen des Lebens wie Bildung, Arbeit, Wohnen oder Freizeit. Anschrift Lebenshilfe Göppingen e.V. Heubachstr. 6-10 · 73092 Heiningen Fon 07161 94044-0 www.lh-goeppingen.de Albert-Rapp-Hof · Lebenshilfe Göppingen · Weilerweg 27 · 73117 Wangen Mobil 01575 6320987 · [email protected] · www.lh-goeppingen.de Grußwort des Bürgermeisters Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Besucher und Gäste, ich begrüße Sie herzlich als Neubürger oder Gäste in Wangen und hoffe, dass Sie sich in unserer Gemeinde wohlfühlen werden. -

Freilicht Spiele Kloster Adelberg
Karten bestellen Alle Wege führen So einfach geht´s nach Adelberg FREILICHT Online über www.mkt-ticketshop.de von Aalen TicketTel 07181 929451 ◄ SPIELE Bei den Vorverkaufsstellen Schorndorf B 29 Lorch Preiskategorien von Stuttgart ► Die schönsten Adelberg KLOSTER Plätze ... B Rechberghausen ADELBERG von Stuttgart Göppingen ► C1 B 10 ◄ ◄von Ulm A2 Uhingen von A8 A1 Veranstalter C2 Spielfläche Kultur- & Kunstverein Adelberg e.V. Klostervilla, 73099 Adelberg Tel. 07166-387 Ulrichskapelle www.freilichtspiele.adelberg.de www.agentur-pji.com Preise: Max Mutzke & Abendveran- monoPunk „Colors“ Canadian Don Camillo Wendrsonn Vorverkaufsstellen & Ticket online bestellen PROGRAMM staltungen Alles Stehplätze Brass und Peppone Schwabenrock www.mkt-ticketshop.de A1/C2 36,– 26,– 22,– 20,– TicketTel 07181 929451 Email: [email protected] A2/C1 36,– 32,– 25,– 22,– Mo., Di., Do., Fr.: 09:30 – 18:30 Uhr; Mi. 09:30 – 13:30 Uhr; Sa. 08:30 – 13:30 Uhr B 36,– 36,– 30,– 24,– Göppingen: i-Punkt im Rathaus, Hauptstr. 1 Musikzuschlag: ........... 2 Euro Gruppenermäßigung: Tel. 07161-650292 • [email protected] Zuzügl. bei Max Mutzke, Canadi- ab 20 Personen ............... 10% Schlechtwetter Ausweichorte an Brass und Wendrsonn. ab 30 Personen ............... 20% Regenausweichquartiere: Achtung Beginn um 30 Minuten verschoben!!! Kinderveranstaltung: 30. Juni 2018, 19.30 Uhr: Max Mutzke & monoPunk: Stadthalle GP Auf allen Plätzen (nummeriert) 20% Ermäßigung bei 7. Juli 2018, 19.30 Uhr: Canadian Brass: Stadthalle GP Abendveranstaltungen für: 14. Juli 2018, 19.30 Uhr: Don Camillo und Peppone: UDITORIUM Uhingen Des Kaisers neue Kleider Schwerbehinderte mit Merkzeichen 20. Juli 2018, 19.30 Uhr: Wendrsonn: UDITORIUM Uhingen (entfällt bei Regen!) B im Ausweis, Rentner, Schüler und Adresse Uditorium: Ulmer Straße 7, 73066 Uhingen Studenten. -

Gemeinde Ausgabestelle Straße Öffnungszeiten
Übersicht: Ausgabestellen - kostenfreien Biobeutel - Gemeinde Ausgabestelle Straße Öffnungszeiten Mo, Mi: 08:00 - 12:00, Di: 10:00 - 12:00 + 14:00 - 16:00, Adelberg Rathaus Adelberg Vordere Hauptstraße 2 Do: 10:00 - 12:00 + 16:00 - 18:00, Fr: 10:00 - 12:00 Di: 07:30 - 10:00, Mi, Fr: 09:00 - 12:00, Aichelberg Rathaus Aichelberg Vorderbergstraße 2 Do: 09:00 - 12:00 + 14:00 - 18:00 Mo: 08:00 - 12:30, Di: 08:00 - 12:30 + 15:00 - 18:00, Albershausen Rathaus Albershausen Kirchstraße 1 Do: 08:00 - 12:30 + 14:00 - 16:00, Fr: 08:00 - 11:30 Bad Boll Wertstoffhof Bad Boll Sehningen 15 Di. 16:00-18:00, Fr. 16:00-18:00, Sa. 09:00-12:00 Mo: 09:00 - 12:00 + 14:00 - 16:00, Di: 07:00 - 12:00, Bad Ditzenbach Rathaus Bad Ditzenbach Hauptstraße 40 Mi: 09:00 - 12:00 + 16:00 - 18:00, Do: 09:00 - 12:00, Fr: 09:00 - 13:00 April - Oktober Di, Do: 14:00-18:00; Sa: 13:00-18:00 November: Di, Do: 14:00-17:00; Sa: 13:00-17:00 Dezember-März Sa: 12:00-16:00 Neue Steige (ehemalige Deponie 15. Febr. - 31. März Grüngutplatz Bad Ditzenbach - Gosbach Krähensteig) zusätzlich Do: 14:00-17:00 Mo: 08:30 - 12:00, Di: 14:00 - 15:30, Mi, Fr: 08:30 - 12:00, Do: 08:30 - Birenbach Rathaus Birenbach Marktplatz 1 12:00 + 15:00 - 18:00 Mo, Di, Fr: 08:00 - 12:00, Mi: 08:00 - 12:00 + 14:00 - 16:30, Böhmenkirch Rathaus Böhmenkirch Hauptstraße 100 Do: 14:00 - 18:00 April - Oktober Di: 14:00-18:00; Do: 15:00-19:00; Sa: 13:00-18:00 November Di: 14:00-17:00; Do: 15:00-17:00; Sa: 13:00-17:00 Dezember-März Sa: 12:00-16:00 15.