Lernendes Theater, Unbekannt: Innovationspotential Der
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-
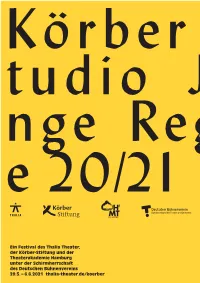
Tudio J U Nge R Egi E 2 0 /2 1
K ö r b e r S t u d i o J u n g e R e g i e 2 0 /2 1 Ein Festival des Thalia Theater, der Körber-Stiftung und der Theaterakademie Hamburg unter der Schirmherrschaft des Deutschen Bühnenvereins 29.5. – 6.6.2021 thalia-theater.de/koerber Körber Studio Junge Regie 20/21 Digitale Doppel-Edition Der Preis Vom 29. Mai bis zum 6. Juni findet das Körber Studio Es gibt in diesem Jahr zwei Preise, einen für jeden Junge Regie erstmalig digital statt. Das Festival lädt Jahrgang. Für beide Jahrgänge wird eine Jury von das Publikum dazu ein, die Vielfalt der Themen und Theaterfachleuten die Inszenierungen diskutieren Ästhetiken zu erleben, mit denen sich die Theaterge- und die Arbeit auszeichnen, die sie am meisten über- neration der Zukunft auseinandersetzt. Studierende zeugt hat. Die Körber-Stiftung unterstützt die von der aus den Regiestudiengängen der Hochschulen in Jury ausgezeichneten Personen bei einer neuen Regie- Deutschland, Österreich und der Schweiz präsentieren arbeit an einem Stadt- oder Staatstheater bzw. in der ihre Arbeiten auf der digitalen Bühne des Thalia Theater Freien Szene durch einen Produktionskostenzuschuss und haben die Gelegenheit, sich untereinander und in Höhe von 10.000 €. mit dem Publikum in Onlineformaten auszutauschen. In seiner 17. Festivalausgabe zeigt das Körber Studio Die Jury 20/21 Junge Regie so viele Aufführungen wie noch nie: 23 Jahrgang 2020: Emilia Heinrich (Dramaturgin, Thalia Regiearbeiten, die von den Instituten als herausragende Theater Hamburg), Tina Lanik (Regisseurin), Matthias Inszenierungen für das Festival nominiert wurden, Schulze-Kraft (künstlerischer Leiter, Lichthof Theater sind über einen Zeitraum von neun Tagen als kosten- Hamburg) pflichtige Streams im Festivalspielplan zu sehen. -

Die Autorenumfrage Im Überblick
80 SCHWERPUNKT DIE DEUTSCHE BÜHNE 8/2015 Saisonbilanz Die Autorenumfrage im Überblick 1. Beste Gesamtleistung 2. Abseits der Zentren 3. Off-Theater 4. Schauspiel Barbara Behrendt Berliner Schaubühne Volkstheater Rostock (Sewan Garn-Theater in Berlin-Kreuzberg Thorsten Lensing: „Karamasow“, Sophiensaele Berlin Berlin Latchinians Eröffnungssaison) Wolfgang Behrens Volksbühne Berlin Anhaltisches Theater Dessau Kampnagel Hamburg Christoph Marthaler: „Der Entertainer“ am Deutschen Berlin Schauspielhaus Hamburg Susanne Benda Oper Stuttgart – – – Stuttgart Ruth Bender Thalia Theater Hamburg Schauspiel Wuppertal Kampnagel Hamburg Nicolas Stemann: „Die Schutzbefohlenen“ am Thalia Theater Kiel Hamburg Andreas Berger – Anhaltisches Theater Dessau Movimentos-Akademie des Wolfsburger Andreas Döring: „Faust“ am Schlosstheater Celle Braunschweig Tanzfestivals Detlef Bielefeld – Theater Kiel – Oper – – Kronshagen Adrienne Braun Werner Schretzmeier und das Landestheater Tübingen Marie Bues und Martina Grohmann am Wilfried Alt: „Draußen vor der Tür“ am Theater Stuttgart Theaterhaus-Ensemble Stuttgart Theater Rampe Stuttgart der Altstadt Stuttgart Martin Bürkl Theater Regensburg unter Intendant Theater an der Rott in Eggenfelden – Lilja Rupprecht: „Caligula“ am Münchner Volkstheater München Jens Neundorff von Enzberg im letzten Jahr von Karl M. Sibelius Nicole Czerwinka Boulevardtheater Dresden Mittelsächsisches Theater in Das Projekt „szene12“, Dresden Sebastian Baumgarten: „Antigone“ am Staatsschauspiel Dresden Freiberg Dresden Alexander Dick Theater -

Sina Martens
copyright: Jeanne Degraa Sina Martens PROFIL Jahrgang: 1988 Größe: 1,68 Haarfarbe: blond Augenfarbe: blau Sprachen: Deutsch, Englisch (gut), Französisch, Latein (Grundkenntnisse) Dialekte: norddeutsch, hamburgisch Instrumente: Gitarre (Akkorde) besondere Fähigkeiten: Tanz, Pantomime, Fechten Sina Martens: filmmakers.de/sina-martens die-agenten.de/profile/sina-martens Theater * - 2021 Fabian oder der Gang vor die Hunde - Erich Kästner Frank Castorf | Berliner Ensemble | Deutschland * - 2019 Die Möglichkeit einer Insel - Michel Houellebecq Robert Borgmann | Berliner Ensemble | Deutschland * - 2019 Felix Krull - Thomas Mann Alexander Eisenach | Berliner Ensemble | Deutschland * - 2018 Endstation Sehnsucht - Tennessee Williams Michael Thalheimer | Berliner Ensemble | Deutschland * - 2017 Der kaukasische Kreidekreis - Bertolt Brecht Michael Thalheimer | Berliner Ensemble | Deutschland * - 2016 Bonnie ohne Kleid - Sina Martens Sina Martens | Berliner Ensemble und Schauspiel Leipzig | Deutschland 2020 - 2019 Othelllo - William Shakespeare Michael Thalheimer | Berliner Ensemble | Deutschland 2019 Galileo Galilei - Das Theater und die Pest - Bertolt Brecht Frank Castorf | Berliner Ensemble | Deutschland 2019 - 2018 Die Parallelwelt - Alexander Kerlin, Eva Verena Müller und Kay Voges Kay Voges | Berliner Ensemble | Deutschland 2019 - 2018 Die Verdammten - Luchino Visconti David Bösch | Berliner Ensemble | Deutschland 2019 - 2018 Menschen, Orte und Dinge - Duncan Macmillan Bernadette Sonnenbichler | Berliner Ensemble | Deutschland 2018 - 2017 Les -

Kultur Im Rückblick 2012 Jahresbericht Des Amtes Für Kultur Und Denkmalschutz
Kultur im Rückblick 2012 Jahresbericht des Amtes für Kultur und Denkmalschutz Vorwort 1 Manfred Wiemer Immer wenn „die Stadt“(-Verwaltung) über „die Kultur“ spricht, hat sie Dies sollte der Erwähnung nicht wert sein. Aber selbstverständlich ist fest ihre Museen, Orchester, Theater, Galerien, kurz: die eigenen Häuser es wiederum auch nicht und bedarf der dauerhaften Arbeit. Am wich- und Vorhaben im Blick. Dann schweift der Blick noch in Richtung der tigsten ist sicher, dass ein breites und belastbares Vertrauen gewach- Staatlichen Museen und Theater. Dort endet er meist. sen ist zwischen der Kulturverwaltung, den Facharbeitsgruppen, de- In Vergessenheit gerät manchmal, dass die kulturellen Farben ren Empfehlungen die Verbindungen in die „Szenen“ herstellen, dem Dresdens nicht nur von diesen Häusern bestimmt werden. In allen Kulturbeirat und dem Kulturausschuss des Stadtrates, dessen Votum Kunst- und Kulturbereichen sind Vereine aktiv, die die städtische und die abschließende Entscheidung darstellt (Gremien und Ausschüsse freistaatliche Angebotspalette bereichern. Manche füllen selbst ganze auf Seite 32). Ihnen allen gebührt an dieser Stelle ausdrücklicher Dank Sparten aus. Dies trifft auf Film und Medien sowie die Literatur zu, ganz für ihre engagierte Arbeit. Im Vorausblick ist hier auch zu erwähnen, überwiegend auch auf die Soziokultur. Das jahrelang bewährte eben- dass es den Mitgliedern des Kulturausschusses gelungen ist, für den so wie das riskante, experimentierende persönliche Engagement der Doppelhaushalt 2013/14 eine bedeutende Erhöhung der Mittel für die Künstler und „Kulturarbeiter“ in diesen Vereinen verdient Hochachtung Kulturförderung vorzusehen. und Dank − zuallererst vom Publikum. Städtische Kulturförderung unterstützt kontinuierliche ebenso wie Städtischer Dank dagegen wird naturgemäß in Form von Kultur- spontane, experimentelle künstlerische und kulturelle Arbeit. -

SEPT – DEZ 2020 DEZ 2020/21 SPIELZEIT Mehr Für SPIELZEIT 2020/21 Münster! SEPT – DEZ 2020
SPIELZEIT 2020/21 SEPT – DEZ 2020 Mehr für SPIELZEIT 2020/21 Münster! SEPT – DEZ 2020 PREMIEREN 4 MUSIKTHEATER 8 SCHAUSPIEL 30 TANZTHEATER 52 JUNGES THEATER 64 SINFONIEORCHESTER MÜNSTER 86 THEATER EXTRA 92 VOR, AUF UND HINTER DER BÜHNE 98 TICKETS & SERVICE 108 KONTAKT & IMPRESSUM 124 PREISE & SAALPLÄNE 126 Schon lange setzt Brillux sich für die Sicherheit der Münsteraner ein. So wurden bereits 30.000 Fahr- räder mit Speichenreflektoren ausgestattet. Denn es gilt: Je sichtbarer, desto sicherer. Aus gleichem Grund engagiert sich Brillux im Rahmen der Aktion „Münster sieht gelb“ regelmäßig dafür, leuchtende Käppis und Mützen an Schulanfänger zu verteilen. Über 170 Spiegel an Kreuzungen sorgen dafür, Fahrradfahrer für abbiegende Fahrzeuge noch sichtbarer zu machen. [email protected] | www.brillux.de BX28379_Mehr-f-Muenster-AZ-155x210.indd 1 26.03.20 07:35 WIR SIND WIEDER FÜR SIE DA! Es ist doch überaus erfreulich: Vernunft und Disziplin haben in unserem Land dazu geführt, dass wir laufend neue Lockerungen der Corona-Verordnungen bekom- men und dass wir nun in der Lage sind, Ihnen – zunächst für den Zeitraum Sep- tember bis Dezember 2020 – einen Spielplan für alle fünf Sparten des Theaters präsentieren zu können. Natürlich ist es noch nicht so ein »richtiger« Spielplan, wie Sie ihn gewohnt sind Kunst und Kultur leben von Vielfalt. Am Theater und natürlich ist er auch weit von dem entfernt, was wir ursprünglich vorgesehen Münster arbeiten ca. 380 Mitarbeiter*innen aus 38 (und auch schon einmal über die Medien kommuniziert) hatten. Aber immerhin: verschiedenen Nationen. Diese Vielfalt wird aktiv Das kulturelle Leben erwacht wieder. Vieles in unserem Programm steht unter gefördert und findet nicht zuletzt Ausdruck in einem der Devise »Änderungen vorbehalten«, denn vieles kann sich bis September, internationalen Programm von Theater stücken, noch mehr bis Dezember – hoffentlich positiv – verändern. -

Museum Wiesbaden
473-18-02 s Februar 2018 www.strandgut.de für Frankfurt und Rhein-Main D A S K U L T U R M A G A Z I N Der Garten der Avantgarde Heinrich Kirchhoff: >> Film Ein Sammler von Jawlensky, Das Leben ist ein Fest von Eric Toledano Klee, Nolde … und Olivier Nakache ab 1. Februar >> Theater noch bis Das Schloss im Schauspiel Frankfurt 25 Feb 18 >> Literatur Gregor Gysi Ein Leben ist zu wenig >> Ausstellung Pilze – Nahrung, Gift, Mythen im Museum Wiesbaden >> Musik Triebwerk Hornung am 16. Februar in »Die Fabrik« Museum Wiesbaden mu–wi.de ⁄ kirchhoff Verschenke Herzklopfen! Am 14. Februar ist Valentinstag! CineStar-Kinogutscheine ɰƺȃɁȶƃƹіѕԛԦӵ jetzt im Kino unter shop.cinestar.de CineStar Metropolis | Eschenheimer Anlage 40 | 60318 Frankfurt a.M. CineStar Frankfurt | Mainzer Landstr. 681 | 65933 Frankfurt a.M. INHALT Film 4 Die Verlegerin von Steven Spielberg 5 Ellen M. Harrington Neue Chefin im Filmmuseum TopTop FiveFive 6 24. Africa Alive 6 abgedreht Werbe 7 Das Leben ist ein Fest von Eric Toledano Weihnachts - Ellen M. Harrington © S.Schüler und Olivier Nakache 8 Shape of Water – geschichten Das Flüstern des Wassers von Guillermo del Toro 9 Licht von Barbara Albert 10 Filmstarts Die wahren Patrioten Theater »Die Verlegerin« von S. Spielberg 16 Tanztheater Shape of Water Von der nachfolgenden Water- 18 Premieren 4 gate-Affäre ist diese investigati- 18 Das Schloss 1 toom im Schauspiel Frankfurt ve Großtat etwas aus dem allgemei- Den kleinen Bruder kann man 19 Unter Verschluss & nen Gedächtnis verdrängt worden. 7 Minuten – Betriebsrat leider nicht mal bei toom umtau- im Staatstheater Mainz Im März des Jahres 1971 wurde schen. -

Ausgezeichnet Und Kostenlos: Das HVB Willkommenskonto
UNI 2007/01 00 U1-U4 31.03.2007 14:55 Uhr Seite 1 Das Wissenschaftsmagazin Forschung Frankfurt ■ Münze und Geld in der antiken Welt ■ Peter Suhrkamps Erbe ] ■ Globale Verfassungen – jenseits des Nationalstaats ISSN 0175-0992 ■ Enzyme als Vorbild ][ für Katalysatoren 5 Euro ■ Jeder Fehler zählt – ] [ Lernsystem für Hausärzte 2007 ][ Geisteswissenschaften 25. Jahrgang [ 2007 1. www.hvb.de Ausgezeichnet und kostenlos: das HVB WillkommensKonto ˾ Kostenloses Girokonto ˾ 3% p.a. Guthabenzins ab dem 1. Euro bis 1.500 Euro ˾ Kostenlose HVB ecKarte und HVB MasterCard ˾ Automatisches Sparen in Höhe von 25 Euro oder mehr mit monatlichem Spardauerauftrag ˾ Kostenlos Geld abheben mit der HVB ecKarte an über 17.000 Geldautomaten in Europa Kurzum: Bei Ihrem HVB WillkommensKonto suchen Sie Kosten vergeblich – Sie finden nur Leistung. Am besten Sie sprechen noch heute mit uns. UNI 2007/01 Teil 1 04.04.2007 11:47 Uhr Seite 1 Editorial Liebe Leserinnen, liebe Leser, res Landes hängt entschei- Frankfurt« Ihnen einen Ein- dend vom Fortschritt in Wis- druck von der Breite dieses senschaft und Forschung Wissensgebietes an unserer ab. Doch was hilft diese Universität. Die Geisteswis- weithin konsensfähige Ein- senschaften sind Verste- sicht, wenn den öffentlichen hens- und Reflexionswissen- Haushalten seit Jahrzehnten schaften. Sie beschäftigen die Mittel fehlen, um die sich unter anderem intensiv Hochschulen angemessen mit den Unterschieden zwi- auszustatten? Trotz zusätzli- schen Kulturen, was wesent- cher Leistungen von Bund lich zum Verständnis des und Land, die in den ver- Neuen und auch Fremden gangenen Jahren aufge- beiträgt – das ist in unserer bracht wurden, bleibt die globalisierten Welt, in der Finanzdecke zu kurz! Noch Jahrhunderte alte Wertvor- ist es ein weiter Weg, bis stellungen ins Wanken gera- wir zu renommierten ameri- ten, eine lebenswichtige die Idee der Stiftungsuni- kanischen Universitäten und sehr komplexe Aufgabe. -

Frankfurter Rundschau Samstag/Sonntag, 2./3
rs/kul/F KUL4sa - 04.06.2012 20:15:49 - fm.s.loichinger rs/kul/F KUL4sa - 04.06.2012 20:15:49 Cyan Magenta Gelb Schwarz Cyan Magenta Gelb Schwarz B4 FREIZEIT Frankfurter Rundschau Samstag/Sonntag, 2./3. Juni 2012 68. Jahrgang Nr. 127 RS Samstag/Sonntag, 2./3. Juni 2012 68. Jahrgang Nr. 127 RS Frankfurter Rundschau FREIZEIT B5 FILM THEATER Die Fledermaus, Papageno-Musiktheater Spezial MAINZ Natalie Porth und Stefan Poppe, OFFENBACH WEITERSTADT im Palmengarten, Zeppelinallee 8, Sabine Wiegand, Wenn Dat Rosi zweimal Flöte und Orgel, Werke von Gluck, Liszt, Fauré, Hasan Yükselir, Liederzyklus, FRANKFURT Tel. 069/ 1340-400, 2.6. 19.30 Uhr klingelt, Unterhaus im Unterhaus, Münster- Debussy u.a., St. Bernhard, Koselstr. 11–13, Deutsches Ledermuseum / Schuhmuseum Kommunales Kino, Carl-Ulrich-Str. 9–11, 37 Ansichtskarten, Bockenheimer Royal Opera House London: Madame Tel. 069/9550030, 3.6. 18 Uhr Tel. 06150/12185, Bulb Fiction, straße 7, Tel. 06131/232121, 2.6. 20 Uhr Offenbach, Frankfurter Straße 86, Theaterensemble, Interkulturelle Bühne, Butterfly (2012), CineStar, Holzhofstraße 1, Philharmonischer Verein 1834 Frankfurt 2.6. 21 Uhr, 3.6. 18 Uhr. Ziemlich beste Tel. 069/8297980, 3.6. 18.00 Uhr Alt-Bornheim 32, Tel. 069/46003741, Tel. 06131/2068401, 3.6. 17.00 Uhr e.V. Werke von Bruckner, Brahms u.a., Freunde, 2.6. 18 Uhr, 3.6. 21 Uhr Wildes Wachstum LITERATUR 2.6. 20 Uhr The Rake's Progress, von Igor Strawinsky, Dr. Hoch's Konservatorium, Sonnemannstr. 16, WIESBADEN WIESBADEN Constant Bliss In Every Atom, Oper Frankfurt, Willy-Brandt-Platz, FRANKFURT Tel. 069/21244822, 2.6. -

Pressemappe 2021
MK: Wohin gehen wir so unsicheren Schrittes? Pressekonferenz MK: Update #2 08. Juli 2021 Pressekontakt Zsaklin Diana Macumba M: 01525 68 94531 E: [email protected] MK: MK: Produktionen Effingers 3 Los Años / Die Jahre 3 某种类似于我的地洞:心室片段 4 Heart Chamber Fragments 5 Like Lovers Do (Memoiren der Medusa) 5 Frau Schmidt fährt über die Oder 5 Heidi weint – Eine Gefühlsversammlung 5 Eure Paläste sind leer (all we ever wanted) 6 Jeeps 7 Fäden 7 Heldenplatz 8 Wo du mich findest 8 Pigs 9 Wer immer hofft, stirbt singend 9 Theatermanager*in 23 10 DAS MÜNCHNER MUSEUM DER MENSCHENJAGD 10 Die Heilige Schrift 11 Ich brauche den Horror! Und andere Sachen. 11 What is the City? 11 Koma 13 Joy 2022 13 Ein Projekt mit Texten von Claude Cahun 13 Breaking the Spell 14 Sisterhood Kyiv-München 15 KÜNSTLERISCHE BILDUNG: MITMACHEN 16 In Planung 17 Food (AT) Jahrgangsinszenierung der OFS Eine Inszenierung MK: Regie 20 MK: Artists in Residence 27 MK: Leitungsteam 28 MK: Ensemble 33 2 MK: Produktionen Effingers nach dem Roman von Gabriele Tergit Uraufführung Zwei Weltkriege, Faschismus, Frauenbewegung, Pandemie, Inflation – inmitten all dieser Ereignisse lebte Gabriele Tergit, die als wichtige literarische und politische Stimme des letzten Jahrhunderts gerade erst wiederentdeckt wird. Tergit dokumentierte mehr als 40 Jahre lang in zahlreichen Gerichtsreportagen die Welt des frühen 20. Jahrhunderts, 1933 floh sie vor den Nazis aus Deutschland. Ihr Familienroman „Effingers“ porträtiert das Leben einer jüdischen Familie zwischen 1883 und 1942. Drei Generationen wachsen auf, suchen Rückhalt und Stabilität in ihrer Familie oder emanzipieren sich von ihren Zwängen. Sie verlieben sich, werden verheiratet oder heiraten gar nicht, fahren das erste Mal Auto, experimentieren mit dem technischen und wirtschaftlichen Fortschritt, erleben einen Weltkrieg, sind Teil des gesellschaftlichen Aufstiegs und stürzen ab. -

Newsletter Juni 13
NEWSLETTER JUNI 13 0.h Insitut für Angewandte Theaterwissenschaft, Gießen 1 von Studierenden der HTA Theatermaschine 2013 Werkschau der Studierenden der Angewandten Theaterwissenschaft 19.00 - 20.30 Uhr | Probebühne II : Wild Thing – I wanna know for sure // 21.00 - 22.15 Uhr | Probebühne I : Seid gastfreundlich gegeneinander ohne Murren // 21.00 - 23.00 Uhr | Festivalzentrum: Sgt. Pepper's ABENDESSEN // 22.30 Uhr | Festivalzentrum: Brückenfeuer – Festliche Eröffnung – // 22.30 Uhr | Festivalzentrum: Konzert: Telemetrie theatermaschine-giessen.de 19h Naxoshalle, Theater Willy Praml Frankfurt 1 Im Rahmen von GRIMM! HfMDK auf Naxos HfMDK Regie, HfG, MA Dram BÖSE MÄRCHEN Wer hat Angst vor den Brüdern Grimm? Regie: Tarik Goetzke, Carolin Millner, Simon Möllendorf, Marie Mühlan, Ksenia Ravvina, Daniel Schauf / Schauspieler: Damjan Batistić, Sabrina Frank, Markus Gläser, Sidonie von Krosigk, Philipp Quest, Regina Vogel, Stephan Weber, Carina Zichner (alle 3. Jahr HfMDK Schauspiel) / Dramaturgie: Tina Ebert, Caroline Rohmer / Bühne: Sabine Born / Kostüme: Nils Wildegans / Komposition: 2 StudentInnen der HfMDK Frankfurt (N.N.) / Musik: 4 StudentInnen der HfMDK Frankfurt (N.N.) / Produktion: Nina Koch Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main, Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH, KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH, Via Brentano – Route der Romantik, Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main e.V., Hessische Theaterakademie, Städtische Bühnen Frankfurt am Main GmbH, Frankfurt LAB – das Musik-, Theater-, und Tanzlabor der Moderne für Frankfurt RheinMain e.V., Brüder-Grimm-Stadt Hanau, Fachbereich Kultur, Theater und Orchester Heidelberg 20h Theater im G-Werk, Afföllerwiesen 3a, Marburg 1 von Studierenden der HTA Ich schreibe im Fieber. Eine Suche nach Georg Büchner. -

Schauspielhaus Journal Infos Zur Wiederherstellung Des Alten Frankfurter Schauspielhauses
Ausgabe 1/2020 Schauspielhaus Journal Infos zur Wiederherstellung des alten Frankfurter Schauspielhauses Die neue alte Pracht am Willy-Brandt-Platz! Aktuelle Visualisierung: Seiten 12+13 Schande von 1962: Umfrage.- Wundersame Wie Technokraten den Was wollen eigentlich Entdeckungsreise Seeling-Bau zerhackten die Bürger? hinter die Glasfront Seite 4 Seite 15 Seite 8 Informieren und mitmachen!: www.frankfurterschauspielhaus.de „Das alte VorwortFrankfurter Das alte Schauspielhaus von 1902 soll wieder freigelegt werden. Doch immer wieder höre ich, Schauspielhaus es sei ein „Monument des Kaiserreichs“ gewesen. „Wilhelminismus pur“. - Wirklich? Auch bei näherer Betrachtung der kunstvoll gear- war durch und beiteten Fassaden konnte ich bislang keinen Reichsadler entdecken, keine Kaiser-Insignie oder durch nationales Gehabe. Ganz im Gegenteil: Inschriften Schauspielhaus-Fries mit europäischer Inschriften und Reliefs Kulturikonen europäisch.“ schmücken noch heute die Friese: Shakespeare, Molière, Calderón und Co. Eine ägyptische Sphinx thronte auf dem Dach und die Dame auf der Kuppel war nicht etwa Germania, sondern Frankofurtia! Im Seeling-Bau gaben sich europäische Schauspieler und Regisseure der Spitzenklasse die Klinke in die Hand. Hier atmete der freie Geist des kulturellen Europas, freilich nur bis zur Machtergreifung 1933. Doch nach 1945 erneut. Ich finde, das alte Schauspielhaus ist ein durch und durch europäisches Haus und hat es daher verdient, wieder hergestellt zu werden. Thomas Mann, Europaabgeordneter a.D., setzt sich für die Wiederherstellung des alten Frankfurter Schauspielhauses ein Schauspielhaus Journal SEITE 4 Willy-Brandt-Platz 1962: Zerstörung einer Frankfurter Ikone. Von Tobias Rüger, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Schauspielhaus Frankfurt Foto: Institut für Stadtgeschichte Frankfurt unbeschädigt geblieben, aber in der Adenauer-Zeit Seeling-Bau wieder freizulegen, denn: Hinter der verstümmelt und umbaut. -
Ausschussvorlage WKA/20/6
Stand: 13.08.2019 Teil 1 öffentlich Ausschussvorlage WKA/20/6 Stellungnahmen der Anzuhörenden zu dem Dringlichen Entschließungsantrag Fraktion der CDU Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Anhörung der Kulturschaffenden aus Soziokultur und darstellender Kunst – Drucks. 20/262 in der vom Ausschuss geänderten Fassung – 1. Hessische Theaterakademie Frankfurt a. M. S. 1 2. Künstlersozialkasse S. 8 3. ASSITEJ e. V. S. 9 4. theater 3 hasen oben S. 21 5. thalhaus Theater e. V. Wiesbaden S. 25 6. Hessisches Staatstheater Wiesbaden – Personalrat S. 27 1 Anhörung der Kulturschaffenden aus Soziokultur und Darstellender Kunst am 29. August 2019 im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst Fragen der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE Antworten der Hessischen Theaterakademie, vertreten durch Prof. Ingo Diehl (Präsident) und Dr. Philipp Schulte (Geschäftsführer) I. Allgemeine Situation: Überlegungen zur Entwicklung der Hessischen Theaterakademie Die HTA als Erfolgsmodell Die Hessische Theaterakademie als Studien- und Produktionsverbund zwischen den wichtigsten und größten hessischen Theatern und allen für Berufe in den szenischen Künsten ausbildenden Studiengängen an Universitäten und Hochschulen in Frankfurt, Gießen und Offenbach ist ein deutschland-, ja europaweit einzigartiges Erfolgsmodell, das eine bestmögliche Verzahnung von interdisziplinär angelegter Ausbildung und professionellem Schaffen in Theater, Musiktheater, Tanz und Performance ermöglicht. Unter dem Dach der Akademie arbeiten elf Studiengänge und zehn Theater eng zusammen. Seit ihrer Gründung 2002 auf Initiative des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst hat sie eine Vielzahl namhafter Absolvent*innen hervorgebracht, praxisorientierte neue Masterprogramme (für Dramaturgie, Theater- und Orchestermanagement, zeitgenössische Tanzvermittlung und Choreographie/Performance) gegründet und zahlreiche Kooperationsprojekte zwischen den Theatern und den Studiengängen initiiert und gefördert.