Gemeinsame Landesplanungsabteilung 26
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
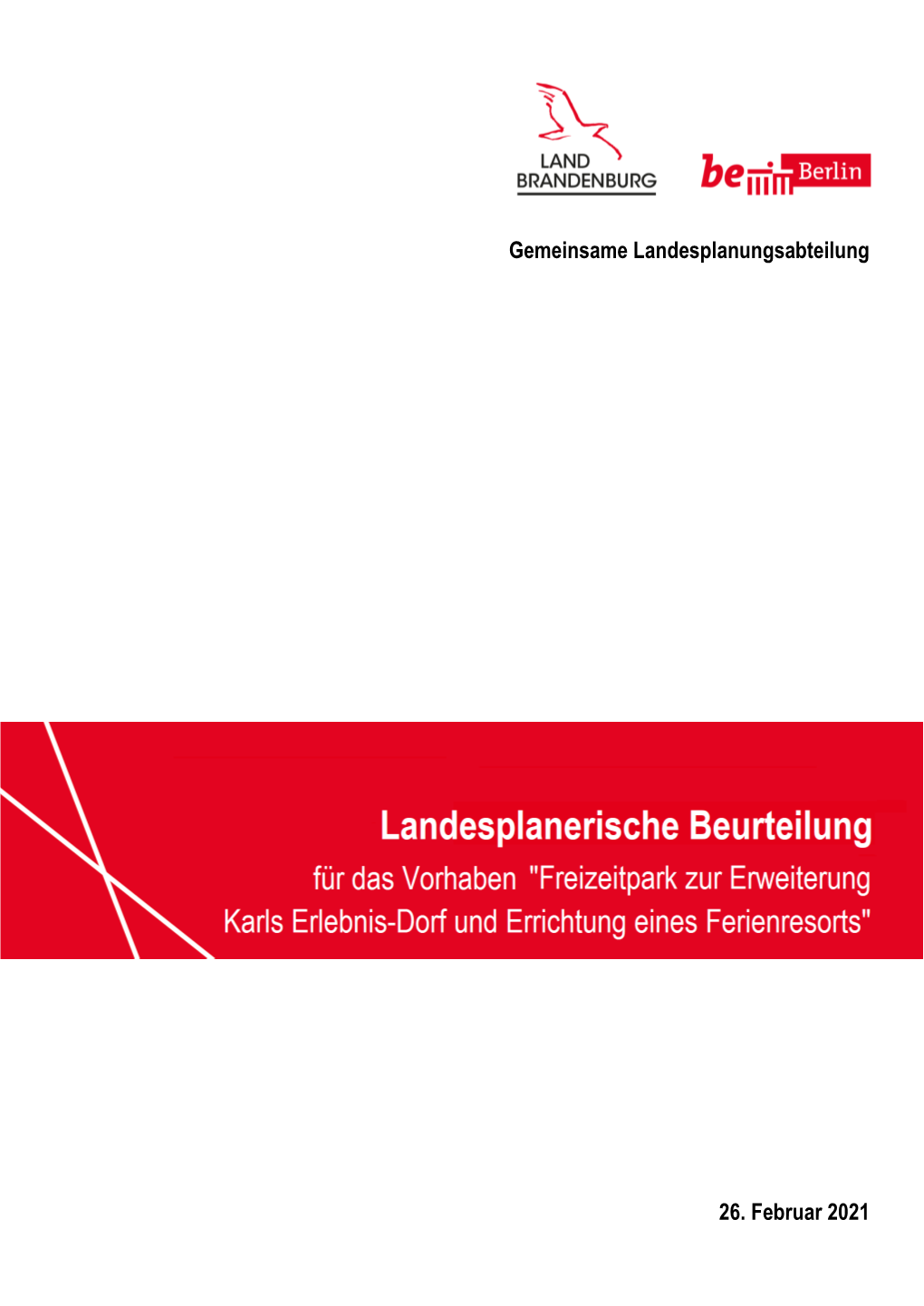
Load more
Recommended publications
-

Ansiedlungsvorhaben Des Unternehmens Tesla Und Der „Gigafactory Berlin-Brandenburg“
– Grow Together – Ergebnisse der Steuerungsgruppe des Landkreises Oder-Spree zum Ansiedlungsvorhaben des Unternehmens Tesla und der „Gigafactory Berlin-Brandenburg“ 1 IMPRESSUM Herausgeber: Landkreis Oder-Spree Anschrift: Breitscheidstraße 7 15848 Beeskow Tel.: 03366/ 35-0 Fax: 03366/ 35-1111 [email protected] www.l-os.de Redaktion: Der Landrat Stand: 18.03.2020 Nachdruck/ Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers. 2 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung zum Arbeitspapier ............................................................................................................... 4 2 Der Landkreis Oder-Spree als Wirtschaftsstandort und Stätte der Naherholung ............................. 10 2.1 Räumliche Lage und Natur .............................................................................................................. 10 2.2 Verwaltungsstruktur ........................................................................................................................ 12 2.3 Bevölkerung ..................................................................................................................................... 13 2.4 Infrastruktur .................................................................................................................................... 15 2.4.1 Straßennetz .................................................................................................................................. 15 2.4.2 Schienennetz ............................................................................................................................... -

Potsdam, 23.03.2021 Anhörungsverfahren Zur
Anke Oehme ∙ Am Upstall 10i ∙ D-14476 Potsdam Telefon: 0174 1533849 Email: [email protected] Anke Oehme │ Am Upstall 10i │14476 Potsdam Landesamt für Bauen und Verkehr Dezernat 21 – Anhörung/ Planfeststellung Straßen und Eisenbahnen Lindenallee 51 15366 Hoppegarten Potsdam, 23.03.2021 Anhörungsverfahren zur Planfeststellung für das Verfahren „Neubau der einseitigen Tank- und Rastanlage „Havelseen“ an der linken Richtungsfahr- bahn der BAB 10, km 130,00 einschließlich trassenferner landschaftspflegeri- scher Begleitmaßnahmen“, Einwendung gegen den Bau der einseitigen Tank- und Rastanlage „Havelseen“ an der Bundesautobahn 10 (Aktenzeichen 2112-31101/0010/047) Sehr geehrte Damen und Herren, die BürgerInnen-Initiative Fahrland wiederspricht hiermit dem Bau der einseitigen Tank- und Rastanlage „Havelseen“ an der Bundesautobahn 10 vollumfänglich. Die zahlreichen Ein- wendungen zum Planfeststellungsverfahren entnehmen Sie bitte unserer Stellungnahme in der Anlage. Die Standortfrage muss noch einmal ergebnisoffen überprüft werden. Ich bitte um eine schriftliche Eingangsbestätigung und weitere Beteiligung am Verfahren. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei dieser Einwendung um die gemeinsame Einwendung der Mitglieder der Bürgerinitiative Fahrland und nicht um eine „gleichförmige Einwendung“ handelt. Wir erwarten, dass unsere Einwendung entsprechend in der Abwä- gung berücksichtigt wird und wir eine individuelle Antwort von Ihnen erhalte, die ebenfalls nicht den Charakter einer gleichförmigen Einwendungsbeantwortung bzw. von gleichförmi- gen Abwägungsergebnissen hat. Mit freundlichen Grüßen Anke Oehme – Sprecherin der Bürgerinitiative Fahrland Anlage Anke Oehme ∙ Am Upstall 10i ∙ D-14476 Potsdam Telefon: 0174 1533849 Email: [email protected] 1 Naherholungsgebiet für umliegende Orte Als Anwohner Fahrlands sind wir vom geplanten Bau der Tank- und Rastanlage in unmittel- barer Umgebung direkt betroffen. -

Antwort Der Landesregierung Auf Die Kleine Anfrage Nr
Landtag Brandenburg Drucksache 5/3003 5. Wahlperiode Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage Nr. 1114 der Abgeordneten Dr. Saskia Ludwig CDU-Fraktion Landtagsdrucksache 5/2854 Nachfrage zur Antwort auf die Kleine Anfrage 987 Flugroutenvorschlag des MUGV in Richtung Westen Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 1114 vom 22.02.2011: Die Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 987 gibt Anlass zu weiteren Nachfragen. Ich frage die Landesregierung: 1. Wenn es das Ziel des MUGV war, objektive Abwägungskriterien in die Diskussion einzubrin- gen, wieso schlägt das MUGV dann eine konkrete Route vor und belässt es nicht bei dem Vor- schlag eines „Bewertungsmodells“? 2. Auf Grundlage welcher konkreten Kriterien wurde der vom MUGV eingebrachte Routenvor- schlag erarbeitet? Inwiefern berücksichtigt dieser Vorschlag die vom MUGV selbst eingebrach- ten „Pegelklassen“? 3. Warum ergänzt das MUGV seinen Bewertungsvorschlag nicht dahingehend, dass auch die Vermeidung von Lärmbelastungen unter 45 dB(A) Dauerschallpegel einheitlich und für alle Ge- meinden gleichberechtigt positiv bewertet wird und somit auch eine Umfliegung der Havelsee- gemeinden gewährleistet werden kann? 4. Wie erklärt sich die Aussage, dass bei der dem Antrag des MUGV zugrunde liegenden Umflie- gung der Landeshauptstadt Potsdam lediglich Randbereiche der Gemeindegebiete der Ge- meinden Nuthetal, Michendorf, Schwielowsee und Werder/Havel beeinflusst werden können? Besteht vielmehr nicht die Gefahr, dass die Flugrouten des Westverkehrs, der den Hauptteil der Flugbewegungen -

Grundstücksmarkt 2003 Im Landkreis Oder-Spree 1. Informationen Über
Auszug aus dem Grundstücksmarktbericht 2003 Seite 1 von 6 Grundstücksmarkt 2003 im Landkreis Oder-Spree Inhaltsverzeichnis des Auszuges 1. Informationen über den Landkreis............................................................................................... 1 2. Gesamtumsätze und deren Entwicklungen ................................................................................. 2 3. Grundstücksteilmärkte ................................................................................................................ 3 4. Bodenrichtwerte.......................................................................................................................... 4 5. Sanierungsgebiete / Entwicklungsbereiche................................................................................. 4 6. Sonstige Daten ........................................................................................................................... 5 6.1 Marktteilnehmer ........................................................................................................................ 5 6.2 Preisniveau bebauter Grundstücke ...........................................................................................6 1. Informationen über den Landkreis Der mit der Kreisgebietsreform im Dezember 1993 aus den ehemaligen Landkreisen Beeskow, Fürstenwalde und Eisenhüttenstadt sowie der kreisfreien Stadt Eisenhüttenstadt gebildete Land- kreis Oder-Spree hat eine Fläche von 2.242,4 km² und erstreckt sich von der östlichen Grenze der Bundeshauptstadt Berlin -

Eingliederungsbericht 2015
Eingliederungsbericht 2015 Inhalt Inhaltsverzeichnis…………………………………………………………….……………………….2 1. Der Landkreis Havelland ................................................................................................ 3 1.1 Geographische Lage ............................................................................................... 3 1.2 Verkehrsanbindung ................................................................................................. 4 1.3 Wirtschaft ................................................................................................................ 4 2. Landkreis Havelland, Dezernat VI, kommunales Jobcenter ............................................ 4 3. Örtlicher Beirat ............................................................................................................... 5 4. Eingliederungsstrategie .................................................................................................. 5 4.1 Neuantragsteller ...................................................................................................... 7 4.2 Jugendliche unter 25 Jahren ................................................................................... 7 4.3 Arbeitsmarktferne Leistungsberechtigte .................................................................. 8 4.4 Leistungsberechtigte mit nicht bedarfsdeckender Tätigkeit ...................................... 8 4.5 Selbständige ........................................................................................................... 8 5. Leistungen zur Eingliederung -

Amtsblatt Für Brandenburg, 2006, Nummer 42
681 Amtsblatt für Brandenburg Gemeinsames Ministerialblatt für das Land Brandenburg 17. Jahrgang Potsdam, den 25. Oktober 2006 Nummer 42 Inhalt Seite Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung Allgemeine Ausnahmegenehmigung vom Feiertagsfahrverbot für Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t und für Anhänger hinter Lastkraftwagen am 31. Oktober (Reformationstag) der Jahre 2006 bis 2009 auf bestimmten Strecken im Land Brandenburg für Fahrten nach und von Berlin . 682 Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz Öffentliches Auslegungsverfahren zum geplanten Landschaftsschutzgebiet „Notte-Niederung“ . 682 Der Präsident des Landessozialgerichtes Berlin-Brandenburg Zulassung von Prozessagenten bei den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit des Landes Brandenburg und dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg . 683 Beilage: Amtlicher Anzeiger Nr. 42/2006 682 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 42 vom 25. Oktober 2006 Allgemeine Ausnahmegenehmigung Landkreis: Stadt/Gemeinde: Gemarkung: Flur: vom Feiertagsfahrverbot für Lastkraftwagen Dahme- Bestensee Bestensee 1, 2, 7 bis 9, 14, 15; mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t Spreewald Königs Deutsch und für Anhänger hinter Lastkraftwagen Wusterhausen Wusterhausen 1 bis 3; am 31. Oktober (Reformationstag) Zeesen 8; der Jahre 2006 bis 2009 Mittenwalde Brusendorf 1, 3, 4; Gallun 1 bis 4; auf bestimmten Strecken im Land Brandenburg Mittenwalde 1, 3 bis 15; für Fahrten nach und von Berlin Motzen 1 bis 7; Ragow 1 bis 5, 7; Bekanntmachung des Ministeriums Schenkendorf 1 bis 4; für Infrastruktur und Raumordnung Telz 1 bis 8; Töpchin 2, 4 bis 6; Abteilung 5 Teupitz Egsdorf 1 bis 3; Vom 27. September 2006 Teupitz 1; Groß Köris Groß Köris 1, 3, 4; Im Benehmen mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Teltow-Fläming Am Mellensee Klausdorf 3, 5; Mellensee 1 bis 4; des Landes Berlin und dem Ministerium des Innern des Landes Saalow 3; Brandenburg wird gemäß § 46 Abs. -

Drucksache 19/26777 19
Deutscher Bundestag Drucksache 19/26777 19. Wahlperiode 18.02.2021 Kleine Anfrage der Abgeordneten Annalena Baerbock, Matthias Gastel, Stefan Gelbhaar, Oliver Krischer, Markus Tressel, Daniela Wagner und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Neubauvorhaben Tank- und Raststätte Paaren/Satzkorn an der Bundesautobahn 10 Das zuletzt im Jahr 2010 fortgeschriebene Rastanlagenkonzept für das Land Brandenburg, mit dem unter anderem zusätzliche Lkw-Parkplätze entlang des Berliner Autobahnrings geschaffen werden sollen, war 2011 eine der Grundla- gen für die Standortfindung für den Neubau einer Tank- und Rastanlage an der Bundesautobahn 10, westlicher Berliner Ring. Dort existiert seit 1990 die beid- seitige Tank- und Raststätte Wolfslake, die jetzt aufgegeben werden soll. Ursprüngliches Vorhaben war die Planung und Errichtung einer beidseitigen Tank- und Rastanlage etwas nördlich des jetzt favorisierten Standortes. Derzeit befürwortet das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur den Standort Paaren/Satzkorn als einseitig gelegene Tank- und Rastanlage. In den betroffenen Ortsteilen der Landeshauptstadt Potsdam gibt es Sorgen um die Auswirkungen auf Menschen und Umwelt vor Ort sowie ein starkes Bedürfnis nach Beteiligung an den Planungen. Das Planverfahren wird für eine rund 350 000 m2 große Raststätte für einen Standort eröffnet, unter dem sich nach Ansicht der Fragesteller ein für Bran- denburger Verhältnisse sehr ertragreicher Ackerboden befindet. Das Gelände ist bisher nicht von Flächenversiegelung und Lichtverschmutzung betroffen und liegt in einem artenreichen Biotopverbund zwischen zwei Naturschutzgebieten. Angesichts der aus klimapolitischen Gründen notwendigen Verkehrsvermei- dung und Verkehrsverlagerung von Personen- wie Güterverkehr ist aus Sicht der Fragesteller die Errichtung immer neuer flächenintensiver Tank- und Rast- stätten und die massive Ausweitung der Lkw-Stellplatzkapazitäten grundsätz- lich zu hinterfragen. -

Langerwischer Weg/Karl-Marx-Straße"
Gemeinde Michendorf Ortsteil Wildenbruch Bebauungsplan Nr. 03/2012 "Langerwischer Weg/Karl-Marx-Straße" für Grundstücke nördlich des Langerwischer Weges sowie westlich der Karl-Marx-Straße im Norden des Siedlungsgebietes Bergheide Begründung mit Umweltbericht April 2016 Gemeinde Michendorf Ortsteil Wildenbruch Bebauungsplan Nr. 03/2012 "Langerwischer Weg/ Karl- Marx- Straße" für Grundstücke nördlich des Langerwischer Weges sowie westlich der Karl-Marx-Straße im Norden des Siedlungsgebietes Bergheide Begründung mit Umweltbericht April 2016 Auftraggeber: Gemeinde Michendorf, vertreten durch den Bürgermeister Reinhard Mirbach 14552 Michendorf Potsdamer Straße 33 Koordination: Hannelore Witte Bauen und öffentliche Ordnung e-mail: [email protected] (Sekretariat) Auftragnehmer/ Stadt • Land • Fluss Bebauungsplan: Büro für Städtebau und Stadtplanung Leuschner Damm 31 10999 Berlin Tel: 030 / 612 808 48 Fax: 030 / 612 808 55 e-mail: [email protected] Bearbeitung: Dipl.-Ing. Samir Hamzeh Umweltbericht: Fugmann Janotta Büro für Landschaftsarchitektur und Landschaftsentwicklung Belziger Straße 25 10823 Berlin Tel: 030 / 7001196-0 Fax: 030 / 7001196-22 e-mail: [email protected] Bearbeitung: Dipl.-Ing. Tilman Schulz Stand: 20.04.2016 Gemeinde Michendorf, OT Wildenbruch BP 03/2012 "Langerwischer Weg / Karl-Marx-Straße" Begründung mit Umweltbericht April 2016 INHALT TEIL A RAHMENBEDINGUNGEN / SITUATION.....................................8 1 Verranlassung, Erforderlichkeit und Ziele...................................................................8 -

Und Rastanlage Seeberg Ost Und West Datum: 02.03.2020 Lfd
Regelungsverzeichnis Unterlage: 11 für das Straßenbauvorhaben A 10, km 12,300, Erweiterung der bewirtschafteten Tank- und Rastanlage Seeberg Ost und West Datum: 02.03.2020 Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung Nr. (Strecke oder b) künftiger Achsen- Eigentümer (E) schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U) 1 2 3 4 5 1 11+685 Erweiterung der a) und b) Auf der linken und rechten Seite der Bundesautobahn 10 wird - bis Tank- und Rastanlage wie im Lageplan dargestellt - die Tank- und Rastanlage See- 12+875 Seeberg Ost und West Bundesrepublik Deutschland berg um 80 Lkw-Stellplätze auf 158 Stellplätze erweitert. (Bundesstraßenverwaltung) Im Rahmen der Erweiterung erfolgt der Neubau der Einfahrten, die Verbreiterung und Verlängerung der Einfädelungsstreifen Konzessionsberechtigter: an die durchgehenden Fahrbahnen der Autobahn, der Neubau Autobahn Tank & Rast der Fahrgassen, Parkstände, Gehwege, Entwässerungseinrich- Holding GmbH tungen und Ausstattungen außerhalb der Konzessionsflächen. Andreas-Hermes-Straße 7-9 53175 Bonn Auf der Ostseite werden Pkw-Stellplätze verdrängt und in den südöstlichen Bereich verlegt. Eventuell wird der bestehende Parkplatz grundhaft saniert. Überbaute Erholungsflächen werden ersetzt und bepflanzt. Die Pkw- Stellplätze und Erholungsflächen auf der Westseite, die Ausfahrten von der Autobahn einschließlich der Ausfäde- lungsstreifen, die Hochbauten und die Zufahrten zur Tankstelle und zum Servicegebäude bleiben von der Erweiterung unbe- rührt. Die Tank- und Rastanlage wird in den Erweiterungsbereichen neu eingefriedet. Die Einfriedigung schließt an die bereits vor- handene Einfriedigung bzw. den Wildschutzzaun an. Das auf den befestigten Flächen anfallende Oberflächenwasser Seite 1 von 62 Regelungsverzeichnis Unterlage: 11 für das Straßenbauvorhaben A 10, km 12,300, Erweiterung der bewirtschafteten Tank- und Rastanlage Seeberg Ost und West Datum: 02.03.2020 Lfd. -

Exposé Einfamilienhaus in Der Hubertusstr. 20, 14552 Michendorf
Exposé Einfamilienhaus in der Hubertusstr. 20, 14552 Michendorf Standortbeschreibung Lagebeschreibung und Verkehrsanbindung Die Gemeinde Michendorf befindet sich Landkreis Potsdam-Mittelmark, direkt am südlichen Verlauf der Bundesautobahn 10 und der Bundestraße B 2. Diese Bundesstraße stellt den Autobahnanschluss und die zügige Erreichbarkeit der Landeshauptstadt Potsdam sicher. Weiterhin gibt es in den Ortsteilen Michendorf und Wilhelmshorst regionale Bahnverbindungen in die Bundeshauptstadt Berlin. Die angebotene Liegenschaft befindet sich im gefragten Ortsteil Michendorf der Gemeinde Michendorf. Kindergärten, Schulen und Ärzte befinden sich in der Umgebung bzw. im nahen Potsdam. Der hohe Erholungswert zeichnet die Umgebung zusätzlich aus. Objektbeschreibung Grundstücksdaten Gemarkung: Michendorf Flur: 1 Flurstücke: 184 und 1294 Fläche: 1265 m² Wirtschaftsart: Gebäude- und Freifläche Amtsgericht: Potsdam Grundbuch von: Michendorf Grundbuchblatt: 1076 Lasten und Beschränkungen lt. Grundbuch: lastenfrei Eigentümerin: Evangelische Kirchengemeinde Michendorf-Wildenbruch Liegenschaftsbeschreibung Allgemeine Beschreibung Die Evangelische Kirchengemeinde Michendorf-Wildenbruch ist Eigentümerin der Liegenschaft. Die beiden Flurstücke sind mit einem Gebäude bebaut. Die beiden Flurstücke werden gemäß Erbbaurechtsgesetz vergeben. Das Gebäude wird an die / den zukünftige/n Erbbauberechtigte/n veräußert. Die verschiedenen Vertragsgegenstände werden übergeben, wie sie stehen und liegen. Nutzungsbeschreibung Die Liegenschaft wurde bisher zu Wohnzwecken -
Kreisprofil Teltow-Fläming 2010 Basisinformationen Bauen Undverkehr Landesamt Für Landkreis Teltow-Fläming Lage • Landschaft • Übersicht
UT- KP10_TF.ai 25.02.2010 09:58:35 Basisinformationen Kreisprofil Teltow-Fläming 2010 Fortschreibung “Brandenburg regional 2006” g Landesamt für Bauen und Verkehr Raumbeobachtun Landkreis Teltow-Fläming Lage • Landschaft • Übersicht Der Landkreis Teltow-Fläming (TF), mit rund 2.100 km² einer der Flächennutzung 2008 mittelgroßen Landkreise des Landes, erstreckt sich vom südwestli- chen Stadtrand Berlins bis an die Landesgrenze von Sachsen- Wasser Sonstige Anhalt. Der Landkreis TF bildet zusammen mit Potsdam-Mittelmark, 2% 1% Havelland und den kreisfreien Städten Potsdam und Brandenburg an Verkehr der Havel die bevölkerungsreichste und von der Fläche her zweit- 3% größte Planungsregion Brandenburgs Havelland-Fläming. Sitz der Kreisverwaltung ist das im weiteren Metropolenraum gelegene Siedlung Landwirtschaft Luckenwalde mit seinen 20.700 Einwohnern Mitte 2009. 6% 47% Topografie Berlin Wald 41% Potsdam Erkner Groß Kreutz Klein- Teltow (Havel) machnow Werder Schönefeld (Havel) Stahnsdorf Kloster Großbeeren Die Flächennutzung weicht geringfügig vom Landesmittel ab; der Lehnin Blankenfelde- Wildau Mahlow Landwirtschaftsflächenanteil ist um 3 % geringer, der des Waldes Ludwigs- Königs felde Wuster- Rangsdorf hausen 6 % höher; mit nur 37 km² Oberflächengewässern, was einem Anteil Beelitz von weniger als 2 % der Kreisfläche entspricht (Land: 3,4 %) gehört Blanken- Trebbin Teltow-Fläming mit OSL und PR zu den gewässerärmsten Landkrei- see Zossen e sen Brandenburgs. h Mellensee t B u a N r u t h Die Siedlungs- und Verkehrsflächen sind von 1996 - 2008 (ein- e r U r s t schließlich statistischer Bereinigungen) um knapp ein Viertel, ihr r o Hamme m Treuenbrietzen Luckenwalde rfließ t Anteil an der Kreisgesamtfläche um fast 2 %-Punkte auf 9,5 % a l gestiegen, was im Vergleich aller Landkreise im Flächenzuwachs e th u N Baruth/Mark einen vorderen Rang ausmacht. -
Schriftliche Anfrage
Drucksache 18 / 16 217 Schriftliche Anfrage 18. Wahlperiode Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Tino Schopf (SPD) vom 30. August 2018 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 04. September 2018) zum Thema: Lärmschutz an der BAB 10 im Bereich Karow-Buch/Brandenburg und Antwort vom 13. September 2018 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 21. Sep. 2018) Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen. Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28. Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Herrn Abgeordneten Tino Schopf (SPD) über den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin über Senatskanzlei - G Sen - A n t w o r t auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18 / 16217 vom 30. August 2018 über Lärmschutz an der BAB 10 im Bereich Karow-Buch/Brandenburg Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: Frage 1: Ist dem Berlin Senat die Problematik des an der Landesgrenze zu Brandenburg in Berlin-Karow endenden Lärmschutzes der Bundesautobahn 10 bekannt und wie positioniert sich der Berliner Senat dazu? Frage 2: Welche Behörden sind zuständig für die Lärmschutz-Planungen an diesem Abschnitt der BAB 10 und welche weiteren Behörden sind daran beratend beteiligt? Frage 3: Was hat der Berliner Senat bisher unternommen und was plant der Berliner Senat zukünftig zu unternehmen, um auf eine Schließung der Lücke im Lärmschutz an der BAB 10 hinzuwirken? Antwort zu 1 bis 3: Die Fragen 1 bis 3 werden wegen ihres sachlichen Zusammenhangs gemeinsam beantwortet. Die BAB 10 verläuft zwischen dem Autobahndreieck Pankow an der westlichen Landesgrenze und der östlichen Landesgrenze Berlin/Brandenburg im Land Berlin.