Verhandlungen Der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
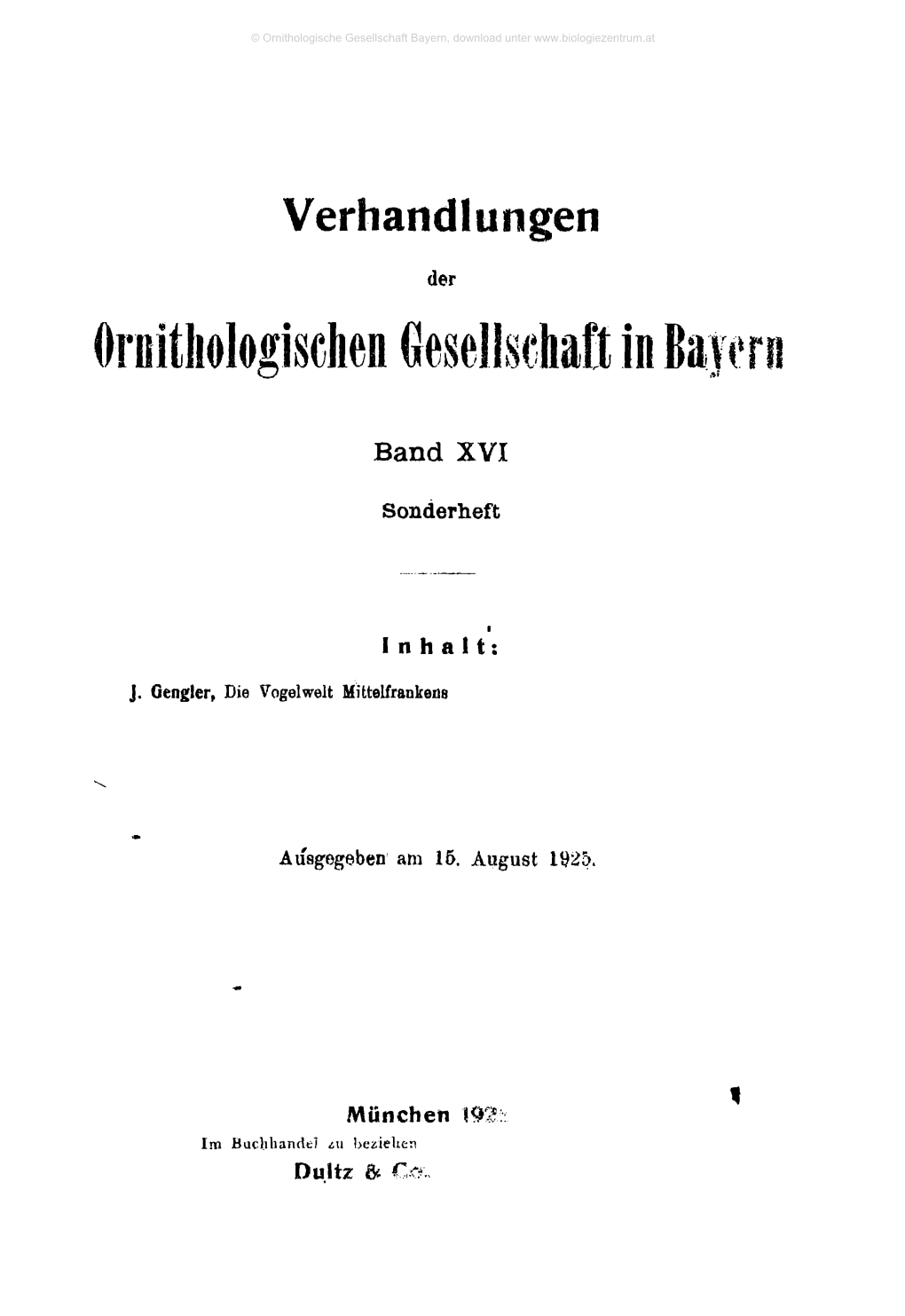
Load more
Recommended publications
-

Gemeindeblatt
Gemeindeblatt Amtliche Mitteilungen CÖT LMBERG Ausgabe Nr. 04/2019 Donnerstag, 4. April 2019 Öffnungszeiten des Rathauses Sprechstunden des Bürgermeisters Montag 08:00 — 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr Montag 14:00 — 16:00 Uhr Dienstag geschlossen Mittwoch 17:00 — 19:00 Uhr Mittwoch 08:00 — 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr Donnerstag 10:00 — 12:00 Uhr Donnerstag 08:00 — 12:00 Uhr Freitag 08:00 — 12:00 Uhr Telefon: 09803 9329-0 Telefon des Bürgermeisters: Telefax: 09803 9329-20 privat: 09803 1450 E-Mail: infoecolmberg.de Handy: 0170 8551277 Anschrift: Am Markt 1, 91598 Colmberg Nächste Ausgaben des Gemeindeblattes am: IMPRESSUM Donnerstag, 2. Mai (05/2019) Donnerstag, 6. Juni (06/2019) Auflage: 870 Stück Anzeigenabgabe bis spätestens Samstag, 20.04.2019 (05/2019) Die Verteilung erfolgt kostenlos Montag, 20.05.2019 (06/2019) an alle Haushalte. Später abgegebene Anzeigen werden NICHT mehr berücksichtigt! Mitteilungen des Bürgermeisters Unsere Homepage in neuem Design Wer kann mithelfen beim Ferienprogramm der Allianzgemeinden (Colmberg, Buch am Unter der bekannten Internetadresse Wald, Geslau und Windelsbach)? www.colmberg.de finden Sie ab sofort eine erneuerte und modernisierte Internetseite. Am 13.06.2019 von 13:30 - 17:00 Uhr. Nach über 15 Jahren war es an der Zeit diese grundlegend zu überarbeiten und für die Wir benötigen 2 Personen (Mamas, Papas, Nutzung mit Tablets und Smartphones Omas, Opas, Teenies), die uns bei der abzustimmen. In Zukunft werden aktuelle Durchführung helfen. Berichte und Veranstaltungen noch schneller gefunden, direkt auf der Startseite. Bitte unterstützen Sie uns und bei Interesse bei Herrn Wachmeier unter der Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Telefonnummer: 0151/22991850 oder per Durchstöbern und Lesen unserer neuen E-Mail: [email protected] melden. -

Einsatzdokumente Der UG-ÖEL
Einsatzdokumente der UG-ÖEL Einsatzdokumente der UG-ÖEL und der Verwendung im Einsatz Wann können die Dokumente wie eingesetzt werden. Einsatzdokumente der UG-ÖEL Einsatzdokumente der UG-ÖEL • Allgemeine Lage: – Über die Weihnachtsferien kam es im östlichen Mittelfranken, der nordöstlichen Oberpfalz und Oberfranken zuerst zu langanahaltenden Regenfällen und anschließend zu extremen Schneefällen. – Durch nun neue einsetzende Regenfälle nimmt die Schneelast auf den Dächern dieser Gebiete rapide zu. – Böden sind extrem aufgeweicht und an einigen Stellen kann es zu Muren- oder Geröllabgängen kommen – Durch die vorhergehenden Regenfälle sind im gesamten nordbayerischen Bereich die Pegelstände auf höchster Warnstufe – Einsetzender Rückreiseverkehr und Ende der Weihnachtsferien sorgen für volle Autobahnen – Aktuell wütete zudem ein Sturmtief das nur wenig schwächer eingestuft wird als der Orkan Kyrill 2007 Einsatzdokumente der UG-ÖEL • Daraus hat sich für den Bereich Nürnberger Land folgende Lage ergeben – Die Bahnstrecken Nürnberg – Schwandorf, Nürnberg – Regensburg, Nürnberg – Bayreuth sind von der Deutschen Bahn bis auf weiteres gesperrt worden – Im Bereich der Ortschaft Osternohe hat ein Felsrutsch das Ferienhotel Igelwirt schwer beschädigt, darunterliegende Häuser wurden teilweise verschüttet – In der Ortschaft Schupf kann Regen- und nun dazukommend Schmelzwasser nicht mehr abfließen und hat Keller und Straßen bereits überschwemmt, es drohen zahlreiche weitere Keller vollzulaufen – In den Ortschaften Hedersdorf und Schnaittach ist die Schnaittach vehement über die Ufer getreten und setzt Keller unter Wasser und macht die Passage nach Osternohe unmöglich – In den Gemeinden Kichensittenbach, Simmelsdorf, Schnaittach, Vorra, Velden, Hartenstein, Neuhaus sowie in den Stadtgebiet Hersbruck, Lauf, Altdorf und Feucht sind extreme Schneelasten auf Haus und Hallendächern. Die Last wird mit einsetzendem Regen die zulässigen Traglasten vermutlich deutlich überschreiten. -

Anlage 1 Zur Richtlinie Für Die Gewährung Von Zuwendungen Aus Dem Sonderbudget Leihgeräte (Sole) OBERBAYERN Lfd. Nr. Schulauf
Anlage 1 zur Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sonderbudget Leihgeräte (SoLe) OBERBAYERN Spalte 1: laufende Nummer Spalte 2: Name des Schulaufwandsträgers Spalte 3: Sonderbudget Leihgeräte lfd. Schulaufwandsträger Höchstbetrag Nr. öffentlicher Schulen der Förderung 1 Adelschlag, Gemeinde 4.554,00 € 2 Ainring, Gemeinde 24.932,00 € 3 Allershausen, Schulverband 16.282,00 € 4 Alling, Gemeinde 7.063,00 € 5 Altenmarkt a.d.Alz, Gemeinde 5.957,00 € 6 Altenstadt (Oberbayern), Gemeinde 4.510,00 € 7 Althegnenberg, Gemeinde 6.006,00 € 8 Altmannstein M., Gemeinde 13.441,00 € 9 Altomünster, Schulverband 21.680,00 € 10 Altötting, Landkreis 273.938,00 € 11 Altötting, St., Gemeinde 37.622,00 € 12 Amerang - Grundschule -, Schulverband 8.376,00 € 13 Ampfing, Gemeinde 13.866,00 € 14 Ampfing, Schulverband 19.504,00 € 15 Andechs, Gemeinde 8.356,00 € 16 Anger, Gemeinde 9.610,00 € 17 Anzing, Gemeinde 8.074,00 € 18 Apfeldorf, Gemeinde 3.779,00 € 19 Aresing - Mittelschule -, Schulverband 9.088,00 € 20 Aschau a.Inn, Gemeinde 8.488,00 € 21 Aschau i.Chiemgau, Gemeinde 8.376,00 € 22 Aschheim, Gemeinde 18.110,00 € 23 Aßling, Verwaltungsgemeinschaft 16.772,00 € 24 Attenkirchen, Gemeinde 4.493,00 € 25 Au i.d.Hallertau M., Gemeinde 8.903,00 € 26 Aying, Gemeinde 9.561,00 € 27 Baar-Ebenhausen, Gemeinde 7.415,00 € 28 Babensham, Schulverband 6.270,00 € 29 Bad Aibling, St., Gemeinde 41.032,00 € 30 Bad Bayersoien, Gemeinde 2.198,00 € 31 Bad Endorf - Mittelschule -, Schulverband 14.446,00 € 32 Bad Endorf, Markt 12.139,00 € 33 Bad Endorf-Höslwang - Grundschule -, Schulverband 3.410,00 € 34 Bad Feilnbach, Gemeinde 18.108,00 € 35 Bad Heilbrunn, Gemeinde 6.867,00 € 36 Bad Kohlgrub, Gemeinde 10.493,00 € 37 Bad Reichenhall (Große Kreisstadt ), Gemeinde 48.326,00 € 38 Bad Tölz, St., Gemeinde 39.083,00 € 39 Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkreis 318.663,00 € Seite 1/79 Anlage 1 zur Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sonderbudget Leihgeräte (SoLe) OBERBAYERN Spalte 1: laufende Nummer Spalte 2: Name des Schulaufwandsträgers Spalte 3: Sonderbudget Leihgeräte lfd. -

Medtech Companies
VOLUME 5 2020 Medtech Companies Exclusive Distribution Partner Medtech needs you: focused partners. Medical Technology Expo 5 – 7 May 2020 · Messe Stuttgart Enjoy a promising package of benefits with T4M: a trade fair, forums, workshops and networking opportunities. Discover new technologies, innovative processes and a wide range of materials for the production and manufacturing of medical technology. Get your free ticket! Promotion code: MedtechZwo4U T4M_AZ_AL_190x250mm_EN_C1_RZ.indd 1 29.11.19 14:07 Medtech Companies © BIOCOM AG, Berlin 2020 Guide to German Medtech Companies Published by: BIOCOM AG Luetzowstrasse 33–36 10785 Berlin Germany Tel. +49-30-264921-0 Fax +49-30-264921-11 [email protected] www.biocom.de Find the digital issues and Executive Producer: Marco Fegers much more on our free app Editorial team: Sandra Wirsching, Jessica Schulze in the following stores or at Production Editor: Benjamin Röbig Graphic Design: Michaela Reblin biocom.de/app Printed at: Heenemann, Berlin Pictures: Siemens (p. 7), Biotronik (p. 8), metamorworks/ istockphoto.com (p. 9), Fraunhofer IGB (p. 10) This book is protected by copyright. All rights including those regarding translation, reprinting and reproduction reserved. tinyurl.com/y8rj2oal No part of this book covered by the copyright hereon may be processed, reproduced, and proliferated in any form or by any means (graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or via information storage and retrieval systems, and the Internet). ISBN: 978-3-928383-74-5 tinyurl.com/y7xulrce 2 Editorial Medtech made in Germany The medical technology sector is a well-established pillar within the healthcare in- dustry in Germany and one of the major drivers of the country’s export-driven eco- nomic growth. -
Der Mittelfränkische Jakobsweg
DER MITTELFRÄNKISCHE JAKOBSWEG VON NÜRNBERG NACH ROTHENBURG O. D. TAUBER INHALTSVERZEICHNIS Vorwort .............................................................. S. 4/5 Die Jakobswege in Europa.................................... S. 6/7 Der Mittelfränkische Jakobsweg............................S. 8/9 Entlang des Weges ..............................................S. 10/11 Meditationsstelen, Obstbaumtafeln, Raststellen, Pilgerkärtchen, Bodenmuscheln Kooperationspartner Die Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft Würzburg e.V.......................................................S. 12 Der Fränkische Albverein e.V. ................................S. 13 Kirche i Information Bahnhof Einkehrmöglichkeit Übernachtungsmöglichkeit Foto: Landschaft Großhabersdorf 2 Wegbeschreibungen und Kartenteil Von Nürnberg nach Roßtal................................ab S. 14 Von Roßtal nach Heilsbronn..............................ab S. 24 Von Heilsbronn nach Weihenzell .......................ab S. 32 Von Weihenzell nach Colmberg .........................ab S. 42 Von Colmberg nach Rothenburg o. d. Tauber ......ab S. 54 Ansprechpartner .............................................S. 66/67 Pilgerzentrum Nürnberg, St. Jakob Pilgerbegleitung Tourismusinformationen am Weg Internetadressen Weitere Jakobswege Anzeige der Laufrichtung (Wegbeschreibung) 3 VORWORT Sehr verehrte Gäste, liebe Pilgerinnen, liebe Pilger, in allen Religionen und Kulturen gibt es das Phänomen des Pilgerns, beinahe alle Religionen kennen Pilgerwege. Schon der Kirchenvater Augustinus schrieb im 4. -

Entwurf Für Den Kanal Zur Verbindung Der Donau Mit Dem Main München, 1832
Pechmann, Heinrich, Freiherr von: Entwurf für den Kanal zur Verbindung der Donau mit dem Main München, 1832 Abschrift: Manfred Kimmig, Burgthann, 2000 Manfred Kimmig, Steinfeldstrasse 35, 90559 Burgthann, Tel. 09183 4569 Vorbemerkung des Bearbeiters: Der hier vorliegende Text ist Wort- und Buchstabengetreu abgeschrieben worden. Lediglich den damaligen Maßen- und Gewichtsangaben wurden die heutigen dezimalen Werte in ( ) nachgesetzt und heute nicht mehr bekannte oder in ihrem Sinn veränderte Begriffe sind ebenfalls erläutert, entweder in ( ) nachgesetzt oder als Fußnote. Für die Internetpublikation überarbeitet: Hans Grüner, Nürnberg, 2009 Entwurf für den Kanal zur Verbindung der Donau mit dem Main von Heinrich Freyherrn von Pechmann Auf Allerhöchsten Befehl herausgegeben Königl. Oberbaurath und Ritter des Militär-Verdienst-Max-Josephs-Ordens Mit einer Karte und sieben Steindrucktafeln München 1832 Vorerinnerung. Seine königliche Majestät haben den schon seit Jahrhunderten zur Sprache gekommenen und so allgemein gewünschten Kanal zur Verbindung der Donau mit dem Main und Rhein ausführen zu lassen beschlossen. Dem Verfasser wurde der ehrenvolle Auftrag zu Theil; den Plan hiezu zu entwerfen. Dieses Unternehmen ist zu wichtig und von zu allgemeinem Interesse nicht nur allein für ganz Deutschland, sondern auch für den größten Theil der an dasselbe grenzenden Staaten, als daß eine Bekanntmachung dieses Entwurfes nicht vollkommen zweckmäßig seyn sollte. Seine Königliche Majestät haben dieselbe allergnädigst anbefohlen, und der Verfasser gehorcht -

Amts- Und Mitteilungsblatt Amts- Und
Gemeinde Amts-Amts- undund Sachsen b.Ansbach Hauptstraße 22 91623 Sachsen b.Ansbach Tel. 0 98 27 / 92 20-0 MitteilungsblattMitteilungsblatt Fax 0 98 27 / 92 20-20 Internet: http://www.sachsen-b-ansbach.de der Gemeinde Sachsen b.Ansbach E-Mail: [email protected] 35. Jahrgang 1. November 2019 Nr. 11 / 2019 AMTLICHER TEIL Bürgerversammlungen 2019 Die Bürgersammlungen finden wie folgt statt: Aus der Gemeinderatssitzung vom 09.09.2019 Dienstag, 29. Oktober um 20:00 Uhr Herr Diezinger, Arch. Büro Domscheit, hat die Genehmi- im Gemeinschaftshaus Rutzendorf gungsplanung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses für die Gemeindeteile Rutzendorf und Volkersdorf Sachsen b.Ansbach vorgestellt. Der Gemeinderat hat die Freigabe der Genehmigungspla- Dienstag, 05. November um 20:00 Uhr nung und des Förderantrags erteilt und beschlossen diese in der Gastwirtschaft Sturm, Ratzenwinden für die Gemeindeteile Ratzenwinden, Steinhof, einzureichen. Obere u. Untere Walkmühle Die Gemeinde Sachsen b.Ansbach hat einen Zuwen- Dienstag, 12. November um 20:00 Uhr dungsbescheid erhalten, indem das Vorhaben zur baulichen im Gemeinschaftshaus, Alberndorf Sanierung der Trinkwasseranlagen mit pauschalen Zuwen- für die Gemeindeteile Alberndorf u. Steinbach dungen in Aussicht gestellt wird. Donnerstag, 14. November um 20:00 Uhr Aufgrund Lärmbeschwerden im Bereich der Deutschen im Gemeinschaftshaus Neukirchen Bahn wurde von Seiten der Bahn mitgeteilt, dass passive für den Gemeindeteil Neukirchen Schallschutzmaßnahmen gefördert werden können, wenn Dienstag, 19. November um 20:00 Uhr der betreffende Bahnabschnitt in den Bereich eines Sanie- im Veranstaltungsraum Arnold, Hirschbronn rungsabschnittes fällt. für den Gemeindeteil Hirschbronn Betroffene Bürger können sich an die Gemeindeverwaltung Donnerstag, 21. November um 20:00 Uhr wenden. im Haus der Bäuerin Der Gemeinderat hat beschlossen, ab November alle für alle Gemeindeteile, insbesondere Sachsen und Sitzungen elektronisch zu laden. -

Weites Land - Auf Dem Karte Am Ende Des Dokuments in Höherer Auflösung
Weites Land - Auf dem Karte am Ende des Dokuments in höherer Auflösung. Wiesethweg zum Altmühlsee Entfernung: ca. 56 km Karte am Ende des Dokuments in höherer Höhenprofil Auflösung. Weg be schrei bung Auf dem Wiesethweg zum Alt mühl see Stand: 15.7.2021 Der Name täuscht. Dies ist kein echter „Flusstal-Radweg“, sondern es geht z. T. auch moderat auf und ab – immer in grober Orientierung Höhe in Metern, Wegstrecke in km am Verlauf des Flusses von der Quelle bis zur Mündung. Wir queren die Wieseth dabei an mehreren Stellen, fahren durch dünn besiedelte Vorwort Gegenden und passieren einige se hens werte Orte am Weg. In weiten Teilen unserer Strecke ist der Fluss jedoch nicht vom Radweg aus zu Gute Nachrichten für Radler! Durch die Ver län ge rung der S4 fährt sehen … sie nun in regelmäßigem Intervall über Ans bach weiter bis Dombühl und auch die -Züge sind seit einiger Zeit mit geräumigen Der Alt mühl see und Gun zen hau sen am Alt mühl see als Ziel der Tour Doppelstockwagen ausgestattet. Das Platzan ge bot für Fahr räder hat sind touristisch ge prägt und hier bieten sich zahl reiche Rast- und Ein- sich damit erhöht und der westliche Land kreis Ans bach ist somit kehr mög lich keiten an wesentlich besser als vorher in das Schienennetz des VGN eingebunden. Es wird Zeit, diese land schaft lich reizvolle Gegend mit Der Wiesethweg dem Rad und dem VGN genauer zu erkunden. Der durchgehend beschilderte „Wiesethweg“ ist eigentlich nur ca. 35 km lang (von der Quelle in Weinberg bis zur Mündung bei Ornbau). -

Im Tal Der Fränkischen Rezat FRÄN KISCHE REZAT – DIE FAKTEN
Im Tal der Fränkischen Rezat FRÄN KISCHE REZAT – DIE FAKTEN: Entfernung: ca. 66 km „Die ‚Frän kische Rezat‘ entspringt auf der Frankenhöhe rund 1,5 km südöstlich der Bergkuppe des Petersbergs (504 m ü. NN) Vorwort und etwa 2,3 km (je Luftlinie) nord west lich von Oberdachstetten auf 452 m Höhe. Direkt durch ihr Quellgebiet und später auch Eine neue Stre cken füh rung, die auf Teil stücken des Fernradwegs ent lang des Flusses verläuft ein Abschnitt der Ei sen bahnstrecke Burgenstraße aufbaut. So ergibt sich ein durchgängiger Radweg, der von Würzburg nach Treucht lingen. bis zur Mündung in Georgensgmünd immer ent lang der Frän kischen Rezat verläuft. Sehr schöne Spiel- und Rastplätze liegen am Weg und Die „Frän kische Rezat“ fließt südostwärts unter anderem durch ein Lehrpfad im mittleren Teil der Tour zum Thema „Wasser und Oberdachstetten, Lehrberg, Ans bach, Sachsen bei Ans bach, Natur“ bietet in te res sante Zusatzin for ma ti onen zur Flusslandschaft. Lichtenau, Windsbach und Spalt. In Georgensgmünd vereinigt sie sich auf 342 m Höhe mit der Schwäbischen Rezat zur Rednitz, so Zur „Quelle“ werden wir bei unserer Tour aber nicht gelangen, denn dass die ‚Frän kische Rezat‘ ins ge samt 110 m Hö hen un ter schied sie liegt wenige Kilometer weiter westlich an der Bahnstrecke nach überwindet.“ Würzburg. Wir haben aber noch einiges vor uns und starten daher direkt von hier zu unserer Tour in südöstlicher Rich tung ent lang der Quelle: Wikipedia Frän kischen Rezat bis zur Mündung in Georgensgmünd. Besondere Merkmale / Charakteristik: Genussradeln ohne große konditionelle An for de rungen. -

Kreistagswahl 2014
Bewerberinnen und Bewerber für die Kreistagswahl 2020 Platz Name Gemeinde Platz Name Gemeinde 1 Trinkl, Cornelia Röthenbach 36 Bammler, Harald Velden 2 Dünkel, Norbert Hersbruck 37 Pöferlein, Thomas Lauf 3 Mortler, Marlene Lauf 38 Hellmann, Wolfgang Röthenbach 4 Eckstein, Dr. Bernd Altdorf 39 Bock, Gerhard Kirchensittenbach 5 Müller, Karin Schnaittach 40 Wild, Christa Altdorf 6 Ritter, Thomas Burgthann 41 Siegl, Oliver Feucht 7 Thiel, Norbert Hersbruck 42 Geistmann, Andreas Leinburg 8 Meyer, Heinz Burgthann 43 Jäger, Karl Richard Lauf 9 Falk, Klaus Ottensoos 44 Süß, Christian Schwaig 10 Schmidt, Betty Offenhausen 45 Reinhardt, Dirk Engelthal 11 Schmidt, Michael Winkelhaid 46 Kummarnitzky, Dennis Burgthann 12 Müller, Bernd Vorra 47 Huth, Matthias Ottensoos 13 Felßner, Günther Lauf 48 Beuttler, Mike Lauf 14 Brückner, Helmut Happurg 49 Brunner, Thorsten Pommelsbrunn 15 Fischer, Marion Winkelhaid 50 Schmidt, Helmut Röthenbach 16 Springer, Josef Neuhaus 51 Hergenröder, Alisa Lauf 17 Hoffmann, Martina Pommelsbrunn 52 Unterburger, Oliver Schnaittach 18 Pitterlein, Frank Schnaittach 53 Trisl, Marion Leinburg 19 Gleißenberg, Markus Henfenfeld 54 Decker, Martin Schnaittach 20 Rösel, Kerstin Alfeld 55 Zitzmann, Christian Simmelsdorf 21 Maschler, Norbert Lauf 56 Schuster, Daniel Feucht 22 Uschalt, Peter Hersbruck 57 Richter, Sabine Neuhaus 23 Kramer, Thomas Altdorf 58 Grassl, Christoph Ottensoos 24 Wolze, Dr. Otto Hersbruck 59 Kraus, Petra Lauf 25 Lorenz, Petra Winkelhaid 60 Guth, Silvia Burgthann 26 Hommel, Alexander Feucht 61 Weber, Manfred Lauf 27 Bezold, Lisa Schnaittach 62 Beck, Andreas Neunkirchen a. S. 28 Ballas, Johannes Rückersdorf 63 Döpking, Christine Altdorf 29 Schmidt, Manfred Reichenschwand 64 Müller, Christina Lauf 30 Holzammer, Markus Schwarzenbruck 65 Rösch, Nils-Alexander Altdorf 31 Kraußer, Thomas Leinburg 66 Deuerlein, Rainer Lauf 32 Loos, Hannes Hartenstein 67 Bach, Christian Ottensoos 33 Schmidt, Beate Leinburg 68 Nette, Veronika Burgthann 34 Fankhänel, Jens Neunkirchen a. -

Rückblick Auf Unsere Seniorenteams
Rückblick auf unsere Seniorenteams SV Arberg – SpVgg Ansbach 09 II 2:2 (1:1) Unser Coach schickte eine relativ unveränderte Mannschaft ins Rennen, Stefan Kraft ersetzt Marco Hellmann und René Sabler startet für Christian Nägelein. Das 1:0 durch Florian Glas fiel nach Flanke von René Sabla und einem sauberen Abschluss durch die Beine des Ansbacher Torhüters. Das 1:1 resultiert nach einem eigenen Einwurf tief in der eigenen Hälfte. Stefan Hammeter ist der Nutznießer nachdem der Ball über Umwege zu ihm kommt. Der Stürmer spielt die Abwehr schwindelig und lupft über den Torspieler zum Ausgleich. Nach dem Pausentee traf Felix Semmlinger zum 2:1 durch einen Foulelfmeter. Nachdem der aufopfernd spielende Florian Glas mit seinen Kräften am Ende war, ging nicht mehr viel nach vorne. Wieder war es Hammeter der zum 2:2 über Kergl einlupfte. Am Ende waren wahrscheinlich beide Mannschaften gut bedient mit den zwei Gegentoren. Sowohl Felix Semmlinger (Fallrückzieher) als auch Stefan Hammeter (Lattenschuss) hätten ihre Farben noch zum Sieg schießen können. Das vierte Spiel ohne Niederlage, jedoch nur ein Sieg aus den letzten sechs Spielen. Punkteschnitt: 1,17 im Jahr 2019. Punkteschnitt: 1,17 in der Saison 2018/19. SV Segringen – SV Arberg 0:4 (0:3) Durch den verdammt wichtigen Sieg in Segringen konnte sich unsere Truppe auf den Nichtabstiegsplatz vorschieben. Die Treffer erzielten Florian Glas, Felix Semmlinger, René Sabla und Christian Nägelein. Heute gilt es gegen den SV Neuhof im nächsten Sechs-Punkte-Spiel gleich nachzulegen. In den verbleibenden fünf Partien gilt es noch einmal alles in die Waagschale zu werfen, um auch in der kommenden Saison wieder in der Kreisliga auflaufen zu können! Tucher-Ligapokal Gruppe 5: SV Dentlein – SV Arberg 0:5 (0:3) Bereits Mitte letzter Woche qualifizierte sich unser Team souverän für das Finale im Ligapokal. -

Starter Gau Ansbach
StartnummerName, Vorname VereinsnummerVerein KennzahlWettkampf Klasse Start am (Datum)Start umStandnr. (Uhr)Ke 2148 Auerochs, Erich 0102066 SG 1813 Dietenhofen 1.10.14 Luftgewehr Herren III 11.07.2019 09:55 41 E 2110 Bach, Gerhard 0102040 Kgl. priv. Sch. Gilde Rothenburg o. d. T. 2.59.16 Sportpistole .45 ACP Herren IV 29.06.2019 08:00 39 E 2110 Bach, Gerhard 0102040 Kgl. priv. Sch. Gilde Rothenburg o. d. T. 2.40.16 KK Sport-Pistole Herren IV 14.07.2019 08:00 36 E 2110 Bach, Gerhard 0102040 Kgl. priv. Sch. Gilde Rothenburg o. d. T. 2.45.14 Zentralfeuerpistole .30/.38Herren III 28.06.2019 09:30 35 E 2141 Bauer, Manfred 0102065 Jagd- u. Sport-SV Herrieden-Wieseth 3.20.14 Wurfscheiben Skeet Herren III 13.07.2019 09:00 44 E 2136 Beck-Hartmann, Hildegard 0102065 Jagd- u. Sport-SV Herrieden-Wieseth 3.20.11 Wurfscheiben Skeet Damen I 13.07.2019 09:00 28 E 2136 Beck-Hartmann, Hildegard 0102065 Jagd- u. Sport-SV Herrieden-Wieseth 3.10.15 Wurfscheiben Trap Damen III 06.07.2019 09:00 48 M 2118 Berwind, Udo 0102051 SG 1960 Weihenzell 2.40.14 KK Sport-Pistole Herren III 14.07.2019 08:00 16 E 2121 Buckel, Leon 0102053 SV Weißenkirchberg 1.10.20 Luftgewehr Schüler m. 13.07.2019 12:15 39 E 2113 Christofori, Erwin 0102040 Kgl. priv. Sch. Gilde Rothenburg o. d. T. 1.11.72 Luftgewehr Auflage Senioren II m. 12.07.2019 14:45 72 E 2142 Danner, Dieter 0102065 Jagd- u.