Abschlussbericht
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Bat Conservation 2021
Bat Conservation Global evidence for the effects of interventions 2021 Edition Anna Berthinussen, Olivia C. Richardson & John D. Altringham Conservation Evidence Series Synopses 2 © 2021 William J. Sutherland This document should be cited as: Berthinussen, A., Richardson O.C. and Altringham J.D. (2021) Bat Conservation: Global Evidence for the Effects of Interventions. Conservation Evidence Series Synopses. University of Cambridge, Cambridge, UK. Cover image: Leucistic lesser horseshoe bat Rhinolophus hipposideros hibernating in a former water mill, Wales, UK. Credit: Thomas Kitching Digital material and resources associated with this synopsis are available at https://www.conservationevidence.com/ 3 Contents Advisory Board.................................................................................... 11 About the authors ............................................................................... 12 Acknowledgements ............................................................................. 13 1. About this book ........................................................... 14 1.1 The Conservation Evidence project ................................................................................. 14 1.2 The purpose of Conservation Evidence synopses ............................................................ 14 1.3 Who this synopsis is for ................................................................................................... 15 1.4 Background ..................................................................................................................... -

Ausgabe 11/2019
Amtsblatt für das Amt Biesenthal-Barnim 29. Jahrgang Biesenthal, 27. August 2019 Nummer 11 | Woche 35 I. Amtlicher Teil Amtliche Bekanntmachungen Öffentliche Bekanntmachung über die Kommunalwahl am 15.07.2019 – Wahl des Ortsbeirates des Ortsteiles Ruhlsdorf, Gemeinde Marienwerder Seite 2 Bekanntmachung über die Auslegung von geänderten Planunterlagen zum Zwecke der Planfeststellung für den Neubau der Ortsumgehung B 167 Finowfurt/Eberswalde (L 220 – L 200) einschließlich der trassenfernen landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen in den Gemarkungen Eberswalde, Finow und Spechthausen (Stadt Eberswalde), Werneuchen (Stadt Werneuchen), Joachimsthal und Friedrichswalde (Amt Joachimsthal), Hohenfinow und Britz (Amt Britz-Chorin-Oderberg), Ruhlsdorf und Marienwerder (Amt Biesenthal-Barnim), Schorfheide, Finowfurt, Groß Schönebeck, Werbellin und Lichterfelde (Gemeinde Schorfheide), Prenden und Zerpenschleuse (Gemeinde Wandlitz), Lobetal (Stadt Bernau bei Berlin) im Landkreis Barnim sowie Kreuzbruch (Stadt Liebenwalde), Fürstenberg/Havel (Stadt Fürstenberg/Havel), Borgsdorf (Stadt Hohen Neuendorf), Velten (Stadt Velten) im Landkreis Oberhavel sowie Templin (Stadt Templin), Gerswalde, Temmen und Groß Fredenwalde (Amt Gerswalde) im Landkreis Uckermark sowie Eggersdorf bei Müncheberg (Stadt Müncheberg) im Landkreis Märkisch-Oderland Seite 2 | 2 | 27. August | Nr. 11 | Woche 35 AMTSBLATT FÜR DAS AMT BIESENTHAL-BARNIM I. AMTLICHER TEIL Amtliche Bekanntmachungen Öffentliche Bekanntmachung – Kommunalwahl am 15. Juli 2019 Wahl des Ortsbeirates des Ortsteiles Ruhlsdorf, Gemeinde Marienwerder Vorläufiges Wahlergebnis: Gewählte Bewerber: 1. Herr Frank Lützow 49 Stimmen Einwohneranzahl: 462 2. Frau Sabine Schröer-Seidler 25 Stimmen wahlberechtigt: 417 3. Frau Eva-Maria Hettwer 24 Stimmen (anwesend müssen fünf v. H. der wahlberechtigten Personen sein) Zahl der Wähler: 49 Stimmabgabe: 147 gültige Stimmen: 98 ungültige Stimmen: 49 Biesenthal, den 13.08.2019 Zahl der Sitze: 3 BEWERBER: 1. Herr Frank Lützow 2. -

… Simply Beautiful About the Uckermark
… Simply beautiful About the uckermArk Area: 3,o77 km2 ++ Population: 121,o14 ++ Population density: 39 inhabitants per km2 – one of the most sparsely populated areas in Germany ++ 5 % of the region is covered by water (compared with 2.4 % of Germany as a whole) ++ The Uckermark border to Poland runs mainly along the River Oder and is 52 km long. the uckermark – naturally What we want to do: Eco-friendly holidays Enable low-impact tourism close to nature Ensure products and services are high quality Create lasting natural and cultural experiences Generate value for the region What you can do: Treat nature with respect Buy regional products With its freshwater lakes, woodland swamps, Stay in climate-friendly accommodation natural river floodplains, and rare animals and Go by train, bicycle, canoe or on foot, and plants, almost half of the Uckermark is desig- treat your car to a break nated a protected landscape. We want to safe- guard this landscape for future generations. Our nature park and national park partners feel a close connection to these conservation areas, run their businesses sustainably and focus on high-quality services, including guid- ed canoe trips, eco-friendly accommodation, and regional cuisine. As winners of the Germany-wide competition holidaying in the uckermark: 1 Taking a break in the Uckermark Lakes Nature Park 2 Horses in the Uckermark meadows for sustainable tourism, we strive to achieve 3 Relaxing with a book by the Oberuckersee lake near Potzlow 4 Discovering nature 5 Places with history 6 Regional products long-term, sustainable goals. Large image: Canoe trip in the Lower Oder Valley National Park – starting off near Gartz 2 The Uckermark – naTURALLY The Uckermark – naTURALLY 3 enjoy nature Space to breathe NAture protectioN zoNes ANd LAkes The Uckermark Lakes Natural Park is a huge net- work of lakes with 1oo km of waterways for canoeists, more than 5o freshwater lakes and optimal nesting condi- tions for ospreys. -

A History of German-Scandinavian Relations
A History of German – Scandinavian Relations A History of German-Scandinavian Relations By Raimund Wolfert A History of German – Scandinavian Relations Raimund Wolfert 2 A History of German – Scandinavian Relations Table of contents 1. The Rise and Fall of the Hanseatic League.............................................................5 2. The Thirty Years’ War............................................................................................11 3. Prussia en route to becoming a Great Power........................................................15 4. After the Napoleonic Wars.....................................................................................18 5. The German Empire..............................................................................................23 6. The Interwar Period...............................................................................................29 7. The Aftermath of War............................................................................................33 First version 12/2006 2 A History of German – Scandinavian Relations This essay contemplates the history of German-Scandinavian relations from the Hanseatic period through to the present day, focussing upon the Berlin- Brandenburg region and the northeastern part of Germany that lies to the south of the Baltic Sea. A geographic area whose topography has been shaped by the great Scandinavian glacier of the Vistula ice age from 20000 BC to 13 000 BC will thus be reflected upon. According to the linguistic usage of the term -

Response of the German Government to the Report of the European
CPT/Inf (2003) 21 Response of the German Government to the report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) on its visit to Germany from 3 to 15 December 2000 The German Government has requested the publication of the CPT's report on the visit to Germany in December 2000 (see CPT/Inf (2003) 20) and of its response. The response, translated into English by the German authorities, is set out in this document. The Appendices to the response are not reproduced in this document. The German text of the response can be found on the CPT's website (www.cpt.coe.int). Strasbourg, 12 March 2003 Observations by the Federal Government on the recommendations, comments and requests for information of the CPT on the occasion of its visit from 3 to 15 December 2000 (14 June 2002) Introduction The Federal Government herewith submits its observations on the recommendations, comments and requests for information embodied in the report of the Committee on its visit from 3 to 15 December 2000 (CPT (2001) 5). From 3 to 15 December 2000, a delegation of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) visited the Federal Republic of Germany. The visit was part of the Committee's programme of periodical visits for the year 2000. It was the third periodical visit by the CPT to Germany and the fourth visit in total. The Federal Republic of Germany would like to express its thanks for the positive cooperation with the CPT, and is glad to take note of the critical recommendations and comments and use them as a guide for improvements. -

The Protestant Ethic and Work: Micro Evidence from Contemporary Germany
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung www.diw.de SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research 330 Jörg L. Spenkuch A The Protestant Ethic and Work: Micro Evidence from Contemporary Germany Berlin, November 2010 SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research at DIW Berlin This series presents research findings based either directly on data from the German Socio- Economic Panel Study (SOEP) or using SOEP data as part of an internationally comparable data set (e.g. CNEF, ECHP, LIS, LWS, CHER/PACO). SOEP is a truly multidisciplinary household panel study covering a wide range of social and behavioral sciences: economics, sociology, psychology, survey methodology, econometrics and applied statistics, educational science, political science, public health, behavioral genetics, demography, geography, and sport science. The decision to publish a submission in SOEPpapers is made by a board of editors chosen by the DIW Berlin to represent the wide range of disciplines covered by SOEP. There is no external referee process and papers are either accepted or rejected without revision. Papers appear in this series as works in progress and may also appear elsewhere. They often represent preliminary studies and are circulated to encourage discussion. Citation of such a paper should account for its provisional character. A revised version may be requested from the author directly. Any opinions expressed in this series are those of the author(s) and not those of DIW Berlin. Research disseminated by DIW Berlin may include views on public policy issues, but the institute itself takes no institutional policy positions. The SOEPpapers are available at http://www.diw.de/soeppapers Editors: Georg Meran (Dean DIW Graduate Center) Gert G. -

Materiały Zachodniopomorskie
MATERIAŁY ZACHODNIOPOMORSKIE Rocznik Naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie Nowa Seria Tom XII 2016 Szczecin 2016 Redaktor Anna B. Kowalska Sekretarz redakcji Bartłomiej Rogalski Członkowie redakcji Krzysztof Kowalski,Redaktor Dorota Naczelny Kozłowska, Rafał Makała Anna B. Kowalska Rada Naukowa dr hab. prof. UJ WojciechSekretarz Blajer, prof. Redakcji dr hab. Aleksander Bursche, prof. dr hab. WojciechBartłomiej Dzieduszycki, Rogalski prof. dr Hauke Jöns, dr hab. prof. UW Joanna Kalaga, dr hab. prof. UG Henryk Machajewski, dr Dmitrij Osipov,Członkowie dr hab. prof. Redakcji UWr Tomasz Płonka Krzysztof Kowalski, Dorota Kozłowska, Rafał Makała Recenzenci dr Justyna Baron, dr EugeniuszRada Cnotliwy, Naukowa dr hab. Andrzej Janowski, dr hab.dr prof.hab. UJprof. Wojciech PAN Michał Blajer, prof. Kara, Aleksander dr hab. prof. Bursche, UAM prof. Andrzej Wojciech Michałowski Dzieduszycki, dr hab. prof. UAM Jarosław Jarzewicz, prof. Hauke Jöns, dr hab. prof. UW Joanna Kalaga, dr hab. prof. UG HenrykTłumaczenie Machajewski, dr Dmitrij Osipov, dr hab. prof. UWr Tomasz Płonka Tomasz Borkowski, Michał Adamczyk Redakcja wydawnicza ProofreadingPiotr Wojdak Agnes Kerrigan Tłumaczenie Tomasz Borkowski,Redakcja Agnes wydawnicza Kerrigan (proofreading) Barbara Maria Kownacka, Marcelina Lechicka-Dziel Recenzenci dr hab. prof. UWr Artur Błażejewski, drProjekt hab. Mirosław okładki Hoffmann, dr hab. Andrzej Janowski, dr hab. prof. PAN MichałWaldemar Kara, dr hab. Wojciechowski Henryk Kobryń, dr Sebastian Messal, dr hab. prof. PAN Andrzej Mierzwiński, Aleksander Ostasz, prof. Marian Rębkowski, dr hab. prof. UŁ Seweryn Rzepecki,Skład Maciej i druk Słomiński, prof. Andrzej Wyrwa, dr XPRESShab. Gerd-Helge Sp. z o.o. Vogel AdresAdres redakcjiRedakcji Muzeum Narodowe w Szczecinie Muzeum Narodowe w Szczecinie 70-561 Szczecin, ul. Staromłyńska 27 70-561 Szczecin, ul. -

Amtliche Bekanntmachung Der Gemeinde Schorfheide
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Schorfheide Bekanntmachung über die Auslegung von geänderten Planunterlagen zum Zwecke der Planfeststellung für den Neubau der Ortsumgehung B 167 Finowfurt/Eberswalde (L 220 – L 200) einschließlich der trassenfernen landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen in den Gemarkungen Eberswalde und Finow (Stadt Eberswalde), Schorfheide, Finowfurt, Groß Schönebeck, Werbellin und Lichterfelde (Gemeinde Schorfheide), Hohenfinow und Britz (Amt Britz-Chorin-Oderberg), Joachimsthal und Friedrichswalde (Amt Joachimsthal), Ruhlsdorf und Marienwerder (Amt Biesenthal-Barnim), Prenden und Zerpenschleuse (Gemeinde Wandlitz), Werneuchen (Stadt Werneuchen) im Landkreis Barnim sowie Kreuzbruch (Stadt Liebenwalde), Fürstenberg/Havel (Stadt Fürstenberg/Havel), im Landkreis Oberhavel sowie Templin (Stadt Templin), Gerswalde, Temmen und Groß Fredenwalde (Amt Gerswalde) im Landkreis Uckermark sowie Eggersdorf bei Müncheberg (Stadt Müncheberg) im Landkreis Märkisch-Oderland Der Landesbetrieb Straßenwesen (Vorhabenträger) hat für das oben genannte Bauvorhaben die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens nach § 17 FStrG, §§ 73 ff. VwVfG und § 1 VwVfGBbg am 17. August 2011 beantragt und mit Schreiben vom 29. September 2017 geänderte Planunterlagen eingereicht. Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in den o.g. Gemarkungen beansprucht. Der geänderte Plan (Zeichnungen, -
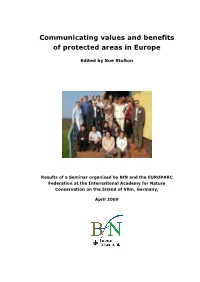
Communicating Values and Benefits of Protected Areas in Europe Vilm 2009
Communicating values and benefits of protected areas in Europe Edited by Sue Stolton Results of a Seminar organised by BfN and the EUROPARC Federation at the International Academy for Nature Conservation on the Island of Vilm, Germany, April 2009 Inhaltsverzeichnis Cover Picture: German Federal Agency for Nature Conservation Editor: Sue Stolton Equilibrium Research 47 The Quays Cumberland Road Spike Island Bristol BS1 6UQ UK Tel/Fax: +44 (0)117‐925‐5393 Mobile: +44 (0)773‐454‐1913 Email: [email protected] www.EquilibriumResearch.com Publisher: German Federal Agency for Nature Conservation International Academy for Nature Conservation Isle of Vilm 18581 Putbus / Rügen Germany Fon: +49 38301/86‐112 Fax: +49 38301/86‐150 The publisher takes no guarantee for correctness, details and completeness of statements and views in this report as well as no guarantee for respecting private rights of third parties. Views expressed in the document are those of the authors and do not necessarily represent those of the publisher. No part of the material protected by this copyright notice may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system without written permission from the copyright owner. Printed on 100% recycled paper Vilm, Germany, August 2009 2 Communicating values and benefits of protected areas in Europe Vilm 2009 Contents . 1 “Communicating values and benefits of protected areas in Europe” – A summary .................................................................................................... -

Nowa Marchia – Prowincja Za Po Mnia Na – Wspólne Korzenie
1 Wojewódzka i Miejska Bi blio te ka Publiczna Zeszyty Naukowe nr 1 Nowa Marchia – prowincja za po mnia na – wspólne korzenie Materiały z sesji na uko wych organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bi blio te kę Publiczną w Go rzo wie Wlkp. od kwietnia 2003 r. do mar ca 2004 r. Gorzów Wlkp. 2004 2 Copyright: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Gorzów Wlkp. REDAKTOR NACZELNY Edward Jaworski Sekretarz redakcji: Grażyna Kostkiewicz-Górska Korekta tekstu: Renata Ochwat Korekta bibliograficzna: Danuta Zielińska Opracowanie komputerowe: Sebastian Wróblewski Projekt okładki: Barbara Zakrzewska ISSN: 1733-1730 Na okładce: Litografia przedstawiająca widok Gorzowa (Lands ber ga) wg sztychu M. Me ria na (ok. 1650 r.) wykonana ok. poł. XIX w., zamieszczona w pracy Augusta En ge lie na i Fr. Henninga, Geschichte der Stadt Landsberg an der Warthe von den älte sten Zeiten bis auf die Gegenwart, Landsberg, 1857 Adres redakcji: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu blicz na, ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp., tel.(095) 727 70 71, fax 727 70 75 e.mail: [email protected] www.wimbp.gorzow.pl Wydawca: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. Druk i oprawa: „Familia” B. Duda Skład komputerowy: CompTec (095) 752 54 17 Nakład: 200 egz. 3 Spis treści Edward Jaworski Wstęp 5 Edward Rymar Nowa Marchia-kraina za po mnia na? Stan badań nad średniowieczem 7 Kazimierz Korpowski Zasiedlenie Ziemi Gorzowskiej po 1945 roku 35 Aleksander Ali Miśkiewicz Tatarzy Ziem Zachodnich 53 Mirosław Pecuch Przesiedleńcy w ramach -

Infrastructure, Institutions and Identity – Determinants of Regional Development Empirical Evidence from Germany
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Gäbler, Stefanie Research Report Infrastructure, institutions and identity - Determinants of regional development: Empirical evidence from Germany ifo Beiträge zur Wirtschaftsforschung, No. 91 Provided in Cooperation with: Ifo Institute – Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich Suggested Citation: Gäbler, Stefanie (2020) : Infrastructure, institutions and identity - Determinants of regional development: Empirical evidence from Germany, ifo Beiträge zur Wirtschaftsforschung, No. 91, ISBN 978-3-95942-088-4, ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, München This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/231646 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) -

V Orpommern Mecklenburg- Saxo N Y-A N H a Lt S a X O Ny Saxony Lower S Axony
ö Schloßsee r Dr k See ewitzer a See n W Torgelower a l a rn See Randow ow Neubrandenburg Tiefwaren- see Strasburg Pasewalk Fleesensee Kölpinsee Waren Penzlin Tollensesee Malchower See Burg Stargard Plauer Randow Wasserstraße See Malchow Rederang- Woldegk Lübz see Jezioro Dabie Plau Lieps Lemmersdorf Haus- Szczecin (Dammscher See) see Müritz- Eide- Specker RE3 Löcknitz Parchim See Trebenow (Stettin) Hofsee Jagow Müritz Priesterhäker See Käbelick- Göritz Brüssow see Damm- see Schönfeld Großer Fürstenwerder Carmzow Rödiner See 20 Neustadt- Zotzen- See see Dedelow Woterfitz- RB66 Glewe see Treptowsee Neustrelitz Großer Zierker See Breiter Parmensee Luzinsee Quillow Großer Schapow Ludwigsburg KrotzowerM Haussee Parmen See Useriner Ludwigslust See Massower N ü See r Feldberg a i Schönermark t t 11 Granzower i z - k Fürstenseer Weggun Prenzlau Meyenburg Möschen o n p a r See Gollmitz a l Randow 24 - Großer Carwitzer Eickstedt Labussee See Freyenstein M Woblitz- üri M tz see elle Odra Grabow G- nse H a e Schmölln ve Mirower R l- Strom K Unter- an See U al uckersee Nebel Thomsdorf Stepenitz B Wesenberg M E N Hardenbeck m a r Mescherin Gryfino E L Drewensee Tantow Gerdshagen Halenbeck C k K Mirow r Petershagen Putlitz N Rätzsee k Boitzenburg Haussee (Greifenhagen) Berge Wulfersdorf r R Zotzensee Großer e Wartin Groß E Retzow a Lützlow Piepertsee Luckow Gartz Rohlsdorf Groß rinsee Warnow Pirow M Wurlsee er Küst p k Potzlow Schwarzer Gr. Blankenburg RB74 Berlinchen See (Oder) Dosse M Thymen- V Gr. 2 RE5 r Warthesee O see n Dallmin O Radrouten Pröttlin P Baalsee R Historische Stadtkerne Kuhzer See Viltzsee c Hohenselchow 19 Labussee Lychen u Haßleben Dranse Großmenow e Großer Garlin t Potzlowsee Gramzow Dranser Labussee Ravensbrück Gr.