Ölmühle Arnstein Von Günther Liepert
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
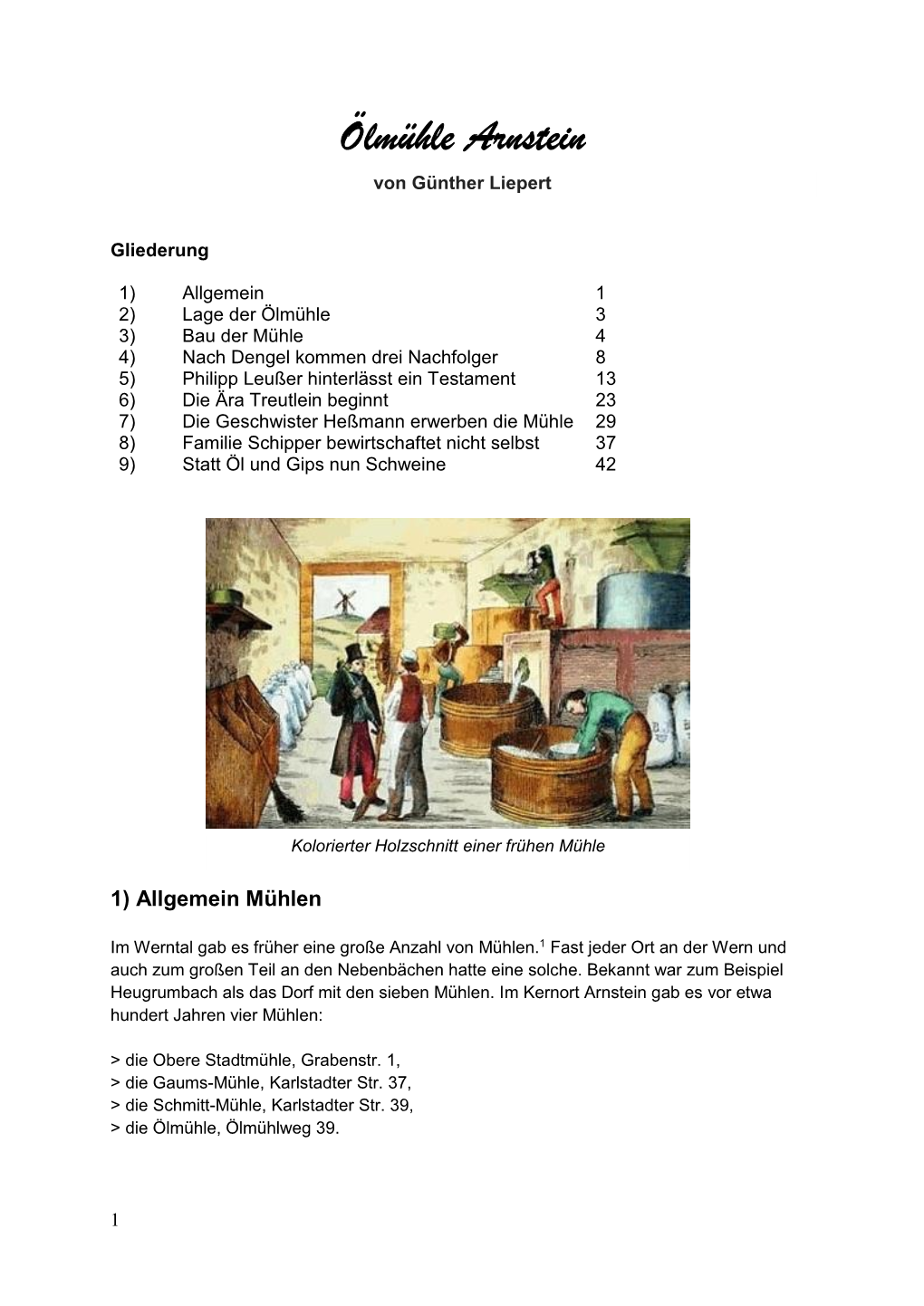
Load more
Recommended publications
-

Festrede Zum Festakt Anlässlich Des 175- Jährigen Bestehens Des Bezirks Unterfranken
Norbert Richard Wolf Festrede zum Festakt anlässlich des 175- jährigen Bestehens des Bezirks Unterfranken Dass es nicht müßig ist, ein Jubiläum wie Doch wir wollen zunächst mit dem Anfang das heutige zu feiern, das belegt uns, dass beginnen. Und der Anfang liegt nicht, wie es der Bezirk Unterfranken bzw. seine gerade heute vielleicht scheinen mag, im Bewohner bereits Gegenstand auch Jahre 1829, sondern 26 Jahre früher. fremdsprachiger Preislyrik geworden ist: Spätestens zu Beginn des 19. Jahrhunderts war das Alte Reich am Ende. Die It's nice to be a Preuß', Französische Revolution und der it's higher to be a Bayer, Imperialismus Napoleons wirkten but it's the highest rank gewissermaßen als Katalysator und to be an Underfrank. beschleunigten auf diese Weise das Ende. Im Frieden von Lunéville wurde im Jahre Dieser Vierzeiler, der ja nicht gerade 1801 der Rhein als durchgehende Grenze unbekannt ist, geht in seinen Werturteilen zwischen Deutschland und Frankreich sehr systematisch vor: Der Dichter des festgelegt, wodurch eine Reihe von Vierzeilers stellt fest, dass es durchaus deutschen Fürstentümern linksrheinische angenehm ist, ein Preuße zu sein; ein Bayer Gebiete verlor und auf rechtsrheinische zu sein ist indes ein weitaus größeres Entschädigung drängte. In Paris und St. Hochgefühl. Und dann kommt die Petersburg wurden Pläne zu Umgestaltung überraschende Wende: Dass es das höchste Europas entworfen, wobei für Frankreich Wonnegefühl auslöst, ein Bewohner des wichtig war, dass den beiden großen jubilierenden Bezirks zu sein, überrascht mitteleuropäischen Staaten eine weitere nicht; vielmehr überrascht es, dass unser Gruppe von Staaten an die Seite gestellt Dichter den Eindruck vermittelt, dass wurde, die auf die Gunst Frankreichs Unterfranken keine Bayern seien. -

445-470 Register
Berichtigungen S. 29, Anm. 18, Z. 2: S. 17 → S. 11-59, dies S. 17 S. 37, Anm. 48, Z. 5: Achim Bonawitz → Alfred Cobbs S. 76, Anm. 285, Z. 2: Begabgung → Begabung S. 138, Anm. 17, Z. 20: eingenhändigen → eigenhändigen S. 172, Anm. 61, Z. 2: Wetteraukreis → Rheinhessen S. 241, Abs. 1, Z. 3: Schweickard → Schweikard S. 271, Anm. 125, Z. 4: Forstlehrinstitue → Forstlehrinstitute S. 274, Abs. 1, Z. 1: mit → mir S. 276, Abs. 2, Z. 2: Benz(t)el-Sternau → Ben(t)zel-Sternau S. 292, Abs. 1, Z. 2: Lehrer → als Lehrer S. 305, Anm. 93, Z. 5: Sager → Woerner S. 313, Anm. 2, Z. 6: Anm. 23 → Anm. 22 S. 367, Anm. 32, Z. 3: Steierbach → Steiermark S. 374, Anm. 14, Z. 2: Johann Friedrich → Joseph Friedrich S. 380, Anm. 53, Z. 1: Kaufmanns → Kauffmanns S. 393, Anm. 8, Z. 1: Wetteraukreis → Rheinhessen S. 430, Anm. 28: S. XXX → S. 431 445 Orts- und Personenregister Aachen: 9 150, 152-156, 158-161 f., 164-173, 182-185, 188, Aarau: 144 191-197, 200 f., 203-219, 221-224, 226-240, Abert, Joseph Friedrich: 442 278 ff., 282 ff., 287, 289, 292 f., 296 f., 299 f., Ägäis: 118 302, 304 ff., 308-313, 318 f., 321-326, 328, 330 f., Agripina → Köln 333 ff., 337-341, 343, 349-353, 355-358, 360 f., Ajaccio: 340 363, 366-372, 376, 378-387, 389, 392 ff., 396- Albini, Franz Joseph Freiherr von: 123 f., 130, 132, 405, 407-414, 418, 420-424, 426 ff., 430-444 334 f. -

Verband Bay.GV Mitteilungen 10.Indd
Mitteilungen des Verbandes bayerischer Geschichtsvereine 26 (2014) VERBAND BAYERISCHER GESCHICHTSVEREINE MITTEILUNGEN 26 (2014) Umschlagvorderseite: Waschschiff vor der Würzburger Festung. (Foto: Stadtarchiv Würzburg, Fotosammlung) Impressum Herausgeber: Verband bayerischer Geschichtsvereine e.V. Austraße 18, 83022 Rosenheim Redaktion: Bernhard Schäfer Copyright: © 2014 Verband bayerischer Geschichtsvereine e.V. Grafi k, Druck VDS VERLAGSDRUCKEREI SCHMIDT und Verlag: Nürnberger Straße 27–31, 91413 Neustadt an der Aisch Printed in Germany Der Verlag PH. C. W. Schmidt ist nicht verantwortlich für den Inhalt der Publikation und evtl. Verletzungen des Urheberrechts; er kann dafür rechtlich nicht belangt werden. Entscheidungen über Inhalt und äußeres Erscheinungsbild liegen allein beim Autor bzw. Herausgeber. ISBN 978-3-87707-948-5 Inhalt Vorwort .................................................................................................. 9 Diskussion um Karl Bosl – Eine Dokumentation ........................... 11 Manfred Treml War Karl Bosl ein „Nazi-Historiker“? (2012) .................................... 11 Manfred Treml Die „Causa Bosl“ und der Bayerische Philologenverband (2014) ..... 21 Ernst Schütz Rezension zum Buch „A Bavarian historian reinvents himself: Karl Bosl and the Third Reich“ von Benjamin Z. Kedar und Peter Herde (2012) ................................................................................. 27 Auszüge aus dem Buch „Karl Bosl. Annäherung an eine Persönlichkeit“ von Dirk Walter (2013) .............................................. -

Die Jüdische Gemeinde in Urspringen Vortrag Am 17.04.2015 in Der Synagoge in Urspringen
1 Leonhard Scherg Die jüdische Gemeinde in Urspringen Vortrag am 17.04.2015 in der Synagoge in Urspringen Bei diesem Vortrag über die jüdische Gemeinde Urspringen greife ich auf eigene Veröffentlichungen und Untersuchungen, aber auch auf die Darstellungen von Josef Hasenfuß, Baruch Z. Ophir, Falk Wiesemann, Michael Schneeberger, Herbert Schultheiß, Matthias Doerfer und auf Untersuchungen von Martin Harth zurück. Eine ausführliche Untersuchung wird von Hans Schlumberger, den manche von Ihnen als Pfarrer von Billingshausen noch kennen werden, im Juni dieses Jahres im Synagogenprojekt der evangelischen Landeskirche „Mehr als Steine …“ erscheinen. Ihm danke ich besonders dafür, dass er mir sein Manuskript vor wenigen Tagen zur Verfügung gestellt hat. Meinen Vortrag widme ich dem Gedenken an Franziska Amrehn, die von 1991 bis zu ihrem frühen Tod 2004 für den Förderkreis und für alle jüdischen Belange in Urspringen aktiv war. Urspringen liegt zentral auf der Höhe zwischen Mainviereck und Maindreieck, auf der von den Geografen Marktheidenfelder Platte, vor Ort als Fränkische Platte bezeichnetem Teil der Mainfränkischen Plattenlandschaft und auf halbem Weg zwischen den alten Amtsorten Rothenfels und Karlstadt. Urspringen feiert mit Bezug auf die ausgegangene Ortschaft Grünfeld in diesem Jahr sein 1000-jähriges Jubiläum. Urspringen kam Ende des 13./ Anfang des 14. Jahrhunderts in den Besitz der Grafen von Castell, die es zum Ende des 14. Jahrhunderts u.a. den Voit von Rieneck zu Lehen gaben, die ursprünglich Dienstmannen der Grafen von Rieneck waren und zu dieser Zeit in unserem Raum großen Einfluss ausübten. Im 15. Jahrhundert waren Urspringen und das dort errichtete Schloss zwischen zwei Linien der Voite aufgeteilt, was zu oft schwierigen Verhältnissen führte. -

555-567 Obernburg 28.11.Indd
Die Stadtwerdung Obernburgs von Hans-Bernd Spies Im Jahre 2013 feierte Obernburg groß „700 Jahre Stadt“1 – allerdings mehr als drei Jahrzehnte zu früh. Über den Inhalt der Urkunde, auf welche sich das angebliche Jubiläum bezieht, heißt es in der 1821 von dem damals in Seligenstadt als Advokat und Notar tätigen Juristen Johann Wilhelm Christian Steiner (1785-1870)2 veröffent- lichten ältesten Darstellung zur Geschichte Obernburgs3: „ Erzbischof P e t e r von Mainz kam daher 1313 […] mit dem Collegiatstifte […] überein, daß, wenngleich Obernburg als künftige Stadt und Festung auftretten würde, demohngeachtet diejenigen Einkünfte des Collegiatstiftes, welche dieses von Leibeigenschaft4 &c. beziehe, bestehen“ bleiben sollen. 1 Vgl. – dort auch das Logo zum Jubiläum mit der Beschriftung „700 Jahre Stadt 1313 OBERNBURG 2013“ abgebildet – Manfred Weiß, Mit den Bürgern ins Jubiläumsjahr. Silversternacht: Mit dem Jahreswechsel fällt bei der Stadt Obernburg der Startschuss für die 700-Jahr-Feierlichkeiten, in: Main- Echo 2012, Nr. 260 (10. November), S. 23 („Weil der Mainzer Erzbischof 1313 – also vor 700 Jahren – urkundlich seine Absicht festhalten ließ, Obernburg zur Stadt zu erheben, feiert diese nun ein großes Jubiläum. Am Beginn der Feierlichkeiten steht die Silvesternacht, die zur Jahreswende Organisatoren und Bürger in der Altstadt zusammenführen wird.“), sowie Leo Hefner, Vom Römerkastell zum Gerichtsort: Obernburg feiert Stadtrechte. Vielseitige Geschichte ist bis heute das größte Pfund für die Stadt am Main, in: Spessart. Monatszeitschrift für die Kulturlandschaft Spessart 107 (2013), August, S. 9-16, dies S. 9 („Strategisches Kalkül spielte auch eine große Rolle, als der Mainzer Erzbischof Peter von Aspelt am 23. Mai 1313 mit drei gleichlautenden Urkunden festlegte, dieses Dorf zu einer befestigten Stadt zu machen. -

Correspondenz-Blatt Des Zoologisch-Mineralogischen
^0rr^fp0n>en3 -platt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensliiirg. Nr. 7. 7, Jahrgang. 1853. Versuch einer Aufzählung der Fische des Iffain-Crebietes von Prof. Dr. Leibleln in Würzburg. Für die höheren Thierklassen der Säugethiere und Vögel der bayerischen Fauna wurden, mit gebührender Berüclisichtigung früherer schätzbarer Bearbeitungen, in der neueren Zeit durch die Bemühungen von Prof. Dr. A. Wagner, Gemminger und Fahrer, von der Mühle, Pfarrverweser Jacke 1, Dr. Ehr- hard und Andern, mit Unterstützung verschiedener Correspon- denten, sehr fleissig Materialien gesammelt und gesichtet und zum Theil das Resultat ihrer Forschungen im Gorrespondenz- Blalte des zoologisch- mineralogischen Vereins in Regensburg veröfTentlichl. Der physikalisch - medicinischen Gesellschaft zu Wiirzburg, die sich nebst Hebung der gesammten Medicin und Naturkunde auch die naturhistorische Erforschung von Franken zur Aufgabe macht, habe ich zunächst für den unterfränkisch- aschaffenburger Bezirk Bayerns zum Theil auch schon über ver- schiedene Thier- Abtheilungen specielle Berichte erstattet und setze dieselben noch fort. Die Reptilien der bayerischen Fauna sind auch so ziemlich erforscht. Ueber die Fische in den Ge- wässern um Regensburg besitzen wir ferner von Prof. Dr. Fürn- rohr eine neuere sehr interessante Zusammenstellunji (publicirt als ein Programm im Jahre 1847) und es ist sehr wünschens- werlh, dass dieselbe noch auf das ganze Donau-Gebiet in Bayern sich erstrecken möge. Um nun auch für die Fisch- Fauna des 7 ,•• • (.'- .. »1 T . , f au r. Main-Gebietes einen Anhaltspunkt zu gewähren, erlaube ich mir nachstehend ein Verzeichniss der mir davon bis jetzt bekannt gewordenen Fische milzutheilen, mit dem Ersuchen an die vater- ländischen Naturforscher, diesen Thieren in den verschiedenen Gegenden dieses Gebietes ihre Aufmerksamkeit widmen, sowie Nachträge und ßerichtijjungen in diesen Blättern niederlegen zu wollen. -

MITTEILUNGEN Aus Dem Stadt- Und Stiftsarchiv Aschaffenburg ISSN 0174-5328 Bd
MITTEILUNGEN aus dem Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg ISSN 0174-5328 Bd. 2 (1987-1989) ---- • . -L ---=-- • ..:=. lli - ___-:::::::::=-- �--.......-=-·· - - -:-._..... - - -�· --�- .1' 11 Haupteingang Schönborner Hof �.. --·"' - " 1-d;:� (Zeichnung: Rainer Erzgraber, Aschaffenburg) Inhalt Gerrit Walther, ,, Was ich will, ist absolute Freiheit". Zum 100. Geburtstag Julius Maria Beckers präsentiert das Stadt- und Stiftsarchiv die erste umfassende Ausstellung zu Leben und Werk des Aschaffenburger Dichters . 3 Hans-Bernd Spies, Wann wurde die Kapelle im alten Aschaffenburger Schloß geweiht? . 14 Werner Krämer, König Ludwig 1. von Bayern - Freund und Förderer Aschaffenburgs . · 18 Brigitte Schad, Zur Wiederentdeckung der Entwürfe Sophie Brentanos für ein Denkmal ihres Großonkels Giemens . 24 Renate Welsch und Helmut Reiserth, Das Jahr 1986 im Presse- spiegel . 32 Arno Störkel, Die Aschaffenburger Bürgerwehr 1806/9 . 41 Werner Krämer, Die Landwirtschaftsfeste in Aschaffenburg . 47 Hans-Bernd Spies, Die Unterstützung der Stadt Wunsiedel nach dem Brand von 1834 durch das bayerische Untermaingebiet . 55 Garsten Pollnick, Die Aschaffenburger Protestanten oder eine Minder- heit plant ihren Kirchenbau. 1837 - vor 150 Jahren erfolgte die Grundsteinlegung für ein eigenes Gotteshaus . 60 Hans-Bernd Spies, Eine Eichendorff-Parodie - erstmals 1960 auf der Tagung der Gruppe 47 in Aschaffenburg vorgetragen . 69 Renate Welsch und Helmut Reiserth, Das erste Halbjahr 1987 im Pressespiegel . 76 Hans-Bernd Spies, Ergänzendes zur Biografie des Aschaffenburger Schloßbaumeisters Georg Ridinger . 81 Hans-Bernd Spies, Ein junger Norweger 1669 auf dem Weg durch den Spessart nach Italien: Hans Hansen Lilienskiold . 90 Werner Krämer, Das Hungerjahr 1817 in Aschaffenburg . 94 Garsten Pollnick, Vom „hohen Geist ächter Nationalität" - Verfassung und Gemeindeedikt Bayerns von 1818 . 97 Werner Krämer, Das Österreicher Denkmal. Vor 120 Jahre:1 feierliche Enthüllung und Übergabe an die Stadt Aschaffenburg 103 Martin Goes, Die Familie des Lujo Brentano . -

Chronologie Zur Geschichte Der Regierung Von
Chronologische Informationen zur Verwaltungsgeschichte in Unterfranken Die wichtigsten Jahrgangsereignisse zur Geschichte der Regierung im Bayerischen Verwaltungssystem von 1799 bis 2015 chronologisch : Die Zeit des Wirkens des Grafen Montgelas 1799-1817: Wirken des Grafen Montgelas (leitender Minister) unter König Maximilian I. Josef bis zur Entlassung unter König Ludwig I.: Verwaltungsmäßiger Umbau Bayerns zu einem einheitlichen aufgeklärten modernen Staat. Trennung von Verwaltung und Justiz bei den Mittelbehörden. 1799 bis 1808: Umbau des Kabinettsystems zu einem nach dem Ressortprinzip geordnetem Staatsministerium. Zunächst 4 Ministerialdepartements (Auswärtige Angelegenheiten, Finanzen, Justiz, geistliche Angelegenheiten). 1808 kam das Ministerialdepartment „Kriegswesen“ dazu. 1799: Einrichtung der ersten Landesdirektionen als Mittelinstanz (Vorläufer der späteren Regierungen), zunächst in Neuburg a. d. Donau (Herzogtum Neuburg), Amberg (für die Oberpfalz, Herzogtum Sulzbach und Landgrafschaft Leuchtenberg). Die Landesdirektionen führten die Aufsicht über die Landgerichte. 1801: Im Frieden von Luneville am 9. Februar 1801 war die Aufhebung der geistlichen Fürstentümer beschlossen worden. Das Hochstift Würzburg , die fränkischen Abteien und Reichsstädte erhielt Kurfürst Maximilian IV. Joseph von Pfalz-Bayern als Entschädigung für seine an Frankreich abgetretenen linksrheinischen Gebiete. 1803: Im April 1803 wurden auch in Bamberg und Würzburg zentrale Provinzialbehörden – Landesdirektionen – eingerichtet, die ab 1804 unter der Aufsicht -

MITTEILUNGEN Aus Dem Stadt- Und Stiftsarchiv Aschaffenburg
MITTEILUNGEN aus dem Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg ISSN 0174-5328 Bd. 2, Heft 2 September 1987 ::=-- --- - -·-· ·- 1 .L • ·_;:;!.. -iii'C'"..:,:.._- -=:::,-_ - - .:. _-,._·-:..... ( -�::--� -· __ ;:--·--::.----- 1 - -:· ,,,.,,,,,i!i Haupteingang Schönborner Hof ......., .. ,, �;:: (Zeichnung: R�iner Erzgraber, Aschaffenburg) Inhalt Arno Störkel, Die Aschaffenburger Bürgerwehr 1806/9 . 41 Werner Krämer, Die Landwirtschaftsfeste in Aschaffenburg . 47 Hans-Bernd Spies, Die Unterstützung der Stadt Wunsiedel nach dem Brand von 1834 durch das bayerische Untermaingebiet . 55 Garsten Pollnick, Die Aschaffenburger Protestanten oder eine Minder- heit plant ihren Kirchenbau. 1837 - vor 150 Jahren erfolgte die Grundsteinlegung für ein eigenes Gotteshaus . 60 Hans-Bernd Spies, Eine Eichendorff-Parodie - erstmals 1960 auf der Tagung der Gruppe 47 in Aschaffenburg vorgetragen . 69 Renate Welsch und Helmut Reiserth, Das erste Halbjahr 1987 im Pres- sespiegel . 76 Mitarbeiterverzeichnis Werner Krämer, Deutsche Str. 59, 8750 Aschaffenburg Garsten Pollnick, Eichelwiese 10, 8751 Haibach Helmut Reiserth, Dalbergstr. 66, 8750 Aschaffenburg Dr. phil. Hans-Bernd Spies, M. A., Wermbachstr. 15, 8750 Aschaffenburg Arno Störkel, Ebertsklinge 31a, 8700 Würzburg Renate Welsch, Schränksweg 2, 8752 Kleinostheim Mitteilungen aus dem Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg im Auftrag der Stadt Aschaffenburg - Stadt- und Stiftsarchiv - herausgegeben von Hans-Bernd Spies Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg Wermbachstr. 15, D-8750 Aschaffenburg Druck: Verlagsdruckerei Schmidt GmbH, 8530 Neustadt an der Aisch Lithos: Thomaier und Ullrich, 8750 Aschaffenburg Tage der offenenTür im Stadt- und Stiftsarchiv Das Stadt- und Stiftearchiv lädt alle geschichtsinteressierten Bürger ein, an den Tagen der offenen Tür, die von der Stadt Aschaffenburg im Turnus von zwei Jahren veranstaltet werden, am 17. und 18. Oktober 1987 in den Schönborner Hof· zu kommen. PR OGRAMM An beiden Tagen 10.00 - 16,oo Uhr Aschaffenburger Raritätenbörse - Bücher, Postkarten, Briefpapier. -

Land Enclosure and Bavarian State Centralization (1779-1835)
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 7-1-2020 Reshaping an Earthly Paradise: Land Enclosure and Bavarian State Centralization (1779-1835) Gregory DeVoe Tomlinson Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the European History Commons, and the Social History Commons Recommended Citation Tomlinson, Gregory DeVoe, "Reshaping an Earthly Paradise: Land Enclosure and Bavarian State Centralization (1779-1835)" (2020). LSU Doctoral Dissertations. 5308. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/5308 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. RESHAPING AN EARTHLY PARADISE: LAND ENCLOSURE AND BAVARIAN STATE CENTRALIZATION (1779-1835) A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of History by Gregory DeVoe Tomlinson B.A., San José State University, 2009 M.A., San José State University, 2012 August 2020 Acknowledgments The Central European History Society (CEHS) funded a visit to the Bayerisches Haupstaatsarchiv and Staatsarchiv München in the summer of 2016. Further support came from the LSU history department and the generous contributions of members of the LSU Osher Lifelong Learning Institute (OLLI) for a subsequent visit in the summer of 2018. The staffs of the Bayerisches Haupstaatsarchiv and Staatsarchiv München are extremely dedicated, professional, and were more than helpful with their assistance. -

Stadtoberhäupter Bürgermeister Und Oberbürgermeister in Aschaffenburg
Stadtoberhäupter Bürgermeister und Oberbürgermeister in Aschaffenburg Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg Sonderpublikationen herausgegeben von Joachim Kemper Stadtoberhäupter Bürgermeister und Oberbürgermeister in Aschaffenburg Überarbeitete und ergänzte Neuauflage von: Carsten Pollnick, Aschaffenburger Stadtoberhäupter von 1818 bis 1983 (Würzburg 1983) Autoren: Carsten Pollnick und Susanne von Mach. Unter Mitarbeit von Burkard Fleckenstein, Heike Görgen, Joachim Kemper, Bernhard Keßler, Matthias Klotz, Ulrike Klotz und Christian Patalong Aschaffenburg 2020 herausgegeben durch das Stadt- und Stiftsarchiv im Auftrag der Stadt Aschaffenburg Das vorliegende Buch basiert auf der 1983 erschienenen Publikation „Aschaffenburger Stadtoberhäupter von 1818 bis 1983“ (Autor: Carsten Pollnick). Seither sind fast 40 Jahre vergangen, so dass auch angesichts des im Frühjahr 2020 anstehenden Amtswechsels eine erweiterte und umfassend ergänzte Neuauflage angeraten schien. Für die Neuauflage sind die Beiträge des früheren Bandes durchgesehen und leicht überarbeitet wor- den. Der Dank geht dafür an Matthias Klotz. Für Ergänzungen sei auch Carsten Pollnick herzlich gedankt. Der Beitrag zu Oberbürgermeister Willi Reiland ist im Vergleich zum Stand von 1983 vollständig aktualisiert worden. Hierfür, für die Einführung zur Neuauflage sowie für den Text zu Oberbürgermeister Klaus Herzog sei Susanne von Mach als Autorin gedankt. Kürzere Vorlagen und Textbausteine zu den Beiträgen Reiland und Herzog ha- ben außerdem folgende Personen verfügbar gemacht: Burkard Fleckenstein, Joachim Kemper, Bernhard Keß- ler, Matthias Klotz, Ulrike Klotz und Christian Patalong. Gedankt für die Unterstützung sei auch dem Main-Echo (Archiv) sowie diversen Ämtern und Dienststellen der Stadtverwaltung Aschaffenburg. Die Verlagsdruckerei Schmidt hat neben Layout und Druck auch für die Digitalisierung und OCR-Erfassung der Publikation aus dem Jahr 1983 gesorgt. Titelbild (Umschlag): Schloss Johannisburg samt Mainbrücke, historische Aufnahme ca. -

1972 - 2012 1972 - 2012 40 Jahre Landkreis Würzburg Festschrift Rieden
1972 - 2012 1972 - 2012 40 Jahre Landkreis Würzburg Festschrift Rieden Gramschatz Hausen Inhalt Opferbaum Fährbrück Erbshausen- Sulzwiesen Bergtheim Dipbach Landrat Eberhard Nuß Ober- Hilpertshausen Eisenheim Rupprechtshausen Auf der Suche nach dem „Landkreis-Feeling“ 6 Thüngersheim Oberpleichfeld Unter- Güntersleben Burggrumbach Püssenheim Unter- Grußwort des Bayerischen Ministerpräsidenten 18 Leinach Unterpleichfeld Ober- Seligenstadt Prosselsheim Rimpar Erlabrunn Mühlhausen Gadheim Maidbronn Christian Will, MdL a.D. Kürnach Margetshöchheim Veitshöchheim Estenfeld Der Landkreis Würzburg von der Distriktgemeinde 1852 zum Landkreis 2012 20 Greußenheim Zell a. Main Rothof WÜRZBURG Grußwort des Regierungspräsidenten von Unterfranken 46 Remlingen Hettstadt Roßbrunn Rottendorf Waldbüttelbrunn Holzkirchen Uettingen Höchberg Grußwort des Bezirkstagspräsidenten von Unterfranken 48 Mädelhofen Gerbrunn Wüstenzell Eisingen Helmstadt Randersacker Peter Wesselowsky Holzkirchhausen Waldbrunn Zur Geschichte des Altlandkreises Ochsenfurt 50 Theilheim Kist Lindelbach Neubrunn Ober- Altertheim Reichenberg Wappenkunde: Kleine Geschichte der Heraldik 56 Unter- Limbachshof Eibelstadt Böttigheim Lindflur Steinbach Uengershausen Winterhausen Erlach Grußwort des Präsidenten des Bayerischen Landkreistags 60 Kleinrinderfeld Sommerhausen Fuchsstadt Zeubelried Albertshausen Geroldshausen Klingholz Klein- Gossmannsdorf Archivalien zur Geschichte des Landkreises 62 Moos ochsenfurt Frickenhausen Eßfeld Darstadt Ingolstadt Hohestadt Ochsenfurt Der Landkreis Würzburg