Der Heilige Victor Von Tomils
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
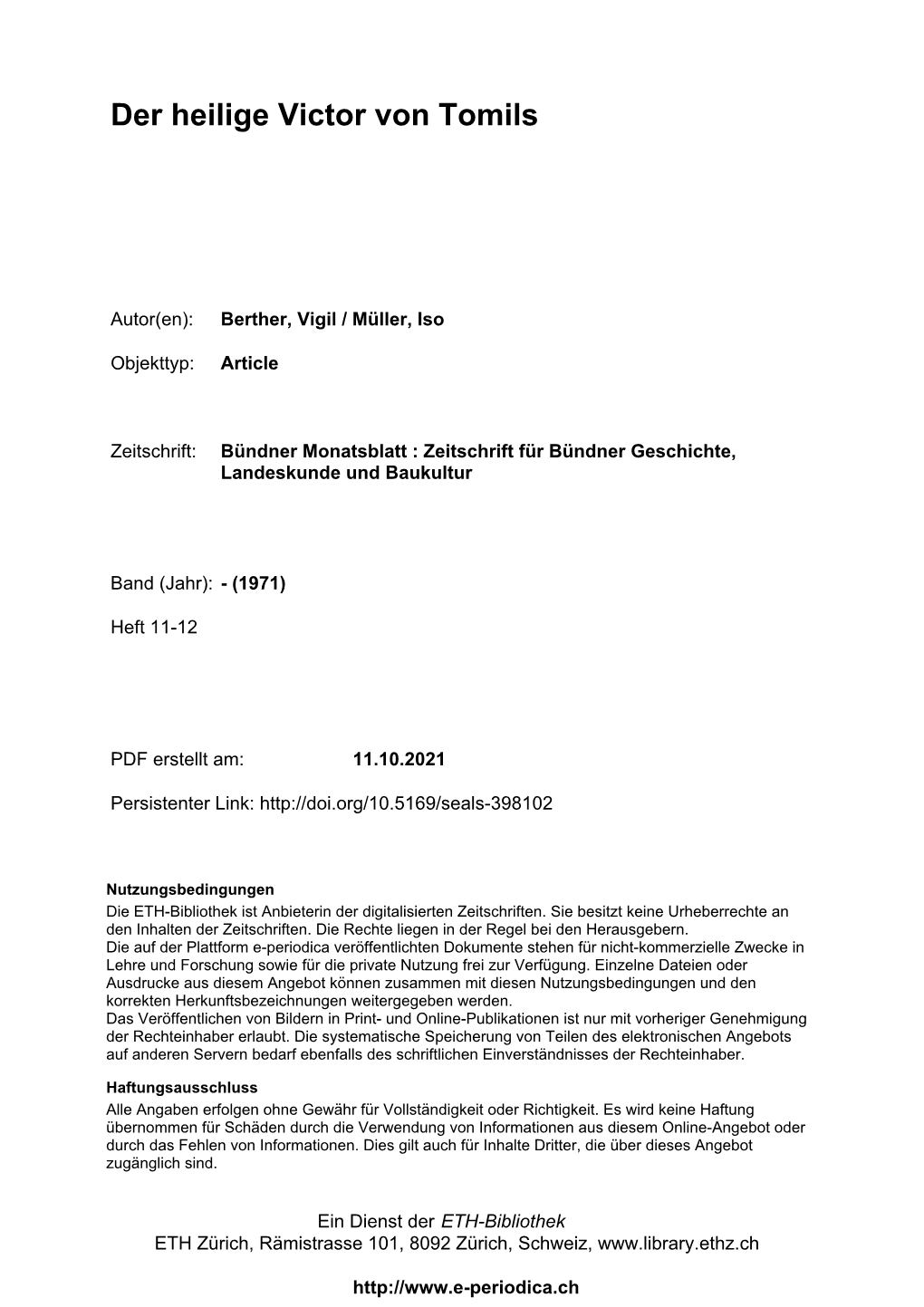
Load more
Recommended publications
-

7. Domleschger-Lauf 7. Walking / Nordic Walking 2. Domleschger Waffenlauf Scharans - Tomils - Scharans Sonntag, 7
7. Domleschger-Lauf 7. Walking / Nordic Walking 2. Domleschger Waffenlauf Scharans - Tomils - Scharans Sonntag, 7. Juni 2009 OFFZIELLE RANGLISTE RUNNING RG STN Name/Vorname JG Ort Zeit Abstand Damen D30, 14.2 1 5048 Züger Karin 1972 Tamins 1.05.55.0 0.0 2 5083 Trinkler Sandra 1973 Flerden 1.07.38.3 1.43.3 3 5068 Koller Judith 1976 Rorschach 1.18.27.6 12.32.6 4 5087 Wieland Bea 1972 Summaprada 1.28.08.8 22.13.8 5 212 Exer Andrea 1975 Altstätten 1.32.40.2 26.45.2 6 5096 Battaglia Petra 1970 Fürstenaubruck 1.37.33.8 31.38.8 Damen D40, 14.2 1 214 Büri Moni 1965 Flerden 1.10.49.2 0.0 2 5088 Wilhelm Barbara 1966 Thusis 1.15.34.6 4.45.4 3 202 Luzi Jeannette 1966 Scharans 1.18.43.5 7.54.3 4 5085 Uffer Nutt Violanta 1969 Chur 1.24.44.3 13.55.1 5 5051 Dörig Silvana 1962 Gams 1.31.17.0 20.27.8 Damen D50, 14.2 1 208 Lüönd Isabella 1959 Chur 1.21.43.6 0.0 Damen D60, 14.2 1 5054 Engler Anna 1949 Bad Ragaz 1.23.02.8 0.0 Männer M20, 14.2 1 5072 Peng Claudio 1989 Zizers 56.44.3 0.0 2 5061 Herrmann Sandro 1988 Domat/Ems 1.03.36.3 6.52.0 Männer M30, 14.2 1 5063 Hugentobler Philipp 1973 Zillis 55.28.7 0.0 2 5043 Bächler Kurt 1970 Domat/Ems 56.04.6 35.9 3 215 Eilinger Michael 1974 Arnegg 58.45.7 3.17.0 4 5056 Hagmann Claudio 1972 Trin 1.03.22.5 7.53.8 5 5050 Däscher Carlo 1973 Domat/Ems 1.06.52.2 11.23.5 6 211 Exer Markus 1976 Altstätten 1.11.04.5 15.35.8 7 5064 Hunger Thomas 1977 Schwerzenbach 1.12.55.1 17.26.4 8 5058 Heinz Bino 1979 Chur 1.13.20.5 17.51.8 9 203 John Peter 1971 Ilanz 1.32.35.1 37.06.4 10 5073 Perlmutter Thomas 1970 Thusis 1.34.01.0 38.32.3 -

Domleschg | Elexikon | Geographie
eLexikon Bewährtes Wissen in aktueller Form Domleschg | Geographie - Schweiz - Kantone Internet: https://peter-hug.ch/lexikon/domleschg/41_0646 MainSeite 41.646 Domleschg 4 Seiten, 2'371 Wörter, 16'353 Zeichen mehr Unten in der ebenen Thalsohle, aber auch hier an den Fuss der einschliessenden Bergwände geschmiegt, liegen nur Rotenbrunnen und Sils auf der rechten, Kazis und Thusis auf der linken Seite. Alle andern liegen erhöht auf sonnigen Terrassen und Berghalden. Auf der rechten Thalseite ordnen sie sich in drei Gruppen: 1) Fürstenau, Rotels und Paspels in einer untern Reihe; 2) Scharans, Almens und Tomils in einer etwas höhern Reihe am Fuss des Steilabhangs der Stätzerhornkette und 3) Trans, Scheid und Feldis in freier Bergeshöhe über diesem Steilabhang. Der Heinzenberg hat weder einen Steilabhang, noch eine darunter sich ausbreitende Terrassenlandschaft. Er steigt gleichmässiger in ungebrochenem Profil an. Die meisten Dörfer lagern hier in einer schönen Wiesenzone, die sich in halber Höhe zwischen einer untern und einer obern Waldzone hinzieht. Es sind von N. und S. Präz, Sarn, Portein, Flerden und Urmein. Tiefer liegen nur Tartar und Masein, höher nur Tschappina, mit 1585 m (bei der Kirche) die höchste Ortschaft des Domleschgerthals. Die grössten dieser Orte sind Thusis mit 1281, Kazis mit 738, Sils mit 621, Scharans mit 439, Paspels mit 302, Fürstenau mit 235, Tomils mit 233, Masein mit 228 und Almens mit 217 Ew. Die anderen haben meist nur 100-200 Ew.; nur wenige übersteigen noch 200, und mehrere erreichen nicht einmal 100 Ew. Ein besonderer Schmuck des Domleschg sind seine Schlösser und Burgen, deren es nicht weniger als 16 bis 18 zählt. -

Sonntag, 20. Juni Sonntag, 27. Juni Mittwoch, 30. Juni Sonntag, 4. Juli Sonntag, 11. Juli Sonntag, 18. Juli Sonntag, 25. Juli So
Sonntag, 12. Sept. 15. So nach Trinitatis Sonntag, 10. Oktober 19.So nach Trinitatis 09.30 Uhr, Trans, Pfr. Thomas Ruf, Organistin 11.00 Uhr, Almens, Herbstfest mit Abendmahl Astrid Dietrich, Taufe Jan Tscharner und Einweihung des neuen Kirchgemeinde- 19.00 Uhr, Almens, Pfr. Thomas Ruf, Organistin zentrums, Pfr. Thomas Ruf, Organistin Franziska Christine Hedinger Staehelin Samstag, 18. Sept. Sonntag, 17. Oktober 20.So nach Trinitatis 10.00 Uhr, Scheid, Hochzeit Anna und Rico 09.30 Uhr, Trans, Hanspeter Walther, www.ekga.ch Raguth Tscharner-Wilhelm, Pfr. Thomas Ruf Musikalische Begleitung durch Zithergruppe 13.15 Uhr, Almens, Hochzeit und Taufe Familie Furrer-Sciamanna, Pfr. Roman Brugger Sonntag, 24. Oktober 21.So nach Trinitatis Gottesdienste vom 09.30 Uhr, Scheid, Pfr. Roman Brugger, 29. August – 31. Oktober Sonntag, 19. Sept. Eidg. Dank-, Buss- und Bettag Organistin Mirjam Rosner 11.00 Uhr, Tomils, ökumenischer 18:00 Uhr, Trans, Begrüssungsgottesdienst Bettagsgottesdienst mit Pfr. Peter Miksch und für die Konfirmanden 2024 Sonntag, 29. August 13.So nach Trinitatis Pfr. Thomas Ruf/nähere Angaben im pöschtli Pfrn. Constanze Broelemann 09.30 Uhr, Feldis, Pfrn. Constanze Broelemann, Musik Mirjam Rosner und Claudia Trepp Organistin Franziska Staehelin Samstag, 25. Sept. 18.00 Uhr, Scheid, Jugendgottesdienst, 14.00 Uhr, Feldis, Pfr. Thomas Ruf, Hochzeit von Sonntag, 31. Oktober 22.So nach Trinitatis Pfrn. Constanze Broelemann, Roger und Jasmin Battaglia, Taufe von Malea 09.30 Uhr, Feldis, Pfr.Thomas Ruf, Organistin Organistin Franziska Staehelin Battaglia , Pfr. Thomas Ruf Christine Hedinger Mittwoch, 1. September Sonntag, 26. Sept. 17.So nach Trinitatis Pfarrerin/Pfarrer 10:00 Uhr, Tgea Nue, Tomils, ökumenische Feier, 09.30 Uhr, Scheid, Pfrn. -

Eine Region Fördert Die Vielfältige Kulturlandschaft 25
Eine Region fördert die vielfältige Kulturlandschaft 25 Seit gut zwanzig Jahren setzen sich Landwirt- die artenreichen Fromentalwiesen. Trockenstein mau - schaft, Forst und Naturschutz gemeinsam für ern, zahlreiche Heckenreihen und Lebhäge in den die Erhaltung der Kulturlandschaft Domleschg Gebieten der ehemaligen Ackerterrassen sorgen zu- ein. Der FLS unterstützt das innovative und sätzlich für eine Strukturierung der Land schaft. langfristige Projekt seit Beginn im Jahr 1994 mit namhaften Beiträgen von über zwei Millionen In der Grundlagenstudie von 1990 zur Gründung Projekt Franken. des Fonds Landschaft Schweiz ist festgehalten, dass mit dem Fonds die «Erhaltung der regionalen, Der einzigartige Charakter des Domleschg besticht kulturellen und landschaftlichen Vielfalt» gefördert mit seiner Vielzahl an Elementen der Kulturland- werden soll. Ein weiterer Grundsatz besteht in schaft. Zahlreiche markante Kulturdenkmäler wie der «Erhaltung, Pflege oder Wiederherstellung von Burgen, Schlösser und historische Wege sind Zeu- naturnahen Kulturlandschaften oder einzelner ihrer gen der bewegten Vergangenheit des Tales, das Elemente». Ein wichtiges Prinzip ist zudem die För- an der Durchgangsstrasse zu den Alpenpässen derung der angepassten Nutzung der Land schaft, Splügen, San Bernardino und Julier liegt. Dazu bietet die auf eine langfristige Erhaltung der natürlichen das milde Klima ideale Voraussetzungen für die Ressourcen hinzielt. Das umfassende Projekt «Kultur - Landwirtschaft und eine reich gegliederte Kultur- landschaft Domleschg» zeigt die Umsetzung der ge- landschaft. Ein wichtiges Element sind die ausge- nannten Grundsätze in der Landschaft vor bildlich auf. dehnten Obstgärten, von denen die Dörfer und Schlösser seit Jahrhunderten umgeben sind. Sie Landschaftspflege durch die Landwirtschaft zeugen von der einstigen Bedeutung des Obst an- als Novum baus im Tal, als das Domleschg zu den wichtigen Der FLS unterstützt das Projekt «Kulturlandschaft Obstanbaugebieten der Schweiz zählte. -

Räumliches Leitbild Gemeinde Domleschg
Räumliches Leitbild Gemeinde Domleschg Mitwirkung & Prüfung ARE | 19. August 2019 Auftraggeber Gemeinde Domleschg Kontaktperson Werner Natter. Gemeindepräsident [email protected] Projektbearbeitung Esther Casanova Raumplanung GmbH Alexanderstrasse 38 7000 Chur Esther Casanova Grünenfelder und Partner AG Denter Tumas 6 7013 Domat/Ems Kevin Cavelti Beratendes Team Werner Natter, Gemeindepräsident Stefan Collet, Leiter Bauamt Thomas Bitter, Leiter Bauamt bis 30.06.2019 Susanna Roffler, Assistentin des Gemeindepräsidenten Peter Lehmann, Gemeindevorstand Thomas Flück, Gemeindevorstand bis 30.12.2019 Sabrina Sutter, Sekretariat Bearbeitungsstand 19. August 2019 Quellen Bilder: Eigene Aufnahmen, wo nicht anders vermerkt. Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung und Vorgehen 1.1 Anlass ....................................................................................................................................................4 1.2 Sinn und Zweck des Leitbildes ................................................................................................................4 1.3 Umsetzung des räumlichen Leitbildes .....................................................................................................5 2. Grundlagen und Rahmenbedingungen 2.1 Bund .......................................................................................................................................................6 2.2 Raumkonzept Graubünden...................................................................................................................10 -

Tomils - Scharans Sonntag, 7
7. Domleschger-Lauf 5. Walking / Nordic Walking 2. Domleschger Waffenlauf Scharans - Tomils - Scharans Sonntag, 7. Juni 2009 STARTLISTE ALPHABETISCH STN Name/Vorname JG Ort Kategorie Damen, 14.2 5096 Battaglia Petra 1970 Fürstenaubruck Damen 5047 Brasser Christine 1955 Goldach Damen 5051 Dörig Silvana 1962 Gams Damen 5054 Engler Anna 1949 Bad Ragaz Damen 5068 Koller Judith 1976 Rorschach Damen 5083 Trinkler Sandra 1973 Flerden Damen 5085 Uffer Nutt Violanta 1969 Chur Damen 5087 Wieland Bea 1972 Summaprada Damen 5088 Wilhelm Barbara 1966 Thusis Damen 5048 Züger Karin 1972 Tamins Damen Herren, 14.2 5040 Andreas Fluri 1955 Balsthal Herren 5041 Ardüser Hitsch 1969 Flerden Herren 5042 Bächler Carl 1950 Felsberg Herren 5043 Bächler Kurt 1970 Domat/Ems Herren 5044 Belet Patric 1964 Cazis Herren 5045 Bieler Norbert 1963 Bonaduz Herren 5046 Boog Michael 1976 Bad Ragaz Herren 5053 Brasser Hanspeter 1950 Untereggen Herren 5049 Brenn Marcel 1953 Winterthur Herren 5050 Däscher Carlo 1973 Domat/Ems Herren 5052 dos Santos Gomes Luis 1963 Scharans Herren 5055 Engler Walter 1951 Sennwald Herren 5099 Grass Leonhard 1968 Masein Herren 5056 Hagmann Claudio 1972 Trin Herren 5057 Heim Rolf 1968 Grabs Herren 5058 Heinz Bino 1979 Chur Herren 5059 Henni Carlo 1969 Thusis Herren 5060 Herrmann Reto 1955 Domat/Ems Herren 5061 Herrmann Sandro 1988 Domat/Ems Herren 5062 Huber Jean Piere 1951 Flims-Waldhaus Herren 5063 Hugentobler Philipp 1973 Zillis Herren 5064 Hunger Thomas 1977 Schwerzenbach Herren 5065 Kast Paul 1968 Thusis Herren 5066 Knellwolf Heinz 1958 Thusis -

Verkaufsdokumentation
Verkaufsdokumentation EXCLUSIVE LAGE IM SONNIGEM DOMLESCHG OBER-UND ATTIKAWOHUNGEN 117 m2 ECKBALKONE 36 m2 und 44 m2 AUF 1.465 m2 BAULAND 1 März 2017 Objekt Neubau Mehrfamilienhaus Ober-und Attikawohungen 4 x 4,5 Zimmerwohnungen a 117 m2 Via Begl Sura - Parzelle 4076 7418 Tomils / Gemeinde Domleschg Erstwohnung – Ausländerbewilligung Verkauf nach Plan ____________________________________________________________ Bauherrschaft Viktoria A. Aschbacher Caviezel Route de Bassins 3 1261 Le Vaud / VD ____________________________________________________________ Architekt/ Willi Cajochen AG Bauleitung Veia Tect 5 7460 Savognin Tel. 081 684 22 95 Natel 076 366 22 66 E-Mail [email protected] ____________________________________________________________ 2 März 2017 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2. Das Projekt 3. Die Lage der Parzelle 4. Ansichten der Parzelle 5. Das Dorf Tomils und die Gemeinde Domleschg 6. Die Baubeschreibung 7. Wohnungsspiegel und Preise 8. Bezugstermin 9. Verkauf und Beratung Anhang : Pläne 3 März 2017 1. Einleitung Tumegl/Tomils Staat: Schweiz Kanton: Graubünden (GR) Region: Hinterrhein Kreis: Domleschg Politische Gemeinde: Domleschg Postleitzahl: 7418 Höhe: 810 m ü. M. Fläche: 3,20 km² Einwohner: 450 (1. Januar 2017) Website: www.tomils.ch www.domleschg.com 4 März 2017 Tumegl/Tomils, links oben Schloss Ortenstein Karte 5 März 2017 2. Das Projekt Die Überbauung auf 1'465 m2 Bauland besteht aus zwei Häusern mit je 2 Wohnungen (Ober-und Attikawohungung) insgesamt 4 Wohnungen von 117m2 (brutto Wohnfläche) getrennt von einem Treppenhaus mit Lift (Rollstuhlgängig). Alle Wohnungen verfügen über Eckbalkone : - von 44 m2 (im Obergeschoss); und - von 36 m2 (Attikawohungung). Es bestehen für beide Häuser : a. eine gemeinsame interne Garage, bzw. zwei grosszügige Parkplätze von 40,5 m2 pro Wohnung; b. -

IVS GR 273 INVENTAR HISTORISCHER IVS Dokumentation Bedeutung National VERKEHRSWEGE Kanton Graubünden DER SCHWEIZ Seite 1
IVS GR 273 INVENTAR HISTORISCHER IVS Dokumentation Bedeutung National VERKEHRSWEGE Kanton Graubünden DER SCHWEIZ Seite 1 Strecke GR 273 Tomils/Mulegns - Scharans; "Obere Domleschger Landstrass" Landeskarte 1215 GESCHICHTE Stand März 1993 / JS Der Tomilser Lehrer und Lokalkenner CASTELMUR schilderte 1938 die historischen Wegverhältnisse für diese Strecke so: «Von der Brücke über das Tomilsertobel ostwärts bei den Mühlen vorbei, nach Plattas, steil über Bigliet hinauf nach Tomils. Der idyllische, landschaftlich reizvolle, beidseits von Nutzbäumen begleitete Weg am oberen Rand der Terrasse, auf welcher die in Obstbäumen versteckten Dörfer Tomils, Almens und Scharans liegen, verband und verbindet jetzt noch diese Ortschaften miteinander und vereinigte sich mit dem alten Schynweg nach Obervaz.» (81f.) Die Existenz dieses heute noch zum grössten Teil existierenden und benutzten Weges bestätigen mindestens punktuell zahlreiche Quellen. Wenn sie zum Teil von einer «Landstrass» sprechen, so ist trotzdem anzunehmen, dass die Strecke höchstens in Ausnahmefällen als überregionale Durchgangsroute diente. Auch die Tatsache, dass sie in alten Karten nicht erscheint, spricht gegen eine überregionale Kommunikationsbedeutung (vgl. GR 9). GELÄNDE Aufnahme 22. Januar 1993 / Heg Bei der «Oberen Domleschger Landstrass» handelt sich um einen mehr oder weniger durchgehend gebauten Hangweg. Die Böschungen und das Wegtrassee werden durch zahllose, meist trocken gehaltene Stützmauern aus Lese- und teilweise Bruchsteinen abgestützt. Fast über die ganze Länge wird die Strecke von Sträuchern und Bäumen begleitet. Dabei wechseln sich Hecken mit oder ohne Überständer und Obst- oder Nussbaumreihen ab. Immer wieder finden sich auch bewachsene Lesesteinwälle, freistehende Mauern oder Brüstungsmauern sowie Holzlattenzäune als Wegbegrenzung. Der Erhaltungszustand der Mauern ist unterschiedlich, von gut unter- und erhaltenen bis zu völlig zusammengefallenen Mauern ist alles zu beobachten. -

Evidence on Opting-In for Non-Citizen Voting Rights∗
Power Sharing at the Local Level: Evidence on Opting-In for Non-Citizen Voting Rights∗ Alois Stutzer† and Michaela Slotwinski‡ October 28, 2020 Accepted for publication in Constitutional Political Economy Abstract The enfranchisement of foreigners is likely one of the most controversial frontiers of insti- tutional change in developed democracies, which are experiencing an increasing number of non-citizen residents. We study the conditions under which citizens are willing to share power with non-citizens. To this end, we exploit the setting of the Swiss canton of Grisons, where municipalities are free to decide on the introduction of non-citizen voting rights at the local level (a so called opting-in regime). Consistent with the power dilution hypothe- sis, we find that enfranchisement is less likely when the share of resident foreigners is large. Moreover, municipalities with a large language/cultural minority are less likely to formally involve foreigners. In contrast, municipality mergers seem to act as an institutional catalyst, promoting democratic reforms. A supplementary panel analysis on electoral support for an opting-in regime in the canton of Zurich also backs the power dilution hypothesis, showing that a larger share of foreigners reduces support for an extension of voting rights. Keywords: non-citizen voting rights, opting-in, power sharing, democratization JEL classifications: D72, D78, J15, K16 ∗We are grateful to Jean-Thomas Arrighi, Joachim Blatter, Janine Dahinden, Johan Elkink, Eva Green, Dominik Hangartner, Ron Hayduk, Anita Manatschal, Lorenzo Piccoli, Didier Ruedin, Klaudia Wegschaider and the participants of the research seminar at the Immigration Policy Lab Zurich, the meeting of the NCCR - on the move as well as of the Max-Planck conference on citizenship for helpful comments. -

Aus Der Geschichte Der Gerichtsgemeinde Ortenstein
Aus der Geschichte der Gerichtsgemeinde Ortenstein Autor(en): Castelmur, A. Objekttyp: Article Zeitschrift: Bündnerisches Monatsblatt : Zeitschrift für bündnerische Geschichte, Landes- und Volkskunde Band (Jahr): - (1939) Heft 11 PDF erstellt am: 11.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-397027 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Chur November 1939 Nr. 11 BÜNDNERISCHES MONATSBLATT ZEITSCHRIFT FÜR BÜNDNER. GESCHICHTE, LANDES- UND VOLKSKUNDE HERAUSGEGEBEN VON DR. F. PIETH ERSCHEINT JEDEN MONAT Aus der Geschichte der Gerichtsgemeinde Ortenstein Von Andr. Castelmur, Lehrer, Tomils. I. Feudalzeit. I. Der Königshof Tomils. Die ehemalige Gerichtsgemeinde Ortenstein umfaßte das äußere Domleschg nördlich des Riedbaches mit den sieben Dörfern oder Nachbarschaften : Tomils, Paspels, Dusch, Rodels, Trans, Scheid und Feldis. -

Der Tomilser Handel
Der Tomilser Handel Autor(en): Fravi, Paul Objekttyp: Article Zeitschrift: Bündner Jahrbuch : Zeitschrift für Kunst, Kultur und Geschichte Graubündens Band (Jahr): 9 (1967) PDF erstellt am: 30.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-551095 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch an dr Gadastatt und am Feistabäärg. cl Stuba mit Goofa z fiilla. — Dia ra- mutete mit Recht eine Intrige der Es Taggsch sind sch no völlig dürr d munscha Meigga hätta ja d Valier Salis und wollte sich anläßlich eines Luchncra uss, heint z Sa Maarti es I'urschta nid emaal verstanda, wenn Streites der Gemeinden am Berg (Fei Chilchli und Hiiiischer bbuua und sch zua ne cho wäänt ge d Ret ver- dis, Scheid, Trans) und derjenigen im sind gar bis ge Zerschnaa. -

Taschenfahrplan
Domleschg 10.12.2017 bis 08.12.2018 Steter Tropfen höhlt den Stein. Echt sehenswert. 90.501 Tumegl / Tomils, Cursch iglias–Feldis / Veulden Viamala-Schlucht täglich geöffnet 90.502 Tumegl / Tomils, Cursch iglias–Trans April und Okt. 09.00 – 18.00 Uhr / Mai bis Sept. 90.511 Thusis–Rhäzüns 08.00 – 19.00 Uhr, PostAuto-Haltestelle direkt 90.512 Thusis–Mutten–Rhäzüns beim neuen Besucherzentrum 90.521 Thusis–Obermutten Kontakt Gästeinformation Viamala, +41 (0)81 650 90 30 Hü7 www.viamala.ch GR02 GR02 90.501 Tumegl/Tomils, Curschiglias–Oberscheid–Feldis/Veulden û ì Thusis, Bahnhof 90.512 R6 07 7 35 "+11 33 1256 14 56 15 56 T16 56 R16 55 20 35 Tumegl/Tomils, Curschiglias ÆR6 39 8 13 "+11 48 1313 15 13 16 13 T17 13 R17 13 20 54 Rhäzüns, Bahnhof 90.512 7 31 8 31 11 31 1231 15 31 16 31 17 31 R20 31 Tumegl/Tomils, Curschiglias Æ RR6 59 7 42 8 42 11 42 1242 15 42 16 42 17 42 R20 42 TX 3 5 105 7 9 11 59 713 13 183 6A6B Tumegl/Tomils, Curschiglias R7 00 R8 15 T8 45 U 11 49 1315 R16 00 ",17 00 T17 15 R17 45 21 00 Scheid, Resgia 7 10 8 25 8 55 11 59 1325 16 10 17 10 17 25 17 55 21 00 Oberscheid 7 14 8 29 8 59 12 03 1329 16 14 ",17 14 17 29 17 59 21 01 Feldis/Veulden, Dorfplatz 7 24 8 39 9 09 12 13 1339 16 24 17 39 18 09 21 05 Feldis/Veulden, Schulhaus R7 28 R8 43 T9 13 U 12 17 1343 R16 28 T17 43 R18 13 Thusis, Bahnhof 90.512 22 35 2355 Tumegl/Tomils, Curschiglias Æ 22 54 0 14 Rhäzüns, Bahnhof 90.512 Tumegl/Tomils, Curschiglias Æ TX TX 187 189 6A6B 6A6B Tumegl/Tomils, Curschiglias 23 00 0 15 Scheid, Resgia 23 00 0 15 Oberscheid 23 01 0 16 Feldis/Veulden, Dorfplatz 23 05 0 20 Feldis/Veulden, Schulhaus Zeichenerklärung Verkehrt nicht täglich å Halt nur zum Einsteigen Allgemeine Feiertage: R Montag – Freitag ohne allg.