Broschüre Über Die Ammer
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
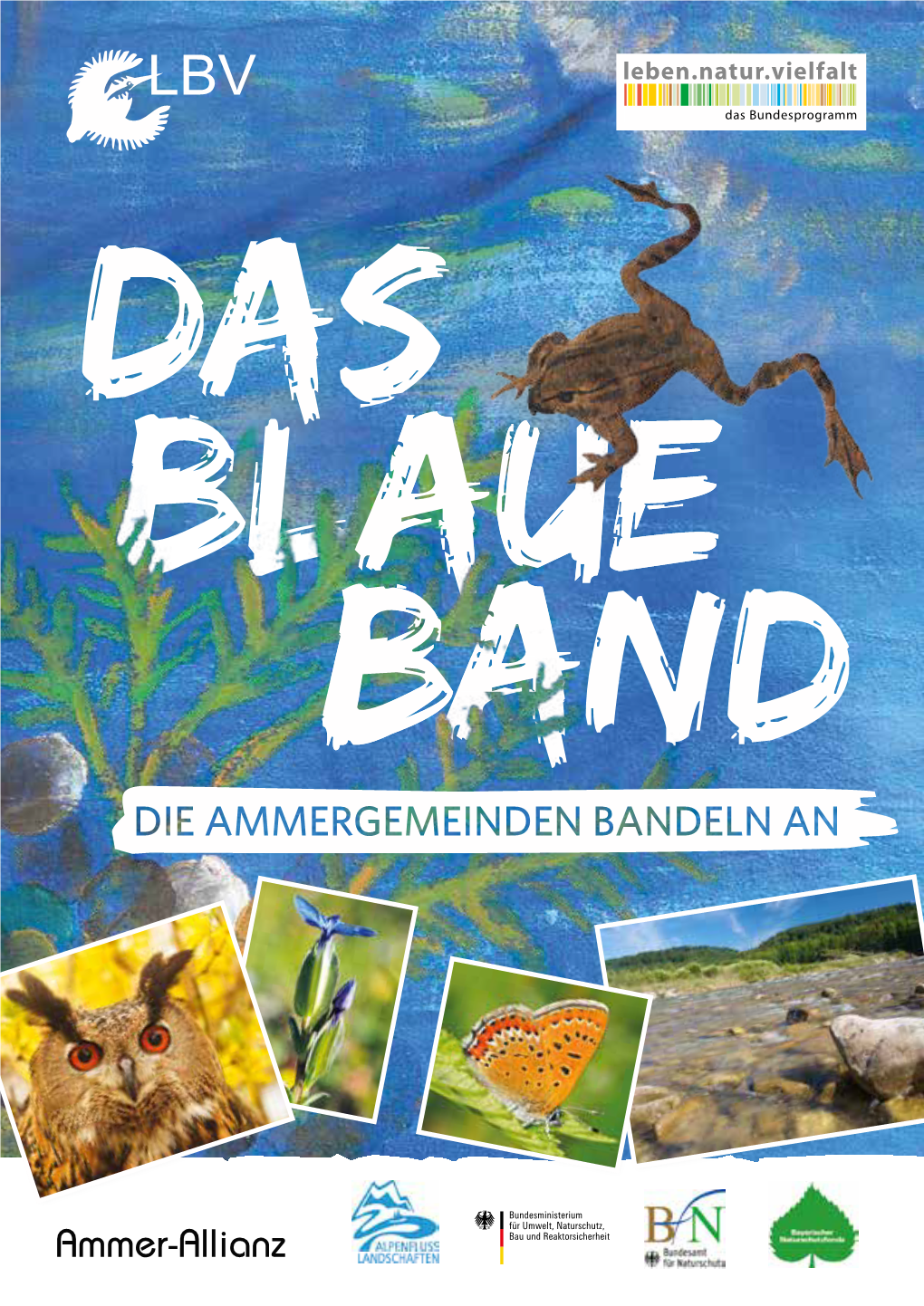
Load more
Recommended publications
-

New Concepts for the Suburban Countryside in the Growing Metropolitan Region Munich
International Master of Landscape Architecture GLONN VALLEY New Concepts for the Suburban Countryside in the growing Metropolitan Region Munich PROJECT DOCUMENTATION International Master of Landscape Architecture GLONNVALLEY New Concepts for the Suburban Countryside in the growing Metropolitan Region Munich Project Documentation IMLA - Main Project I / 1st Semester 2018 IMLA - International Master of Landscape Architecture Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences, Freising (Germany) Nürtingen-Geislingen University, Nürtingen (Germany) www.imla-campus.eu Glonnvalley (Source: Andreas Kitzberger) INTRODUCTION Prof. Fritz Auweck Frame conditions and This has very big influence on the The Glonnvalley is characterised by: student composition space because of the need of areas for • rural character The project was the task of the so-called settlements and infrastructure, the need of • long history - which is implemented in „Main Project I“, a module in the first new housing for people and possibilities of settlements, landscape and traditions semester of the master programme mobility and recreation in the landscape. • high and regional specific landscape „International Master of Landscape At the moment the planning region 14 quality in the Glonnvalley as well as in Architecture“ (IMLA) in summer semester has about 2.85 million inhabitants (2015) the neighbouring valleys 2018. and will grow until 2035 more than 12.5% • regional types of settlements and This master programme is operated (min. 3.2 million inhabitants). buildings, including farmhouses and by the Universities of Applied Sciences religious buildings Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) and Regional Plan Region 14 • renewable energy production, Nürtingen-Geislingen (HfWU). The state regional plan 14 includes the intensive agriculture and regional About 30 students from about 20 different regional state targets for the development marketing countries (from Asia, America, Middle East of the region. -

VLP21 Region.Eps
B15n Neufahrn Neufahrn i.NB. B15 Bayerbach Rottenburg a.d. Laaber Ergoldsbach b. Ergoldsb. Ergoldsbach B299 Gr.Laaber B15n r e b a a l.L K Hohenthann Pfeffenhausen Weng Goldbach 3 Schmatzhausen A9 Postau Attenhofen Schulzentrum 602 603 683 Busb ahnhof Griespl. Wörth Mainburg Gewerbegebiet Straßäcker B a.d.Isar Gewerbegebiet Auhof 2 60602-603 99 Leibersdorf B15 2-603 68683 3 Weihmichl A92 Wörth ar RnaR nachch IngolstadtIngolstadt Brunnen Is Ehekirchen Stau- R nach IngIngolstadtolstadt Nieder- r 3 see A 0 siehe Mainburg A9 Münster 1 9 Obersüß- 6001 - Start- und Paa 60602-603 Altenhausen Gmain Brunnen Rohrbach Puttenhausen Essenbach Wies Anzinger 6 Landebahn Nord Pörnbach 2-6 aichbach 69 51512 A93 Passau 2 A92 3463635 0 Waldsiedlung Main 0 1 km 83 60601-617-618 2-603 Volkenschwand Siedlung 512 6602-603 6683 bach 1 Reith h 5- 635 er 2 ner Str ner 5 n traubing 1-617 Str Rohrbach H 6004 sac Langen- 635-69163 burg o SStraubing be Kurt-Kittel-Ring reising Isar ain Galgenbach- 617 Rudelzhausen o Term inal 2 A93 R nach Plattling/ a 445-44 - Mauka F Wolnzach Berg 446 601 1 Wettersteinring 446 nde M see li w mosen Brief- 617 dlfi Parkplatz P41/ 469 n. FFreising ben P41 A Terminal A/B Hebrontshausen B299 2 Rotkreuzstr. Str er Hallenbad ra Nordallee 00 512 635 -618 er Str ch Holzheim zentrum Nord Freisinger Forst s z. Flughafen g Novotel 3 603 Ergolding nger Str S B 3 Düwellstr. u 663535 MAC Terminal 2 Attenhofen Hofen au Hohen Neufahrn 1 692 P51 Aussichts- Kirchdorf Furth Stau- Wald- h 69691 Freisinger Allee 603 68683 v v ach eg hügel B Schulzentrum Grafendorf A92 v br chw P41 3 see Eichenfeld- 620 E 602 603 683 5 v v ba Verkehrslinienplan Region 620 friedhof Echsheim 690 691 692 algen HohenwartFlughafen Hohenwart R nach Regensburg/ Kleine Wies Kar- v Angermaierstr. -

Isar Stand: 2016
Bayerisches Landesamt für Umwelt Gewässerverzeichnis Bayern Verzeichnis der Bach- und Flussgebiete in Bayern Flussgebiet Isar Stand: 2016 Durch Klicken auf unterstrichene Gebietsbezeichnungen wird der Kartendienst an der entsprechenden Stelle geöffnet! zurück zur Übersicht Einzugsgebiete Hauptgewässer im Einzugsgebiet Kennzahl- Gebiets- Gebietsbezeichnung Größe in Größe Gesamt- Gewässer- Gewässer Länge* in Länge* Länge* Gesamt- stufe kennzahl Bayern außerhalb größe (km²) kennzahl Bayern auf bayer. außerhalb länge* (km²) Bayerns (km) Grenze Bayerns (km) (km²) (km) (km) 2 16 Isar 7982,19 982,38 8964,57 16 Isar 270,36 0 21,91 292,26 3 161 Isar von Quelle bis Loisach 798,34 825,94 1624,27 16 Isar 94,37 0 21,91 116,28 4 1611 Isar von Quelle bis Leutasch 12,70 272,53 285,23 16 Isar 4,22 0 21,91 26,12 5 16111 Isar von Quelle bis Isarverzweigung 2,66 270,88 273,55 16 Isar 2,25 0 22 24,16 (Sulzleklamm) 6 161112 Marchklamm 0,26 0,21 0,46 161112 Marchklamm 0,28 1,76 0,08 2,12 6 161119 Isar von Marchklamm bis GEWKZ 16112 2,40 0,03 2,43 16 Isar 2,21 0 0 2,21 5 16112 Isarverzweigung (Sulzleklamm) 2,35 0 2,35 16112 Isarverzweigung 3,05 0 0 3,05 (Sulzleklamm) 6 161121 NN von Quelle bis GEWKZ 161122 0,66 0 0,66 16112 NN 1,11 0 0 1,11 * Länge des gesamten Gewässerlaufes innerhalb des relevanten oberirdischen Einzugsgebietes. Ein Gewässerlauf kann Abschnitte mit verschiedenen Gewässernamen, Abschnitte ohne Namen und Seenachsen enthalten Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg, www.lfu.bayern.de 1 von 117 Seiten Einzugsgebiete Hauptgewässer im Einzugsgebiet Kennzahl- Gebiets- Gebietsbezeichnung Größe in Größe Gesamt- Gewässer- Gewässer Länge* in Länge* Länge* Gesamt- stufe kennzahl Bayern außerhalb größe (km²) kennzahl Bayern auf bayer. -

Flächennutzungsplan Stadt Weilheim I. OB, Landkreis Weilheim-Schongau
Flächennutzungsplan Stadt Weilheim i. OB, Landkreis Weilheim-Schongau - Begründung zum Flächennutzungsplan einschließlich Umweltbericht - - Stand 29.02.2012 - Stadt Weilheim i. OB Planungsbüro U-Plan Admiral-Hipper-Straße 20 Mooseurach 16 82362 Weilheim i. OB 82549 Königsdorf Tel. 0881/682-0 Tel. 08179/925540 Fax 0881/682-123 Fax 08179/925545 Email: [email protected] Email: [email protected] Internet: www.weilheim.de Internet: www.buero-u-plan.de A. ANLASS UND ERFORDERNIS DER PLANUNG 6 1. Einleitung 6 1.1 Planungsanlass 6 1.2 Rechtliche Grundlagen, Aufgaben und Ziele 6 1.2.1 Flächennutzungsplan 6 1.2.2 Landschaftsplan 7 1.2.3 Umweltbericht 8 1.3 Planwerk und Plangrundlage 8 1.4 Planungszeitraum 8 B. RAHMENBEDINGUNGEN UND PLANUNGSVORGABEN 9 1. Übergeordnete Planungen 9 1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 2006 (LEP) 9 1.2 Regionalplan Oberland 10 1.3 Arten- und Biotopschutzprogramm, Artenschutzkartierung 12 1.4 Waldfunktionsplan 12 1.5 Agrarleitplan (ALP) / Landwirtschaftliche Standortkartierung (LSK) 13 2. Kommunale Planungen 15 2.1 Leitbild der Stadt Weilheim i. OB 15 2.2 Sanierungsgebiete 15 2.3 Dorferneuerung 16 2.4 Planungen zum Hochwasserschutz 16 2.5 Pflege- und Entwicklungsplanungen 18 C. BESCHREIBUNG DES GEMEINDEGEBIETES 19 1. Lage im Raum 19 2. Geschichtliche Entwicklung 20 3. Flächennutzung, Wirtschafts- und Bevölkerungsstruktur 21 4. Bevölkerung 22 4.1 Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Weilheim i. OB 22 4.1.1 Natürliche Bevölkerungsentwicklung 23 4.1.2 Bevölkerungsentwicklung aufgrund von Zu- und Wegzug 23 4.2 Bevölkerung in Weilheim und in den Teilgemeinden 24 4.3 Bevölkerungsentwicklung im Vergleich mit dem Landkreis Weilheim- Schongau 24 4.4 Die Altersstruktur im Plangebiet 25 5. -

Regierungsbezirk Oberbayern
Anlage 1 43. Bayerisches Jahreskrankenhausbauprogramm 2017 2.1 Förderung der Errichtung von Krankenhäusern (Umbau einschließlich Sanierung, Erweiterungsbau, Neubau) Lfd. Maßnahme Träger Förderfähige Vorge- Voraus- Bemerkung Nr. Kosten sehene sichtlich Förderleis- noch aufzu- tung im bringender Haushalts- Betrag jahr 2017 2018 ff. Kosten- Mio. € stand Mio. € Mio. € 1 2 3 4 5 6 7 8 Regierungsbezirk Oberbayern 1 Klinikum Ingolstadt Klinikum Ingolstadt GmbH 66,99 01/14 8,33 26,66 - Bauabschnitt 1 (Neustrukturierung / Anpassung Westteil Behandlungsbau mit OP-Abteilung) - 2 Klinikum Schwabing, München Städtisches Klinikum 84,00 01/15 10,36 72,67 nfB, KHStrF - Neustrukturierung mit Konzentration der Versorgung München GmbH auf das südöstliche Krankenhausareal - 3 Klinikum Harlaching, München Städtisches Klinikum 74,49 11/10 -- 74,49 nfB, - Ersatzneubau, Bauabschnitt 1 (zentrale Funktions- München GmbH Teilförderung, bereiche und Teilbereich Pflege) - BK: 89,97 Mio. € 4 Klinikum Neuperlach, München Städtisches Klinikum 10,00 03/16 2,86 7,14 NA, nfB, - Errichtung Zentrallabor - München GmbH Teilförderung, BK: 13,79 Mio. € 5 HELIOS Klinikum München West Kliniken München Pasing u. 5,38 11/11 2,44 1,79 - Sanierung, Bauabschnitt 7 (insb. Verbindungs- Perlach GmbH bauwerke sowie Entbindungs- u. Wöchnerinnen- bereich) - 6 Schön Klinik München Harlaching Schön Klinik München Harlaching 11,12 11/12 2,92 0,55 - Umstrukturierung OP- u. Intensivbereich - SE & Co. KG 7 Klinikum Dritter Orden, München-Nymphenburg Kliniken Dritter Orden gGmbH 23,64 03/15 3,03 16,41 - Erweiterung u. Strukturverbesserung, Bau- abschnitt 4b (insb. Erweiterung OP-Bereich) - 8 Krankenhaus Barmherzige Brüder, München Barmherzige Brüder gemein- 16,90 11/15 5,75 11,15 NA - Anpassungs- u. -

S-Bahn, U-Bahn, Regionalzug, Regionalbus Und Expressbus Im
S-Bahn, U-Bahn, Regionalzug, Regionalbus und ExpressBus im MVV Suburban trains, underground, regional trains, regional buses and express buses in MVV network Partner im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund RE 1 Ingolstadt, Nürnberg | RB 16 Treuchtlingen, Nürnberg Puttenhausen Mainburg (683) 602 603 683 Osterwaal Rudelzhausen Margarethenried Gammelsdorf Schweitenkirchen 617 603 Hebronts- Grafen- Hörgerts- (501) Nieder-/ Niernsdorf Letten Grünberg 683 683 hausen dorf hausen Mauern 602 Weitenwinterried Oberdorf Unter-/ Ruderts-/Osselts-/ 603 683 Ober- (601) (706) Mitter- Ober-/Unter- Günzenhausen Pfettrach (Wang) Burgharting Volkersdorf/ Steinkirchen mar- marbach wohlbach Deutldorf Paunzhausen (707) Au (i. Hallertau) Tegernbach (683) Dickarting Sulding 707 707 Priel (PAF) bach 616 Zieglberg Froschbach Arnberg/ Lauter- 5621 Schernbuch Abens Neuhub Reichertshausen/ St. Alban (5621) 616 Haag bach Tandern Hilgerts- (707) Schlipps/ (617) Hausmehring (561) (704) Hettenkirchen hausen Jetzendorf Eglhausen Sillertshausen Moosburg 501 Arndorf (619) Randelsried 729 Aiterbach Nörting 617 601 (561) 707 Göpperts- Sünz- Attenkirchen Nandlstadt Starzell Neuried hausen Unter-/ Gütlsdorf (680) Schröding Thalhausen Asbach (Altom.) (619) Oberallers- 601 hausen Thalham/ Pottenau Loiting RB 33 Landshut Peters- Oberhaindlfing Oberappersdorf Kirchamper (5621) (616) hausen 695 616 695 (617) Alsdorf Haarland Wollomoos Schmarnzell Ainhofen (561) hausen (785) Hohen- (619) Allers- Tünzhausen/ Ruhpalzing Langenpreising Ramperting (785) Herschen- 695 616 Thonhausen Gerlhausen -

Informationsbroschüre Über Den Ammer-Amper-Radweg Zum
Für irrtümliche oder unvollständige Angaben oder Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Die Reihenfolge der Hotels Legende richtet sich nach der geographischen Lage und stellt keine Rangfolge dar. Karte: Toursprung GmbH und OpenStreetMap - Mitwirkende 12 BikeHotel (siehe Adressliste) Burgruine, Festung oder Schloss Schloss und Brauerei Au Kirche, Dom oder Kloster Hopfenland Hallertau Die Hallertau ist das größte zusammenhängende Hopfen- Museum oder Sammlung anbaugebiet der Welt. Bei Ver- anstaltungen, auf Radtouren oder ~ Bad (Strand, Freibad, Therme) Bezirksmuseum Dachau bei Brauerei- und Hoführungen Natursehenswürdigkeit (Wasserfall, kann man die Region entdecken. Das Museum im Herzen der Höhle, Schlucht, etc.) Dachauer Altstadt zeigt auf drei Stockwerken rund 2000 Weihenstephan C Campingplatz / Zeltplatz Gegenstände zur Kulturgeschichte Besucher zieht es auf den Moosburg an der Isar und Volkskunde Dachaus und Weihenstephaner Berg wegen des Haag Schiffahrt (mit Webadresse) Die Kirche des Kollegiatstifts seines Umlandes. heiligen Korbiniansbrünnlein und an der Amper 58 St. Kastulus ist ein Bauwerk mit der „Ältesten Brauerei der Welt“. reicher Geschichte. Der Hochaltar Gartenfreunde begeistern sich für 56 59 60 ist eines der bedeutendsten die Lehr- und Forschungsgärten. Amper Werke bayerischer Kunst zwischen 52 57 Spätgotik und Renaissance. Schloss Haimhausen Schloss Hohenkammer (38) Gästehaus Berner 1281 erwähnt und im 30-jährigen Krieg Professor-Schmid-Straße 25 zerstört, wurde Haimhausen 1660 als 82140 Olching Dachau Barockschloss wieder aufgebaut. Mitte +49 (0) 8142 3251 In der malerischen Altstadt, auf einer des 18. Jh. vergrößerte Francois Cuvilliés 53 54 55 Anhöhe über der Amper gelegen, die Anlage., die heute die Bavarian (39) Camping Ampersee befnden sich das kurfürstliche International School beheimatet. Josef-Kistler-Weg 5 Schloss der Wittelsbacher mit 82140 Olching seinem Hofgarten, die Pfarrkirche 51 Freising +49(0)8142 / 12786 www.campingampersee.de St. -

Mediadaten 2020.Pdf
PreislistePreisliste Nr.Nr. 5146 gültiggültig ab ab 1. 1. Januar Januar 2020 2015 DasDas auflagenstärkste aufl agenstärkste AnzeigenblattAnzeigenblatt im im Landkreis Landkreis Fürstenfeldbruck Fürstenfeldbruck 2 Titelprofil Amper-Kurier Preisliste Nr. 51 · gültig ab Januar 2020 53. Jahrgang Der Amper-Kurier – das werbewirksame Medium mit der optimalen Reichweite Anzeigen-Annahmestelle: Hasenheide 11 82256 Fürstenfeldbruck Tel. 08141 50180-0 Fax 50180-30 + 50180-40 Auslieferung & Zustellung: Hasenheide 11 82256 Fürstenfeldbruck Mit einer Auflage von über 166.000 Exemplaren proWoche erreicht der Amper-Kurier Tel. 08141 50180-77 Fax 08141 50180-75 KW 46 • 13. November 2019 W www.amper-kurier.de E-Mail: [email protected] eine enorme Anzahl an Lesern im Landkreis Fürstenfeldbruck und Starnberg. Uhren KOLLER – Galerie RUDOLF – Aquarelle vom Kloster Fürstenfeld und Landkreis, Gemälde – Einrahmungen – Mechanische Armbanduhren Durch den gekonnten Mix aus Rubrikenvielfalt, interessanten redaktionellen 53. Jahrgang – Silber- und Perlenschmuck En“t“lich wieder … Anzeigen-Annahmestelle: Dachauer Straße 17, 82256 Fürstenfeldbruck, Tel. 08141 91981 Hasenheide 11 www.uhren-koller.de 82256 Fürstenfeldbruck Knusprige Tel. 08141 50180-0 Beiträgen aus der Region sowie einem ansprechenden optischen Auftreten Fax 50180-30 + 50180-40 Grillenten mit Auslieferung & Zustellung: Hasenheide 11 Immobilien Hirn Preiselbeeren, 82256 Fürstenfeldbruck Ihr Partner für Wir suchen Häuser Apfelblaukraut Tel. 08141 50180-77 erreicht Ihre Werbebotschaft eine attraktive, kaufkräftige Zielgruppe. - VERKAUF Fax 08141 50180-75 PucherKW Straße 45 •42–46 9.Kundennr: Novemberund Wohnungen 2019 798691 O - VERMIETUNG und Kartoffelknödeln www.amper-kurier.de 82256 FürstenfeldbruckAuftrag:für solvente 5457873, Käufer, Wertermittlung Motiv: 001 E-Mail: [email protected] - VERWALTUNG Tel: 08141 103823 und Energieausweis kostenlos! Fax: 08141 103824 *798691-5457873-001* Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD Stand:H.L. -

FNP Begründung Mit Umweltbericht
B E G R Ü N D U N G M I T U M W E L T B E R I C H T ZUR NEUAUFSTELLUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES MIT INTEGRIERTEM LANDSCHAFTSPLAN DER MARKTGEMEINDE NANDLSTADT LANDKREIS FREISING ÜBERBLICK: MARKT NANDLSTADT MIT DEN GEMEINDETEILEN AIGLSDORF, AIRISCHWAND, ALTFALTERBACH, ANDORF, BAUERNRIED, BAUMGARTEN, BOCKSCHWAIG, BRUDERSDORF, FAISTENBERG, FIGLSDORF, GROSSGRÜNDLING, GRÜNDL, HADERSDORF, HAUSMEHRING, HÖLL, HOLZEN, KAINRAD, KITZBERG, KLEINGRÜNDLING, KLEINWOLFERSDORF, KOLLERSDORF, KRONWINKL, MEILENDORF, OBERHOLZHÄUSELN, OBERSCHWAIG, REHLOH, REITH, RIEDGLAS, RIEDHOF, SCHATZ, SPITZ, THALSEPP, TÖLZKIRCHEN, UNTERHOLZHÄUSELN, WADENSDORF, WEIHERSDORF, ZEILHOF UND ZULEHEN EINWOHNERZAHL ZUM 30.06.2017: 5227 FLÄCHE: 34,31 km² GENEHMIGUNGSBEHÖRDE: LANDRATSAMT FREISING Begründung mit Umweltbericht zum Flächennutzungsplan Markt Nandlstadt Seite 2 von 98 Inhaltsverzeichnis: Vorbemerkungen (allgemein) Definition und Inhalt des Flächennutzungsplanes? Welche Auswirkungen hat der Flächennutzungsplan (§ 7 BauGB)? Wie ist die Art der Nutzung zu verstehen (Baunutzungsverordnung)? Verfahren allgemein (§ 2 BauGB) Vorbemerkungen (speziell) Verfahren (speziell) 1. Rahmenbedingung und Strukturdaten der Planung, übergeordnete Ziele 1.1 Lage, Größe und Funktion im Raum 1.2 Landes- und Regionalplanung (Ziele) 1.2.1 Landschaft 1.2.2 Land- und Forstwirtschaft 1.2.3 Siedlungsstruktur 1.3 Landschaft 1.4 Bevölkerungsentwicklung 1.4.1 Bisherige Bevölkerungsentwicklung 1.4.2 Einwohnerverteilung 1.4.3 Einwohnerentwicklung 1.4.4 Wohnungsentwicklung 1.5 Erwerbsstruktur 1.6 Siedlungsstruktur -
Landkreis Erding (ED)
ENTWURF Fortschreibung des Regionalplans der Region München (14) Kap. B I 2.4 Abflussregelung Ausweisung von Vorranggebieten für den Hochwasserabfluss und –rückhalt (Vorranggebiete Hochwasser) Teil B Nachhaltige Entwicklung der raumbedeutsamen Fachbereiche B I Sicherung und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen 2 Wasser 2.4 Abflussregelung Die Ziele und Grundsätze der Ziffern 2.4.1 und 2.4.2 erhalten folgende Fassung: 2.4.1 Wasserhaushalt G 2.4.1.1 Die Auswirkungen von Abflussregelungen auf den Wasserhaushalt des gesamten Flussgebietes sollen beachtet werden. Durch geeignete Standorte für Wasserspeicher und sonstige Rückhalteeinrichtungen sollen die Abflussextreme verringert werden. G 2.4.1.2 Die Versickerungsfähigkeit der Flächen soll erhalten werden, insbesondere durch Beschränkung der Bodenversiegelung. 2.4.2 Hochwasserschutz G 2.4.2.1 Die Rückhalte- und Speicherfähigkeit der Landschaft soll erhalten und verbessert werden. Verbaute und begradigte Fließgewässer sollen soweit möglich saniert und renaturiert werden. Z 2.4.2.2 Überschwemmungsgebiete sollen in ihrer Funktion als natürliche Rückhalteräume, insbesondere in den Auen und an den Gewässern, erhalten oder reaktiviert werden und von konkurrierenden Nutzungen, insbesondere von Bebauung, freigehalten werden. G 2.4.2.3 In natürlichen Rückhalteräumen soll die Bodennutzung auf die wasserwirtschaftlichen Anforderungen abgestimmt werden. Regelmäßig überflutete Flächen sollen als Auwald oder Grünland erhalten oder wiederhergestellt werden. Landwirtschaftliche Flächen sollen in der Regel nicht hochwassergeschützt werden. Z 2.4.2.4 Zur Sicherung des Hochwasserabflusses und –rückhaltes werden außerhalb wasserrechtlich festgesetzter Überschwemmungsgebiete nachfolgend aufgeführte Vorranggebiete Hochwasser ausgewiesen. In den Vorranggebieten Hochwasser kommt dem vorbeugenden Hochwasserschutz gegenüber anderen raumbedeutsamen Nutzungen Stand: 15.09.2003 -2- Vorrang zu, soweit diese mit dem vorbeugenden Hochwasserschutz nicht vereinbar sind. -
Die Najaden Und Viviparen Des Flußgebietes Der Amper (Oberbayern)
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Archiv für Molluskenkunde Jahr/Year: 1941 Band/Volume: 73 Autor(en)/Author(s): Modell Hans Artikel/Article: Die Najaden und Viviparen des Flußgebietes der Amper (Oberbayern). 1-46 Band 73. 15. Februar 1941. Nummer 1 Archiv für Molluskenkunde der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft und der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft Herausgegeben von Dr. W. W E N Z und Dr. A. Z1LC H Die Najaden und Viviparen des Flußgebietes der Amper (Oberbayern). Von Hans Modell, Lindau/B. (Mit 7 Tafeln, 1 Abbildung und 1 Karte) Die Amper, der größte Nebenfluß der Isar, umfaßt nach den amtlichen Angaben ein Einzugsgebiet von 3167 qkm, wovon auf die Würm 450 qkm treffen. Der Lauf der Amper läßt sich in 3 natürliche Teilgebiete zer legen. Der Oberlauf im Gebiet der Kalkalpen reicht von der Quelle bis zum Verlassen der letzten gefalteten oligocänen Mo lassehügel bei Peissenberg. Er verläuft im oberen Teile in Gebirgs tälern, die den Najaden fast keine Ansiedlungsmöglichkeit bieten, nur in einigen kleinen Weihern finden sich Anodonten. Erst die Zone der oligocänen Hügel bot die Möglichkeit zur Anlage von Seebecken und damit Abschwächung des Gefälles. Heute sind da von nur noch der Staffel- und Riegsee vorhanden, andere, aus gedehnte Seen bei Oberammergau und Oberhausen sind längst erloschen. Staffelsee und Riegsee sind in eine west-östlich streichende A4ulde eingebettet. In seiner Anlage ähnlich, nur viel kleiner wie der Chiemsee, hat er ein ausgesprochenes Prallufer im Osten bei Murnau, im Süden ein steiniges Parallelufer, im Westen und im buchtigen Norden ausgesprochene Sumpfufer, z. -
Huosiland: a Small Country in Carolingian Europe
Huosiland A Small Country in Carolingian Europe Carl I. Hammer Access Archaeology haeopr c es r s A A y c g c e o l s o s e A a r c Ah About Access Archaeology Access Archaeology offers a different publishing model for specialist academic material that might traditionally prove commercially unviable, perhaps due to its sheer extent or volume of colour content, or simply due to its relatively niche field of interest. All Access Archaeology publications are available in open-access e-pdf format and in (on-demand) print format. The open-access model supports dissemination in areas of the world where budgets are more severely limited, and also allows individual academics from all over the world the chance to access the material privately, rather than relying solely on their university or public library. Print copies, nevertheless, remain available to individuals and institutions who need or prefer them. The material is professionally refereed, but not peer reviewed. Copy-editing takes place prior to submission of the work for publication and is the responsibility of the author. Academics who are able to supply print-ready material are not charged any fee to publish (including making the material available in open-access). In some instances the material is type-set in-house and in these cases a small charge is passed on for layout work. This model works for us as a publisher because we are able to publish specialist work with relatively little editorial investment. Our core effort goes into promoting the material, both in open-access and print, where Access Archaeology books get the same level of attention as our core peer-reviewed imprint by being included in marketing e-alerts, print catalogues, displays at academic conferences and more, supported by professional distribution worldwide.