2018 02 28 Gruppe Ulbricht
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
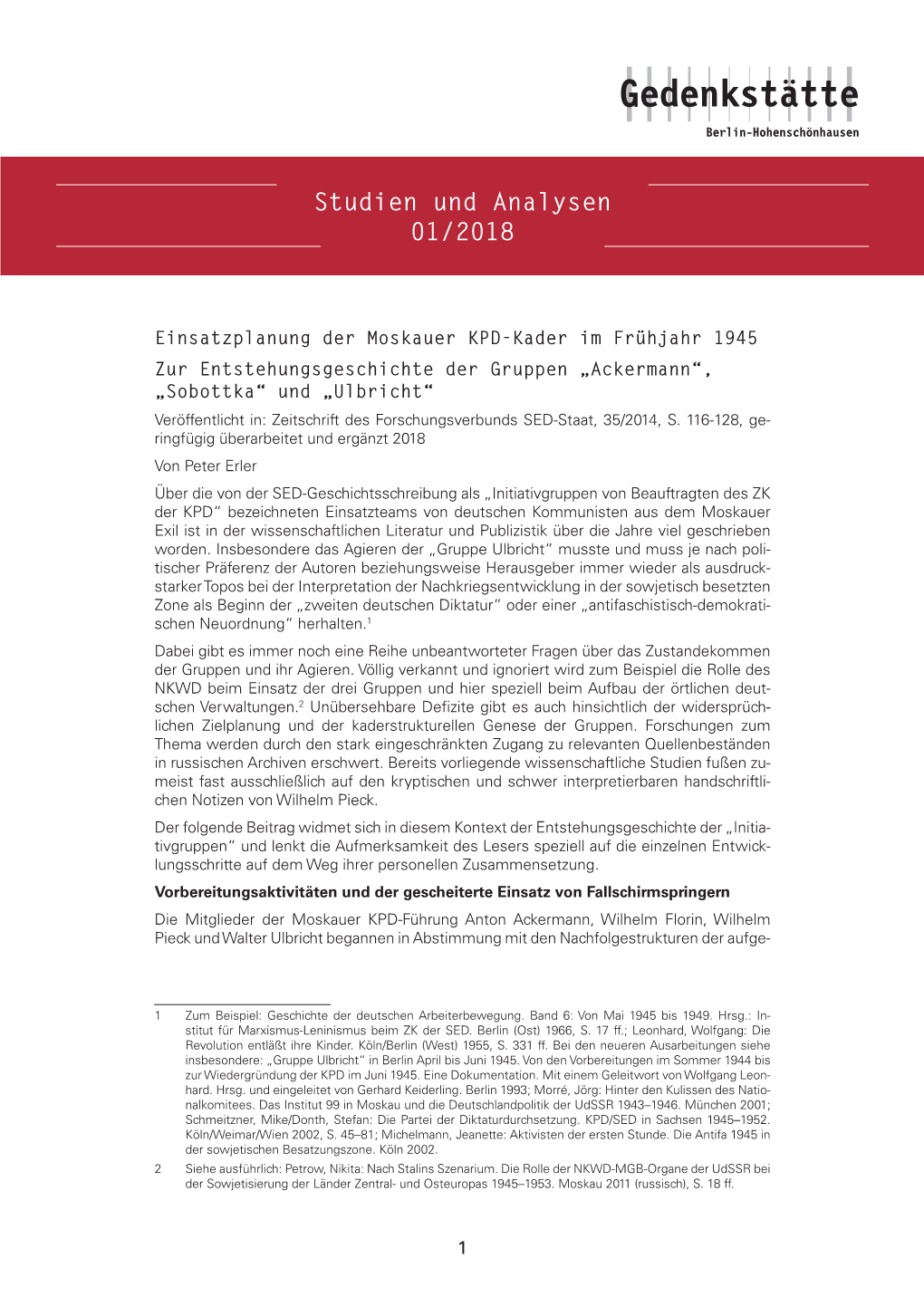
Load more
Recommended publications
-

The Formation of the Communist Party of Germany and the Collapse of the German Democratic Republi C
Enclosure #2 THE NATIONAL COUNCI L FOR SOVIET AND EAST EUROPEA N RESEARC H 1755 Massachusetts Avenue, N .W . Washington, D.C . 20036 THE NATIONAL COUNCIL FOR SOVIET AND EAST EUROPEAN RESEARC H TITLE : Politics Unhinged : The Formation of the Communist Party of Germany and the Collapse of the German Democratic Republi c AUTHOR : Eric D . Weitz Associate Professo r Department of History St . Olaf Colleg e 1520 St . Olaf Avenu e Northfield, Minnesota 5505 7 CONTRACTOR : St . Olaf College PRINCIPAL INVESTIGATOR : Eric D . Weit z COUNCIL CONTRACT NUMBER : 806-3 1 DATE : April 12, 199 3 The work leading to this report was supported by funds provided by the National Council for Soviet and East Europea n Research. The analysis and interpretations contained in the report are those of the author. i Abbreviations and Glossary AIZ Arbeiter-Illustrierte-Zeitung (KPD illustrated weekly newspaper ) Alter Verband Mineworkers Union Antifas Antifascist Committee s BL Bezirksleitung (district leadership of KPD ) BLW Betriebsarchiv der Leuna-Werke BzG Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung Comintern Communist International CPSU Communist Party of the Soviet Unio n DMV Deutscher Metallarbeiter Verband (German Metalworkers Union ) ECCI Executive Committee of the Communist Internationa l GDR German Democratic Republic GW Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke HIA, NSDAP Hoover Institution Archives, NSDAP Hauptarchi v HStAD Hauptstaatsarchiv Düsseldorf IGA, ZPA Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung, Zentrales Parteiarchi v (KPD/SED Central Party Archive -

Aero Ae 45 & Ae
This production list is presented to you by the editorial team of "Soviet Transports" - current to the beginning of January 2021. Additions and corrections are welcome at [email protected] Aero Ae 45 & Ae 145 181 Ae 45 built by Aero at Prague-Vysocany from 1947 to 1951 The c/n consisted of the year of manufacture and a sequential number. 1 OK-BCA Ae 45 Aero f/f 21jul47 the first prototype; rgd 11sep47; underwent trials with the SVZÚ sep47 OK-BCA Ae 45 Ministers. dopravy trf unknown Ministry of Transport OK-BCA Ae 45 CSA trf unknown canx 1953 2 OK-CCA Ae 45 Aero rgd 09apr48 the second prototype; f/f 12mar48 OK-CCA Ae 45 Celulozka Bratisl. trf unknown Celulozka Bratislava; canx 1958 not known Ae 45 Czechoslovak AF trf unknown 49 003 G-007 (1) Ae 45 Hungarian AF d/d 15may49 HA-AEB Ae 45 MÉM Rep. Szolgálat trf 06apr52 Hungarian Flying Association; damaged 29apr52 when the landing gear broke HA-AEB Ae 45 OMSZ trf 18jun57 Hungarian Air Ambulance; w/o (or canx ?) 22nov62 49 004 OK-DCB Ae 45 rgd 21apr49 canx to Italy I-CRES Ae 45 Aero Club Milano rgd 18jul59 Aero Club Milano of Linate; owner also reported as Franco Rol; based at Torino; canx 1970 F-GFYA Ae 45 Pierre Cavassilas res aug88 Pierre Cavassilas of Chavenay; possibly never fully registered F-AZJX Ae 45 Pierre Cavassilas rgd 08jul94 seen Chavenay 20may94 with a 'W' taped over the 'A' of the registration; still current in 2007; under restoration near Paris in 2008; was to be reflown jan09; seen Compiègne 19jun09 and 27jun09 in all-grey c/s with large blue registration, in great condition; seen Soissons-Courmelles 28may12 with smaller black registration; l/n Compiègne 15jun13, active 49 005 OK-DCA Ae 45 rgd 23apr49 I-AERA Ae 45 Luigi Leone rgd 11oct61 based at Torino 49 006 HB-EKF Ae 45 Mr. -

SWR2 Zeitwort 04.02.1956: Als "Deutsche Lufthansa" Startete Die Fluggesellschaft Der DDR Von Thomas Koch
SWR2 MANUSKRIPT ESSAYS FEATURES KOMMENTARE VORTRÄGE SWR2 Zeitwort 04.02.1956: Als "Deutsche Lufthansa" startete die Fluggesellschaft der DDR Von Thomas Koch Sendung: 04.02.2017 Redaktion: Ursula Wegener Produktion: SWR 2017 Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. Service: SWR2 Zeitwort können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter www.swr2.de oder als Podcast nachhören: http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/zeitwort.xml Autor: Es ist ein bitterkalter Februar Tag am Flughafen Berlin Schönefeld. Das Thermometer auf der Piste sinkt auf 8 Grad Unternull. Die linientreue Besatzung der Iljuschin IL – 14 P lässt sich weder vom Wetter noch von den sportlichen Erfolgen des Klassenfeindes beeindrucken. Planmäßig hebt die zweimotorige Propellermaschine in Ost-Berlin ab und nimmt Kurs auf Prag. Zwei Fluggesellschaften streiten sich zu dieser Zeit um die Nachfolge der Vorkriegs- Lufthansa. Eine im Westen, die in Köln ansässige Deutsche Lufthansa-West und das sozialistische Luftfahrtunternehmen im Osten. Der Ost-Lufthansa stand Arthur Pieck vor, der Sohn des ersten Staatspräsidenten Wilhelm Pieck. Der Streit um den Namen sollte erst 1963 vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag beendet werden. Die Ost-Flieger unterlagen. Sie mussten ihre Maschinen umlackieren. Die Gesellschaft hieß fortan „Interflug“. Damals noch Lufthansa-Ost, hatte sie den volkseigenen Flugbetrieb bereits 1955 aufgenommen. An Bord saßen allerdings zunächst ausschließlich gewählte Vertreter der DDR-Nomenklatura. Die Airline war zunächst ein reiner Regierungsflugdienst. Das Maschinenmaterial kam vom großen Bruder im Osten und es war selten auf der Höhe der Zeit. -

Central Europe
Central Europe WEST GERMANY HE WEST GERMAN ECONOMY continued to expand between July 1955 and TJune 1956. After June, production declined slightly. The gross national product rose 11 per cent in 1955, to 60 per cent above 1950. Industrial pro- duction, up 16 per cent, doubled that of 1950. The index (1936= 100) was 221 by June 1956. But West Berlin only regained the 1936 level. Employment in the Federal Republic was more than 800,000 above the previous year. In part, this was due to the influx of almost 300,000 refugees from East Germany during 1955-56. Unemployment, at 479,000, or 2.5 per cent of the labor force of 18.4 million, was the lowest since the end of World War II. West Berlin unemployment fell, but was still 11.3 per cent. Output per man was up 17 per cent in 1955, while wages rose only 12 per cent. The July 1956 cost of living index (1950 = 100) at 113, was 2.3 per cent above July 1955. National consumption rose 12 per cent during 1955-56, but old age pensioners, war invalids and widows, and the lowest categories of un- skilled workers, were barely touched by the "economic miracle," and contin- ued to exist near the subsistence level. Steel production, exceeding that of either France or Britain, reached a post- war high of 21,700,000 tons in the twelve months under review. Some of the Ruhr steel and coal combines, split up by the Allies to destroy "dangerous concentrations of economic power," recombined in new forms. -

Heft 2 April 1997
VIERTELJAHRSHEFTE FÜR Zeitgeschichte Im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte München herausgegeben von KARL DIETRICH BRACHER HANS-PETER SCHWARZ HORST MÖLLER in Verbindung mit Theodor Eschenburg, Rudolf v. Albertini, Dietrich Geyer, Hans Mommsen, Arnulf Baring und Gerhard A. Ritter Redaktion: Norbert Frei, Udo Wengst, Jürgen Zarusky Chefredakteur: Hans Woller Stellvertreter: Andreas Wirsching Institut für Zeitgeschichte, Leonrodstr. 46b, 80636 München, Tel.126880, Fax 12317 27 45. Jahrgang Heft 2 April 1997 INHALTSVERZEICHNIS AUFSÄTZE Frank Zschaler Die vergessene Währungsreform. Vorgeschichte, Durchführung und Ergebnisse der Geldumstellung in der SBZ 1948 191 Karl Christian Führer Anspruch und Realität. Das Scheitern der national sozialistischen Wohnungsbaupolitik 1933-1945 . 225 Gerhard Keiderling Scheinpluralismus und Blockparteien. Die KPD und die Gründung der Parteien in Berlin 1945 .... 257 DISKUSSION Yehuda Bauer Anmerkungen zum „Auschwitz-Bericht" von Rudolf Vrba 297 II Inhaltsverzeichnis DOKUMENTATION Yeshayahu A.Jelinek/ Ben Gurion und Adenauer im Waldorf Astoria. Rainer A. Blasius Gesprächsaufzeichnungen vom israelisch-deutschen Gipfeltreffen in New York am 14. März 1960 .... 309 NOTIZ Mikroverfilmte ausländische Archivalien in der Bayerischen Staatsbibliothek (Freddy Litten) .... 345 ABSTRACTS 349 MITARBEITER DIESES HEFTES 351 Verlag und Anzeigenverwaltung: R. Oldenbourg Verlag GmbH, Rosenheimer Straße 145, 81671 München. Für den Inhalt verantwortlich: Horst Möller; für den Anzeigenteil: Suzan Hahnemann. Erscheinungsweise: -

Moskau Mit Einem Lächeln. Annäherung an Die Schauspielerin
Christina Jung Moskau mit einem Lächeln Annäherung an die Schauspielerin Lotte Loebinger und das sowjetische Exil Verdammte Welt. Es bleibt ei- nem nur übrig, sich aufzuhängen oder sie zu ändern. Aus Hoppla, wir leben! (1927) letzte Schrifteinblendung Lotte Loebinger 9127 Mit Schiller, ihrer „große[n] Liebe, schon von der Schulzeit her“,1 fängt alles an. Die Eboli ist die Rolle, mit der Lotte Loebinger sich an verschiedenen Theatern vorstellt und genommen wird. Doch Klassiker zu spielen, wird ein Lebenstraum bleiben, wie sie rückblickend bemerkt. Zwar ist Schiller zum meist gespielten Dramatiker der 30er Jahre avanciert,2 Lotte Loebinger aber hat frühzeitig Partei ergriffen und sich für das politisch-revolutionäre Theater entschieden. Das hat den verstaubten Klassiker kurzfristig eingemottet3 und sich enthusiastisch der zeitgenössischen Dramatik gewidmet: Friedrich Wolf, Ernst Toller, Theodor Plivier und nicht zuletzt Brecht stehen auf dem Spiel- plan. Lotte Loebingers Karriere ist eng mit den großen, das Theater der Weima- 1 Waack, Renate: Lotte Loebinger. In: Pietzsch, Ingeborg: Garderobengespräche. Berlin (DDR) 1982. S. 91. 2 Vgl. Mittenzwei, Werner: Verfolgung und Vertreibung deutscher Bühnenkünstler durch den Nationalsozialismus. In: Mittenzwei, Werner/Trapp, Frithjof/Rischbieter, Henning/Schneider, Hansjörg (Hrsg.): Handbuch des deutschsprachigen Exiltheaters 1933-1945. München 1999. S. 23. 3 Ausnahmen bestätigen die Regel. So inszenierte z. B. Erwin Piscator 1926 Schillers Räuber für das Staatliche Schauspielhaus Berlin. Auch im Repertoire des deutschen Exiltheaters in der Sowjetunion machten klassische Dramen einen nicht unerheblichen Teil aus. 10 Augen-Blick 33: Flucht durch Europa rer Republik prägenden Namen verbunden: Allen voran mit Erwin Piscator, aber auch Gustav von Wangenheim und Maxim Vallentin, Regisseure, die auch für das Exiltheater, insbesondere in der Sowjetunion und später in der DDR von Bedeutung sind. -

200 Da-Oz Medal
200 Da-Oz medal. 1933 forbidden to work due to "half-Jewish" status. dir. of Collegium Musicum. Concurr: 1945-58 dir. of orch; 1933 emigr. to U.K. with Jooss-ensemble, with which L.C. 1949 mem. fac. of Middlebury Composers' Conf, Middlebury, toured Eur. and U.S. 1934-37 prima ballerina, Teatro Com- Vt; summers 1952-56(7) fdr. and head, Tanglewood Study munale and Maggio Musicale Fiorentino, Florence. 1937-39 Group, Berkshire Music Cent, Tanglewood, Mass. 1961-62 resid. in Paris. 1937-38 tours of Switz. and It. in Igor Stravin- presented concerts in Fed. Repub. Ger. 1964-67 mus. dir. of sky's L'histoire du saldai, choreographed by — Hermann Scher- Ojai Fests; 1965-68 mem. nat. policy comm, Ford Found. Con- chen and Jean Cocteau. 1940-44 solo dancer, Munic. Theater, temp. Music Proj; guest lect. at major music and acad. cents, Bern. 1945-46 tours in Switz, Neth, and U.S. with Trudy incl. Eastman Sch. of Music, Univs. Hawaii, Indiana. Oregon, Schoop. 1946-47 engagement with Heinz Rosen at Munic. also Stanford Univ. and Tanglewood. I.D.'s early dissonant, Theater, Basel. 1947 to U.S. 1947-48 dance teacher. 1949 re- polyphonic style evolved into style with clear diatonic ele- turned to Fed. Repub. Ger. 1949- mem. G.D.B.A. 1949-51 solo ments. Fel: Guggenheim (1952 and 1960); Huntington Hart- dancer, Munic. Theater, Heidelberg. 1951-56 at opera house, ford (1954-58). Mem: A.S.C.A.P; Am. Musicol. Soc; Intl. Soc. Cologne: Solo dancer, 1952 choreographer for the première of for Contemp. -

Das Revolutionäre Arbeitertheater Der Weimarer Zeit Theater Als Instrument Kommunistischer Propaganda
Das revolutionäre Arbeitertheater der Weimarer Zeit Theater als Instrument kommunistischer Propaganda Magisterarbeit im Fach Deutsche Literatur an der Universität Konstanz vorgelegt von Oliver Bendel 2., verbesserte Auflage Konstanz 2004 Inhalt 1. Einleitung ..................................................................................................................... 4 2. Piscators „Proletarisches Theater“................................................................................ 9 2.1 Gründung und Vorgeschichte................................................................................. 9 2.2 Das neue Konzept: die Funktionalisierung des Theaters...................................... 11 2.3 Die Inszenierung von „Rußlands Tag“................................................................. 15 2.4 Rezeption und weitere Entwicklung..................................................................... 21 3. Der Sprechchor........................................................................................................... 24 3.1 Die Haltung der KPD ........................................................................................... 24 3.2 Die Entwicklung der frühen Sprechchorformen................................................... 25 3.3 Der „Zentrale Sprechchor der KPD“.................................................................... 25 3.4 „Proletarische Sprech- und Spielgemeinschaft Steglitz“...................................... 31 3.5 Weitere Entwicklung........................................................................................... -

Bulletin 10-Final Cover
COLD WAR INTERNATIONAL HISTORY PROJECT BULLETIN 10 61 “This Is Not A Politburo, But A Madhouse”1 The Post-Stalin Succession Struggle, Soviet Deutschlandpolitik and the SED: New Evidence from Russian, German, and Hungarian Archives Introduced and annotated by Christian F. Ostermann I. ince the opening of the former Communist bloc East German relations as Ulbricht seemed to have used the archives it has become evident that the crisis in East uprising to turn weakness into strength. On the height of S Germany in the spring and summer of 1953 was one the crisis in East Berlin, for reasons that are not yet of the key moments in the history of the Cold War. The entirely clear, the Soviet leadership committed itself to the East German Communist regime was much closer to the political survival of Ulbricht and his East German state. brink of collapse, the popular revolt much more wide- Unlike his fellow Stalinist leader, Hungary’s Matyas spread and prolonged, the resentment of SED leader Rakosi, who was quickly demoted when he embraced the Walter Ulbricht by the East German population much more New Course less enthusiastically than expected, Ulbricht, intense than many in the West had come to believe.2 The equally unenthusiastic and stubborn — and with one foot uprising also had profound, long-term effects on the over the brink —somehow managed to regain support in internal and international development of the GDR. By Moscow. The commitment to his survival would in due renouncing the industrial norm increase that had sparked course become costly for the Soviets who were faced with the demonstrations and riots, regime and labor had found Ulbricht’s ever increasing, ever more aggressive demands an uneasy, implicit compromise that production could rise for economic and political support. -

Sozialdemokraten Als Opfer Im Kampf Gegen Die Rote Diktatur Arbeitsmaterialien Zur Politischen Bildung
Sozialdemokraten als Opfer im Kampf gegen die rote Diktatur Arbeitsmaterialien zur politischen Bildung Dieter Rieke (Hg.) Herausgeber: Dieter Rieke Stellv. Vorsitzender des Sozialdemokratischen Arbeitskreises ehemaliger politischer Häftlinge der SBZ/DDR © 1994 by Friedrich-Ebert-Stiftung, Godesberger Allee 149, 53175 Bonn Layout: Pellens Kommunikationsdesign GmbH, Bonn Fotos: Frauendorf, Reiss, FES Lithografie: Schreck & Jasper GmbH, Bonn Druck: satz & druck gmbh, Düsseldorf Papier. Zanders Mega matt, aus 100% chlorfrei ge- bleichten Zellstoffen (TCF) und aus wiederauf- bereiteten Recyclingfasern im Verhältnis 50:50 Printed in Germany 1994 Inhalt 5 Dieter Rieke Sozialdemokraten als Opfer im Kampf gegen die rote Diktatur 7 Sozialdemokraten, die in der SBZ und frühen DDR zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt wurden Beispiele für viele Tausende 12 Die zwangsweise Vereinigung von KPD und SPD Eine Argumentation der Grundwertekommission beim Vorstand der SPD 17 Wolfgang Leonhard Ein Kronzeuge der damaligen Zeit 22 Kurt Schumachers Manifest Freiheit in Europa und demokratische Selbstbehauptung 25 Aus der Zeit des Widerstandes 27 Wolfgang Buschfort Gefoltert und geschlagen 31 Gegner und Opfer der Zwangsvereinigung berichten 37 Der Brief aus Bautzen 42 Gedenkfeier und Vermächtnis 44 Dokumente über sowjetische Internierungslager und Strafanstalten 46 Kongreß der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1961 Deutscher Freiheitskampf in der Sowjetzone - Begrüßungsansprache von Erich Ollenhauer - Aus der Ansprache Willy Brandts 50 Anhang mit Literaturverzeichnis 3 Sozialdemokraten als Opfer im Kampf gegen die rote Diktatur „Diese Worte sind mit Herzblut geschrieben. Man kann dies auf zweierlei Weise tun: Der Sie sind jenen Menschen gewidmet, die den Mensch „vergißt" und ignoriert die Qualen der politischen Wandel der neuen Bundesländer Vergangenheit, oder er versucht, die Etappen nicht mehr erleben und mitgestalten können. -

The East German Secret Service Structure and Operational Focus by J.A
Fall 1987 The East German Secret Service Structure and Operational Focus by J.A. Emerson Vermaat INTRODUCTION The East German secret service, more than any other Eastern bloc service, exercises the bulk of its activities in the Federal Republic of Ger many (FRG). Until 1945 the two Germanies shared a common past and culture and Germans in East and West still speak the same language. Consequently, it is much easier for East German agents to penetrate West German society and recruit West German citizens than it is for the Soviet KGB. Of the roughly 4000 Communist spies in West Germany, some 2500-3000 originate in East Germany. ' Most of the East German espionage is conducted by the Ministry of State Security (MfS) at the Normannenstrasse in East Berlin. Military in telligence operations are chiefly conducted by the Ministry of National Defence (MfNV). Founded in February 1950 — five months after the creation of the German Democratic Republic (GDR) — the Ministry's main purpose was to contribute to consolidating the new Communist regime imposed on the population in the Soviet controlled zone of Ger many. About 80% of the Ministry's activities continue to be focussed on internal control and repression and only 20% of its work is devoted to external espionage.2 As an organ of the GDR Ministerial Council the MfS is to protect "the socialist order of state and society against hostile attacks on the sovereignty and territorial of the GDR, the socialist achievements and the peaceful life of the people."3 The Soviets had a strong hand in the creation of the East German state security apparatus. -

Teil 5: 1939–1943 Stalin-Hitler-Pakt, Angriff Auf Die Sowjetunion Und Neuausrichtung Von Komintern Und KPD Im Zweiten Weltkrieg
Teil 5: 1939–1943 Stalin-Hitler-Pakt, Angriff auf die Sowjetunion und Neuausrichtung von Komintern und KPD im Zweiten Weltkrieg Dok. 456 Die Komintern zur „antisowjetischen Kampagne im Zusammenhang mit den Verhandlungen zwischen der UdSSR und Deutschland“ Moskau, 22.8.1939 Typoskript in russischer Sprache. RGASPI, Moskau, 495/18/1291, 141–143. In deutscher Sprache publ. in: Bernhard H. Bayerlein: „Der Verräter, Stalin, bist Du!“ Vom Ende der linken Solidarität. Komintern und kommunistische Parteien im Zweiten Weltkrieg, Berlin, Aufbau, 2008 (Archive des Kommunismus. Pfade des XX. Jahrhunderts. 4), S. 105. In russischer Sprache publ. in: Lebedeva/ Narinskij: Komintern i Vtoraja mirovaja vojna, I, S. 69–71. Protokoll (B) Nr. 477 der sitzung des sekretariats des Ekki 22.8.1939 ANWESEND: Gen. Gottwald, Dimitrov, Kuusinen, Manuilski, Marty, Florin. ENTGEGENGENOMMEN: 1 (1155). Zur antisowjetischen Kampagne im Zusammenhang mit den Verhandlungen zwischen der UdSSR und Deutschland. BESCHLOSSEN: 1. Den Parteien wird empfohlen, gegen die bürgerliche und sozialdemokratische1 Presse in die Offensive zu gehen und dabei folgendermaßen zu argumentieren: a) Der eventuelle Abschluß eines Nichtangriffspaktes zwischen der UdSSR und Deutschland schließt die Möglichkeit und Notwendigkeit eines Abkommens zwi- schen England, Frankreich und der UdSSR nicht aus, um die Aggressoren gemeinsam zurückzuschlagen. 2 1 Ursprünglich: „sozialistische“, von Dimitrov handschriftlich korrigiert. 2 Am 19.8.1939 übergab Molotov dem deutschen Botschafter in Moskau, Graf von der Schulenburg, den Entwurf eines Nichtangriffspaktes mitsamt einer geheimen Klausel, die ein Protokoll über ge- meinsame außenpolitische Interessen konkreter enthielt. Am 21.8.1939 teilte Stalin auf Drängen Hit- lers mit, die sowjetische Regierung habe zugestimmt, dass der deutsche Außenminister Joachim von Ribbentrop nach Moskau reise, um einen Nichtangriffspakt zwischen beiden Staaten abzuschließen.