Gesamtheft 153
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Zeitgeschichte
Zeitgeschichte 40 Jahre »Deutschland Archiv« Eine Zeitschrift im Dienst von DDR-Forschung und Wiedervereinigung1 Karl Wilhelm Fricke, Köln Die Chronik einer Zeitschrift aus Anlass eines Er- torisch absehbarer Zeit erreichbar schien, war für nie- scheinungsjubiläums aufzuzeichnen, Rückschau zu manden absehbar. Manche Politiker und Publizisten halten auf das in vier Jahrzehnten Geleistete, das hatten das Ziel schon abgeschrieben und wähnten den Abwägen von Kontinuität und Wandel eines Perio- Status quo als Dauerzustand. Umso nachdrücklicher dikums mit zeithistorischer Perspektive – das alles war daher die Herausgabe einer Zeitschrift speziell kann zur geschichtspolitischen Erinnerungskultur für Fragen der DDR und der Deutschlandpolitik an- beitragen, wenn es sich wie im gegebenen Fall um gesagt, die sich fortan auch der sich herausbildenden das Deutschland Archiv handelt. Oder scheint dieses wissenschaftlichen DDR-Forschung widmen wollte. Unterfangen anmaßend? Nein, es ist nicht anmaßend – Nicht zufällig kam es zur Gründung des Deutschland es ist Chronistenpflicht. Archiv im Kontext der ersten, ihrer Kontroversen we- gen legendären DDR-Forschertagung, die vom 19. – 23. Im Grunde genommen spiegelt sich die Geschichte September 1967 an der Akademie für Politische Bil- des Deutschland Archiv in seinem Untertitel wider, dung in Tutzing zum Generalthema »Situation, Aufga- der in seiner 40-jährigen Existenz dreimal neu for- ben und Probleme der DDR-Forschung« stattgefunden muliert wurde. Als das DA, wie die Zeitschrift häufig hatte. Grundlegend war ein kluges Referat, das Dieter zitiert wird, im April 1968 erstmals erschien, lautete Haack, damals Oberregierungsrat im Bundesminis- der Untertitel »Zeitschrift für Fragen der DDR und terium für Gesamtdeutsche Fragen, in Tutzing hielt. der Deutschlandpolitik«. Der Untertitel hatte Bestand Sein Postulat war eindeutig: »Gesamtdeutsche Politik bis Juni 1990. -

Michael Schumann Hoffnung PDS Reden, Aufsätze, Entwürfe 1989–2000 Rls 12 Rosa-Luxemburg-Stiftung Texte 12 Rosa-Luxemburg-Stiftung
Wolfram Adolphi (Hrsg.) Michael Schumann Hoffnung PDS Reden, Aufsätze, Entwürfe 1989–2000 rls 12 Rosa-Luxemburg-Stiftung Texte 12 Rosa-Luxemburg-Stiftung WOLFRAM ADOLPHI (HRSG.) Michael Schumann Hoffnung PDS Reden, Aufsätze, Entwürfe 1989-2000 Mit einem Geleitwort von Lothar Bisky Karl Dietz Verlag Berlin Herausgegeben mit Unterstützung der PDS-Fraktion im Landtag Brandenburg. Ein besonderer Dank gilt Herrn Marco Schumann, Potsdam, für seine Hilfe und Mitarbeit. Wolfram Adolphi (Hrsg.): Michael Schumann. Hoffnung PDS Reden, Aufsätze, Entwürfe 1989-2000. Mit einem Geleitwort von Lothar Bisky (Reihe: Texte/Rosa-Luxemburg-Stiftung; Bd. 12) Berlin: Dietz, 2004 ISBN 3-320-02948-7 © Karl Dietz Verlag Berlin GmbH 2004 Satz: Jörn Schütrumpf Umschlag, Druck und Verarbeitung: MediaService GmbH BärenDruck und Werbung Printed in Germany Inhalt LOTHAR BISKY Zum Geleit 9 WOLFRAM ADOLPHI Vorwort 11 Abschnitt 1 Zum Herkommen und zur Entwicklung der PDS Wir brechen unwiderruflich mit dem Stalinismus als System! Referat auf dem Außerordentlichen Parteitag der SED in Berlin am 16. Dezember 1989 33 Von der SED zur PDS – geht die Rechnung auf? Interview für die Tageszeitung »Neues Deutschland« vom 26. Januar 1990 57 Programmatik und politisches System Artikel für die vom PDS-Parteivorstand herausgegebene Zeitschrift »Disput«, Heft 14/1992 (2. Juliheft) 69 Souverän mit unserer politischen Biographie umgehen Referat auf dem 3. Parteitag der PDS in Berlin (19.-21. Januar 1993) 74 Der Logik des Kräfteverhältnisses stellen! Rede auf dem 12. Parteitag der DKP, Gladbeck, am 13. November 1993 90 5 Vor fünf Jahren: »Wir brechen unwiderruflich mit dem Stalinismus als System!« Reminiszenzen und aktuelle Überlegungen 94 Antikommunismus? Schlußwort auf dem Historisch-rechtspolitischen Kolloquium »KPD-Verbot oder mit Kommunisten leben? Das KPD-Verbotsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. -

Jürgen Jahn (Berlin) Erinnerung an Bernhard Steinberger
Bitte beachten Sie, dass es im Vergleich zum Buch in diesem PDF zu minimalen Abweichungen im Umbruch kommen kann. Wir bitten dies zu entschuldigen! Jürgen Jahn (Berlin) Erinnerung an Bernhard Steinberger (geb. 17. 09. 1917 in München, gest. 16. 12. 1990 in Berlin) Bernhard Steinberger kommt aus einem assimilierten jüdischen Elternhaus. Sein Vater, Dr. Max Steinberger, war Staatsanwalt am Landesgericht in München; er stirbt zwei Wochen nach der Geburt des Sohnes. Die Mutter heiratet nach dem Ersten Weltkrieg ein zweites Mal, läßt sich aber nach zehnjähriger unglücklicher Ehe in den dreißiger Jahren scheiden. Der Sohn besucht die Volksschule (1924–1928) und das Neue Realgymnasium (1928–1934) und geht – nach einem halbjährigen Volontariat in einer Autorepara- turwerkstatt – im Ertelwerk München in die Lehre als Feinmechaniker. Der Lehrling denkt an ein Ingenieurstudium; er ist ein begeisterter und geschickter Modellflugzeugbauer und möchte am liebsten Luftfahrttechniker oder Flugzeug- konstrukteur werden. Solch ein Berufswunsch erweist sich in Hitler-Deutschland rasch als Illusion: Als das Werk, das geodätische Instrumente herstellt, in die Regie der Wehrmacht übergeht und die Belegschaft vereidigt wird, muß Steinber- ger als Jude den Betrieb verlassen; immerhin erhält er ein gutes Abschlußzeugnis. So emigriert der Achtzehnjährige im Juli 1936 nach Mailand; die Mutter und die fünf Jahre jüngere Schwester folgen nach. Im November findet er eine illegale, schlecht bezahlte Anstellung als Zeichner, dann als Konstrukteur in einer Fabrik für Hausbaumaschinen; zum Oktober 1937 wechselt er in eine behördlich ge- nehmigte Stellung als Konstrukteur bei einer Firma für Straßenbaumaschinen und Traktoren, die den Unterhalt der kleinen Familie sichert. Als jedoch am 1. September 1938 auch in Italien antisemitische Gesetze erlassen werden, emigriert Steinberger in die Schweiz, die noch keinen Visumzwang eingeführt hat. -
![Germanica, 44 | 2009, « Écriture Des Identités Multiples Dans L’Allemagne Unifée » [En Ligne], Mis En Ligne Le 01 Janvier 2010, Consulté Le 06 Octobre 2020](https://docslib.b-cdn.net/cover/7088/germanica-44-2009-%C2%AB-%C3%A9criture-des-identit%C3%A9s-multiples-dans-l-allemagne-unif%C3%A9e-%C2%BB-en-ligne-mis-en-ligne-le-01-janvier-2010-consult%C3%A9-le-06-octobre-2020-1547088.webp)
Germanica, 44 | 2009, « Écriture Des Identités Multiples Dans L’Allemagne Unifée » [En Ligne], Mis En Ligne Le 01 Janvier 2010, Consulté Le 06 Octobre 2020
Germanica 44 | 2009 Écriture des identités multiples dans l’Allemagne unifiée Anne-Marie Corbin (dir.) Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/germanica/437 DOI : 10.4000/germanica.437 ISSN : 2107-0784 Éditeur Université de Lille Édition imprimée Date de publication : 1 juin 2009 ISBN : 978-2-913857-23-0 ISSN : 0984-2632 Référence électronique Anne-Marie Corbin (dir.), Germanica, 44 | 2009, « Écriture des identités multiples dans l’Allemagne unifiée » [En ligne], mis en ligne le 01 janvier 2010, consulté le 06 octobre 2020. URL : http:// journals.openedition.org/germanica/437 ; DOI : https://doi.org/10.4000/germanica.437 Ce document a été généré automatiquement le 6 octobre 2020. © Tous droits réservés 1 SOMMAIRE Avant-propos Anne-Marie Corbin I. Mosaïques Wie es leuchtet. Léonce et Léna de l’unification allemande Marie-Hélène Quéval Wie es leuchtet. Léonce et Léna de l’unification allemande Marie-Hélène Quéval Fonction identitaire de l’écriture chez Jakob Hein Hélène Yèche La poésie de Bert Papenfuß vingt ans après la chute du Mur – la politisation d’une poétique Cécile Millot II. Synthèses «Schön ist es in eurem banlieu.» «Wie wärsn’ mit der Wirklichkeit?» Black Box DDR Junge (ost-)deutsche (nicht-)dramatische Schreibpositionen Stefan Tigges Der junge deutsche Film seit 1998. Innovative Impulse, Themen, Literaturadaption Volker Wehdeking Écriture et plurilinguisme : « enrôlés dans la langue, arrivés en littérature » Nicole Bary III. Témoignages Achtzehn Einhundertneun – Lichtenhagen Anne Rabe Die RAF - ein Kapitel eines deutschen Familienromans Andres Veiel Jens Sparschuh Jens Sparschuh Hermann Kant Hermann Kant Germanica, 44 | 2009 2 Compte rendu de lecture Nadja Lux, «Alptraum: Deutschland», Traumversionen und Traumvisionen vom «Dritten Reich» Freiburg i. -

1 Karl Wilhelm Fricke: Widerstand Und Opposition Von 1945 Bis Ende Der Fünfziger Jahre Quelle: Deutscher Bundestag (Hrsg.): Ma
Karl Wilhelm Fricke: Widerstand und Opposition von 1945 bis Ende der fünfziger Jahre Quelle: Deutscher Bundestag (Hrsg.): Materialien der Enquete-Kommission. „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des Deutschen Bundestages), Bd. VII, Teil 1, S. 15-26. Auf eigene Definitionsversuche von Opposion und Dissidenz, Resistenz und Widerstand möchte ich hier verzichten. Sie blieben nach meiner Auffassung ohnehin fragwürdig, weil sich Geschichte, auch die Geschichte von Opposition und Widerstand in der DDR, als dialektischer Prozeß vollzieht und daher letztlich kaum definieren oder gar in das Prokrustesbett einer Theorie zwingen läßt. Der Berliner Historiker Peter Steinbach hat im Blick auf den Widerstand unter dem Hakenkreuz-Regime einmal geschrieben, daß „nicht primär eine historisch gesättigte Theorie des Widerstands anzustreben“ sei, „sondern eine möglichst farbige, inhaltlich und historisch differenzierte Gesamtgeschichte des Widerstands.“ Eine solche Gesamtgeschichte wäre ein wichtiger Beitrag der Historiker zu einer Theoriebildung oder, zumindest, zu einer Begriffsbestimmung von Opposition und Widerstand auch unter dem Regime der SED. Welche historischen Sachverhalte und Verhaltensweisen aus der Nachkriegszeit in der Sowjetischen Besatzungszone und aus den fünfziger Jahren in der DDR in eine solche Gesamtgeschichte einzubeziehen wären – eben dies will ich in der nächsten halben Stunde kurz aufzuzeigen versuchen als Einleitung zu einer hoffentlich lebhaften Diskussion mit den Zeitzeugen. Der -

A N N U a L R E P O R T 2004
A N N U A L R E P O R T 2004 and list of publications Bayerisches Forschungsinstitut für Experimentelle Geochemie und Geophysik Universität Bayreuth Bayerisches Geoinstitut Universität Bayreuth D-95440 Bayreuth Germany Telephone: +49-(0)921-55-3700 Telefax: +49-(0)921-55-3769 e-mail: [email protected] www: http://www.bgi.uni-bayreuth.de Editorial compilation by: Stefan Keyssner and Petra Ständner Section editors: Tiziana Boffa Ballaran, Natalia Dubrovinskaia, Leonid Dubrovinsky, Dan Frost, Florian Heidelbach, Catherine McCammon, David Rubie, Friedrich Seifert, Gerd Steinle-Neumann, Michael Terry Staff and guests of the Bayerisches Geoinstitut in July 2004: Die Mitarbeiter und Gäste des Bayerischen Geoinstituts im Juli 2004: First row, from left (1. Reihe, v. links) Martine Vernooij, Lydia Kison-Herzing, Sylvie Demouchy, Hélène Couvy, Tiziana Boffa Ballaran, Anastasia Kantor, Christina Schneider, Gerti Gollner, Yuki Asahara, Petra Ständner, Jun Liu Second row, from left (2. Reihe, v. links) Catherine McCammon, Holger Kriegl, Heinz Fischer, Oskar Leitner, Sven Linhardt, Geoffrey Bromiley, Kiyoshi Fujino, Hidenori Terasaki, Marco Pistorino, Wolfgang Böss Third row, from left (3. Reihe, v. links) Dave Rubie, Friedrich Seifert, Roman Skàla, Gerd Ramming, Martin Rigby, Bernhard Steinberger, Alexei Kuznetsov, Fiona Bromiley, Stefan Keyssner Fourth row, from left (4. Reihe, v. links) Florian Heidelbach, Gerd Steinle-Neumann, Innokenty Kantor, Detlef Krauße, Christian Liebske, Kurt Klasinski, Dan Frost, Antonio Piazzoni, Mike Terry Absent (Es fehlten) Matthias Bechmann, Ulrich Bläß, Ulrich Böhm, Natalia Dubrovinskaia, Leonid Dubrovinsky, Fabrice Gaillard, Giacomo Diego Gatta, Georg Herrmannsdörfer, Falko Langenhorst, Fred Marton, Fabrizio Nestola, Oliver Rausch, Bettina Schmickler, Hubert Schulze, Angelika Sebald, Andrei Shiryaev, Joseph Smyth, Emil Stoyanov, Iona Stretton Contents Foreword/Vorwort ............................................................................................................. -
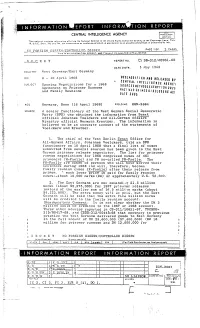
Information Eport Inform T1on Report -1Nformatio, N
•.4 INFORMATION EPORT INFORM T1ON REPORT CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY the EspIon•ce Lasse, Tilly This moirruisl enolnInt InformsIon •fferl i ng the 5•lsoot11 Defros, of the Untied 51•1rs the meaning of •rt unsulhotterd prison in ptohthiled hy 18, U.S.C. Secs, 7 ,1.1 sod 7 , 14, the ifsnsoni•ston or revels1ton of sehleh In •ny tn•nner, to PAGE 1 OF 3 PAGES ____FD_ZORT,I0N—P1.3.UM/C0.!:;_TROLLT0_,DI58U TtliS IS Jot It4e0nor•TION REPORT, tica rist•LL y (VALUATED INTELLIOENCE SELRET REPORT NO. CS DB-312/00961-68 DATEDMTR. 3 May 1968 COUNTRY West Germany/East Germany DM 6 - 10 April 1968 DECLASSIFIED LALNIDGERNEL EASE D NBUY C SUBJECT Opening Negotiations for a 1968 CE AGE f SOURCESMET Agreement on Prisoner Ransoms HODSEXEMPT ION 3D2E NAZI and Family Reunions WAR CR IMES DI S CLOSURE ACI GATE 2005 ACO Germany, Bonn (16 April 1968) FIELD NO. EGN-3684 SOURCE A senior functionary of the West German Social Democratic Party (SPD) who obtained the information from Senat official Johannes Voelckers and All-German Affairs Ministry official Hermann,Kreutzer. The information is believed to be an accurate account of the statements of Voelckers . and Kreutzer. I. The chief of the West Berlin Senat Office for All-German Affairs, Johannes Voelckers, tDld an SPD functionary on 10 April 1968 that a final list of names submitted from several sources has been given to the East German prisoner release negotiator. The list for prisoner ransom negotiations for 1968 comprised names of 461 prisoners (H-Fnelle) and 78 so-called FH-Faelle. -

Catholic and Protestant Faith Communities in Thuringia After the Second World War, 1945-1948
Catholic and Protestant faith communities in Thuringia after the Second World War, 1945-1948 A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in History in the University of Canterbury By Luke Fenwick University of Canterbury 2007 Table of contents Abstract 1 Acknowledgements 2 List of abbreviations 4 List of figures and maps 5 Introduction 6 Chapter 1: The end of the war, the occupiers and the churches 28 Chapter 2: The churches and the secular authorities, 1945-1948 51 Chapter 3: Church efforts in pastoral and material care, 1945-1948 77 Chapter 4: Church popularity and stagnation, 1945-1948 100 Chapter 5: The social influence of the churches: native Thuringians and refugees 127 Chapter 6: The churches, the Nazi past and denazification 144 Chapter 7: Church conceptions of guilt and community attitudes to the Nazi past 166 Conclusion: The position and influence of the churches 183 Maps 191 Bibliography 197 II Abstract In 1945, many parts of Germany lay in rubble and there was a Zeitgeist of exhaustion, apathy, frustration and, in places, shame. German society was disorientated and the Catholic and Protestant churches were the only surviving mass institutions that remained relatively independent from the former Nazi State. Allowed a general religious freedom by the occupying forces, the churches provided the German population with important spiritual and material support that established their vital post-war role in society. The churches enjoyed widespread popular support and, in October 1946, over 90 percent of the population in the Soviet zone (SBZ) claimed membership in either confession. -

„...Die SPD Aber Aufgehört Hat Zu Existieren" Sozialdemokraten Unter Sowjetischer Besatzung
Beatrix W. Bouvier Horst Peter Schulz (Herausgeber) „...die SPD aber aufgehört hat zu existieren" Sozialdemokraten unter sowjetischer Besatzung Verlag J.H.W. Dietz Nachf. ISBN 3-8012-0162-7 „...die SPD aber hat aufgehört zu existieren." Copyright C 1991 by Verlag J. H. W. Dietz Nachf. GmbH, Bonn In der Raste 2, D-5300 Bonn 1 Aus einer Analyse Erich W. Gniffkes zur Lage der SPD in der SBZ Umschlag: Manfred Waller, Reinbek (unter Verwendung eines Fotos vom 70. Februar 7946, in der es heißt. ,,Wie in den Gewerkschaften vom Archiv der sozialen Demokratie in der Friedrich-Ebert-Stiftung) besetzt auch in der zukünftigen Einheitspartei die KPD alle Schlüssel- Satz: Fotosatzstudio typo bonn, Bonn Druck und Verarbeitung: Fuldaer Verlagsanstalt GmbH stellungen und nichts anderes kommt bei der Vereinigung heraus, als Alle Rechte vorbehalten daß die KPD ihren Namen abgelegt und einen neuen Apparat hat, Printed in Germany 1991 die SPD aber aufgehört hat zu existieren." Inhalt Einleitung: Sozialdemokraten unter sowjetischer Besatzung ...... 9 Dokumente: Interviews mit Sozialdemokraten über die Nachkriegszeit in der Sowjetischen Besatzungszone 1. Interview mit S. F., Vorstandssekretär des ZA der SPD in Berlin .............. 51 2. Interview mit S. G., Bezirksvorsitzender der SPD in Magdeburg ............... 89 3. Interview mit D. R., SPD-Bezirkssekretär in Magdeburg .................... 107 4. Interview mit M. H., SPD-Redakteur in Magdeburg ......................... 123 5. Interview mit D. F., Vizepräsident der Bezirksverwaltung Merseburg . 147 6. Interview mit W. A., FDGB-Sekretär in Sachsen-Anhalt ...................... 171 7. Interview mit P. H., SPD-Jugendsekretär in Halle-Merseburg ................. 183 B. Interview mit T. S., Kreisvorsitzender der SPD in Leipzig .................... 203 9. -

Executive Intelligence Review, Volume 23, Number 10, March 1, 1996
(7.hope to convince you tha� in order to solve the political problem in experience) one must take the path F IDELIO Joum(lj(If Poctry,Sdem::c, �nd St1lccralt through the aesthetical) because it is through Beauty that one proceeds to Freedom.)) - Friedrich Schiller FIDELIC) FIDELIO Journal of Poetry, Science, and Statecraft Publisher of LaRouche's major theoretical writings. Sign me up for Fidelio: $20 for 4 issues NAME ________________________________________ ADDRESS ______________________________________ CITY ____--""- _________ STATE ____ ZIP _____ TEL (day),_________________ (eve) ___________ __ Make checks or money orders payable to: Schiller Institute, Inc. Dept E. P.O. Box 20244 Washington, D.C. 20041-0244 Founder and Contributing Editor: Lyndon H. LaRouche, Jr. Editorial Board: Melvin Klenetsky, Antony From theAssociate Editor Papert, Gerald Rose, Dennis Small, Edward Spannaus, Nancy Spannaus, Jeffrey Steinberg, Webster Tarpley, Carol White, Christopher White Senior Editor: Nora Hamerman T here are two images that have lingered in the minds of just about Associate Editor: Susan Welsh Managing Editors: John Sigerson, everyone who attended the inspiring Presidents' Day conference of Ronald Kokinda the Schiller Institute and the International Caucus of Labor Commit Science and Technology: Carol White tees. First is the one on our cover, Shakespeare's Hamlet: As Lyndon Special Projects: Mark Burdman Book Editor: Katherine Notley LaRouche describes in his keynote speech (see Feature), Hamlet was Advertising Director: Marsha Freeman a miserable coward, preferring to die, rather than to give up the false Circulation Manager: Stanley Ezrol beliefs that were leading him-and the State of Denmark-to certain INTELLIGENCE DIRECTORS: Agriculture: Marcia Merry destruction. -

Zwei Jahre in Mielkes Bunker in Die Einzelhaft Gezogen Bin
94 Protokoll der 67. Sitzung zwei Jahre in Mielkes Bunker in die Einzelhaft gezogen bin. Da habe ich den Widerstand auf meine Art gemacht, indem ich später, als ich wieder rauskam und die DDR die Mauer hatte und ich nicht fliehen konnte, um mich bei Freund Finn in der KgU oder sonstwo zu bekümmern, fünf Jahre für Marion GräfinDönhoff unter Pseudonym geschrieben habe. Dafür bekam ich den ersten Preis des DDR-Journalisten-Verbandes: Sieben Jahre Zuchthaus. (Beifall – Heiterkeit) Rudi Molt: Ich beneide Herrn Borkowski um sein Temperament und sein darstellerisches Talent. Das ist mir leider nicht gegeben. Mein Name ist Rudi Molt. Ich bin 1952 in Ost-Berlin geboren, im Prenzlauer Berg, bin dort auch aufgewachsen, habe die Erweiterte Oberschule in Berlin-Pankow, die Carl-von-Ossietzky-Schule, besucht, die später noch zu etwas trauriger Bekanntheit gelangte, als im Jahre 1988 einige Schüler dort relegiert wurden. Das kam übrigens auch schon zu meiner Schulzeit dort vor. Ich war von 1966 bis 1970 an dieser Schule. Auch damals wurden schon Mitschüler von mir von der Schule geworfen im Zusammenhang mit einem Ereignis, auf das Herr Knabe vorhin auch kurz schon einging: das angebliche Konzert der Rolling Stones auf dem Springer-Hochhaus. Viele Jugendliche aus Ost-Berlin zogen nämlich in die Nähe der Mauer, in der Hoffnung, die Stones dort oben spielen zu sehen und zu hören. Die wurden natürlich zum großen Teil weggefangen von der Polizei und von der Stasi. Die Strafen waren dann beispielsweise, daß die Leute von der Schule geflogen sind. Ich habe nach dem Abitur an der Humboldt-Universität bis 1974 Physik stu- diert und anschließend an der Akademie der Wissenschaften in Adlershof als Physiker gearbeitet. -

Bericht 2011 (3,6
Deutsche Gesellschaft e.V. Inhalt Vorwort 3 Preis der Deutschen Gesellschaft e. V. 4 Gedenkjahr „50 Jahre Mauerbau“ Symposium: Flucht, Ausreise, Freikauf 6 Zeitzeugen zu Besuch in Schulen 7 Literaturtagung: Geteilter Himmel – geteiltes Land? 8 Lesereihe: Die Mauer verändert alles – überall 9 Ausstellung: Die Mauer 1961-1989. Fotografien von Uwe Gerig 10 Ausstellung: Unerkannt durch Freundesland 11 Freiheits- und Einheitsdenkmal 12 Politik & Gesellschaft Talk am Salzufer in der Mercedes-Welt Berlin 13 Konferenz: Von der SED-Diktatur zum Rechtsstaat 14 Ideenwettbewerb: Werte und Wertewandel 16 Plakatwettbewerb: Argumente statt Gewalt 17 Workshop: Freiheit ist … 18 Workshop: Jugend im Visier der Stasi 19 Neuanfang im Westen – Zeitzeugengespräche 19 Planspiel: Zentraler Runder Tisch 20 Aktionsprogramm gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit 21 Präventionsworkshop gegen (Links-)Extremismus 22 EU & Europa Europäisches Informationszentrum 23 Veranstaltungsreihe: Europa vor Ort 24 EU-Boosts – Exkursionen zu EU-Klimaschutz-Projekten 25 Wanderaustellung: Den Blick gegen das Vergessen 26 Kolloquium: Weltkriegsmuseum Danzig 27 Info-Aktionen zu EU und Europa 27 Kultur & Geschichte Mittel- und südosteuropäische Medientage 28 Erzählwerkstatt „Es schläft ein Lied in allen Dingen …“ 29 Lesung: Ana Blandiana und Hans Bergel 29 Spurensuche auf dem jüdischen Friedhof Weißensee 30 Schüler-Pilotprojekt zur jüdischen Kultur in Deutschland „Stolpern interkulturell“ 30 Wandergesellentreffen in Hermannstadt 31 Kulturerbe – Der Freundeskreis Schlösser und Gärten in der Deutschen Gesellschaft e. V. 32 Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e. V. 34 Deutsche Gesellschaft e. V. Kuratorium 36 Mitglieder 38 Partner, Förderer und Sponsoren 40 Mitarbeiter 42 IMPRESSUM 43 Sehr geehrte Damen und Herren, erfreut blicken wir auf das Jahr 2011 zurück! Die Deut- Jahres 2011. In Kooperation mit der Bundesstiftung zur sche Gesellschaft e.