Naturerleben Kaiserweg-Bodfeld
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
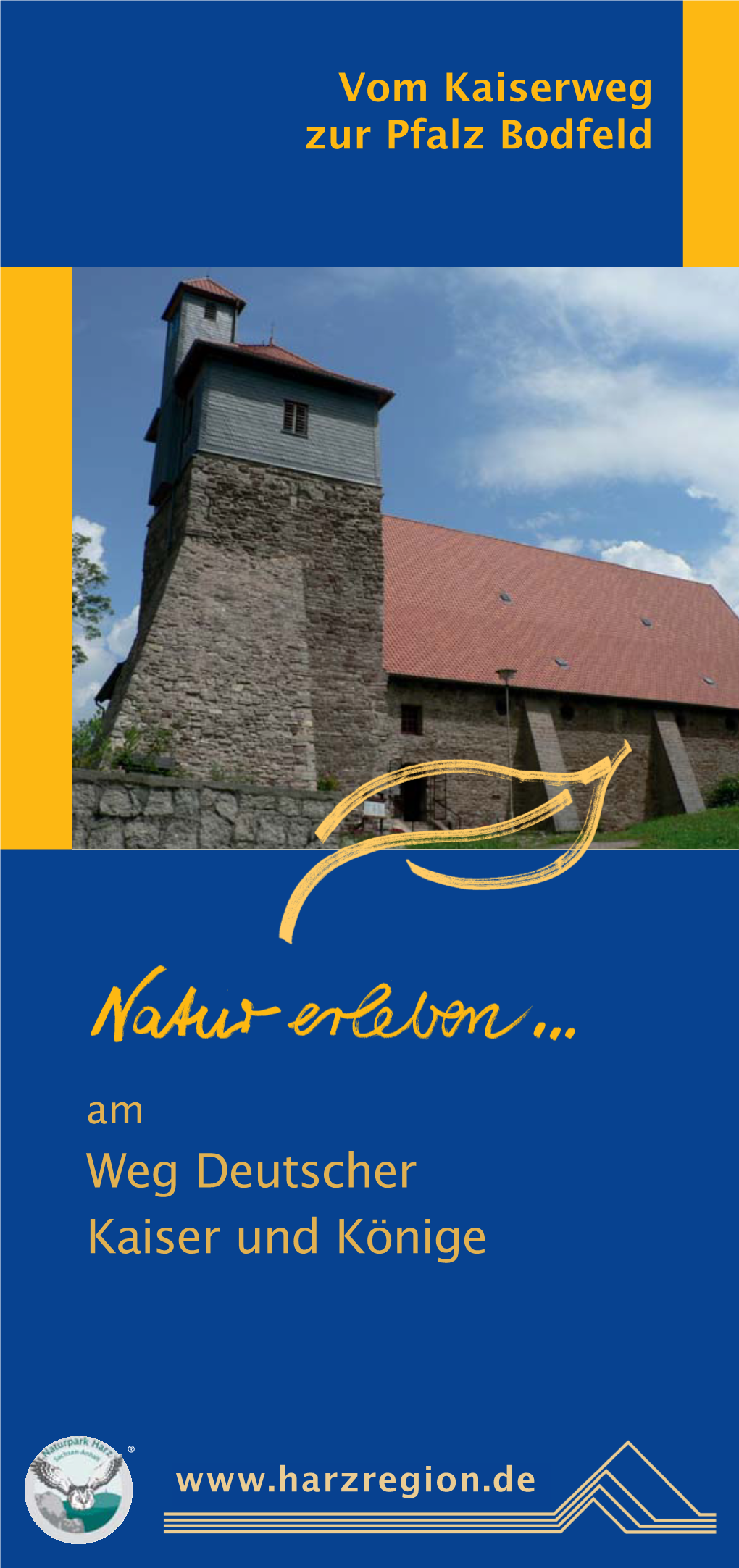
Load more
Recommended publications
-

Der Nordharz Rund Um Den Brocken
Imha1t Vorwort 8 Einleitung 10 Der Nordharz 1 Teufelsmauer 6-8 Std. # 18 Auf einen Ritt von Ballenstedt nach Blankenburg 2 Volkmarskeller 3 Std. # 22 Zu den Ursprüngen des Klosters Michaelstein 3 Steinerne Renne / 3.30 Std. # 26 Traumpfad mit tönendem Ambiente 4 Ilsetal und Ilsestein 4 Std. 0 30 Der Fall Ilse 5 Rabenklippe 3-4 Std. # 34 Lust auf Pinselohren Rund um den Brocken 6 Teufelsstieg 8-9 Std. # 38 Teufelsklauen am Weg zum Brocken 7 Achtermannshöhe 1.30-2 Std. # 42 Der Harz - ein Wintermärchen http://d-nb.info/1017744556 8 Wurmberg 3 Std. £ 44 Von Mythen und Alltag 9 Elendstal 2-3 Std. # 46 Magische Felsen: Scherstor- und Schnarcherklippen 10 Brocken 4 Std. £ 48 Ein Kindheitstraum wird wahr 11 Hohnekamm 4 Std. % 52 Ein Blick auf den Anfang der Erde Der westliche Harz 12 Okerklippen 3 Std. # 56 Zu den Felsentempeln der Vorzeit 13 Bocksberg 1.30 Std. # 60 Der Höhepunkt liegt hier im Tal 14 Wolfswarte 4 Std. # 62 Von Kräutern und Wölfen am Bruchberg 15 Hiibichenstein 3-4 Std. # 64 Das Korallenriff im Gebirge 16 Alter Dammgraben 4-4.30 Std. # 68 Auftanken am Harzer Wasserregal 17 Sankt Andreasberg 3-4 Std. # 72 Zwischen Vulkan und Neptun VULT 18 Oderteich 4 Std. # 74 Vom Sonnenberg und Sonnentau 19 Lonau 2-3 Std. % 76 Auf der Fährte des Auerhahns 20 Scharzfeld 4 Std. # 78 Heiligtümer unserer Vorfahren 21 Ravensberg 2 Std. # 82 Lockere Gipfelwanderung für Genießer Der östliche Harz 22 Königshütte 3 Std. 0 86 Ein Gang zu Hütten und Palästen 23 Mandelholz 2 Std. -
11701-19-A0558 RVH Landmarke 4 Engl
Landmark 4 Brocken ® On the 17th of November, 2015, during the 38th UNESCO General Assembly, the 195 member states of the United Nations resolved to introduce a new title. As a result, Geoparks can be distinguished as UNESCO Global Geoparks. As early as 2004, 25 European and Chinese Geoparks had founded the Global Geoparks Network (GGN). In autumn of that year Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen became part of the network. In addition, there are various regional networks, among them the European Geoparks Network (EGN). These coordinate international cooperation. 22 Königslutter 28 ® 1 cm = 26 km 20 Oschersleben 27 18 14 Goslar Halberstadt 3 2 1 8 Quedlinburg 4 OsterodeOsterodee a.H.a.Ha H.. 9 11 5 13 15 161 6 10 17 19 7 Sangerhausen Nordhausen 12 21 In the above overview map you can see the locations of all UNESCO Global Geoparks in Europe, including UNESCO Global Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen and the borders of its parts. UNESCO-Geoparks are clearly defi ned, unique areas, in which geosites and landscapes of international geological importance are found. The purpose of every UNESCO-Geopark is to protect the geological heritage and to promote environmental education and sustainable regional development. Actions which can infl ict considerable damage on geosites are forbidden by law. A Highlight of a Harz Visit 1 The Brocken A walk up the Brocken can begin at many of the Landmark’s Geopoints, or one can take the Brockenbahn from Wernigerode or Drei Annen-Hohne via Schierke up to the highest mountain of the Geopark (1,141 meters a.s.l.). -
RVH Straße Der Romanik WR
Im Zeichen des Uhu Zwischen Regenstein und Ilsenstein an der Straße der Romanik ® WALTHER VON DER VOGELWEIDE (um 1160 – um 1230) Spruchdichter und Minnesänger Kaum wegen außergewöhnlicher Schönheit sondern vielmehr wegen ihrer Seltenheit erwecken bestimmte wildlebenden Tier- und Pflanzenarten das besondere Interesse von Naturliebhabern. Dort wo viele seltene Arten auf engem Raum vorkommen, wurden zu ihrer Erhaltung Naturschutzgebiete ausgewiesen. Natur- schutzgebiete sind innerhalb unserer Kulturland- schaften etwas Besonderes. Meist fahren wir achtlos an den Weizenfeldern im Harzvorland vorbei, bestaunen aber Einkorn, Emmer und Dinkel als alte Nutzpflanzen in Schaugärten. Auch hier ist die Erklärung einfach: Diese Getreidearten sind selten, waren be- deutsam bis in das Mittelalter. Um sie heute noch be- wundern zu können, müssen wir lange suchen, finden sie schließ- lich in den Kloster- gärten Michael- stein. Garten Kloster Michaelstein Interessieren wir uns außerdem für Zeugnisse verschiedener Architektur- epochen, so finden wir eindrucksvolle Jugendstilbauten vielerorts zwischen München oder Riga, bewundern die barocke Pracht des Dresdener Zwingers ebenso, wie die unzähliger bayerischer Kirchen dieser Epoche, kennen die Re- naissancerathäuser von Augsburg über Leipzig bis Bremen. Älter sind die Bau- werke der Gotik wie der Kölner und der Magdeburger Dom. Seltener, weil noch älter, sind Bauwerke aus der Endzeit des Frühen Mittelalters. Es sind Zeug- nisse romanischer Architektur, die – gleichsam seltener Tier- und Pflanzen- arten in Naturschutzgebieten – in kaum einer Region Deutschlands in solcher Dichte und Vielfalt zu finden sind, wie Blick auf Langeln in der Region rings um den Harz: Von der Pfalz Tilleda, den Burgruinen Hohnstein und Osterode im Süden über die Stiftskirchen St. Anastasius und St. Innocentius Bad Gandersheim im Westen sowie St. -

Abbenrode - Das Dorf an Der Ecker : Informationsschrift Über Die Ortsgeschichte Der Gemeinde Abbenrode Von Der Ersten Ansiedlung Bis Zur Gegenwart
Abbenrode - das Dorf an der Ecker : Informationsschrift über die Ortsgeschichte der Gemeinde Abbenrode von der ersten Ansiedlung bis zur Gegenwart. Hrsg. vom Rat der Gemeinde Abbenrode, erarb. vom Chronistenkollektiv. Abbenrode 1989. 53 S. - Bc 245 (G) - Abert, Paul: Durch den Harz. Leipzig 1926. VIII, 228 S. (Storm Reiseführer) - Ab 184 (K) - Archäologische Berichte aus Sachsen-Anhalt. Landesamt für archäologische Denk- malpflege Sachsen-Anhalt, Landesmuseum für Vorgeschichte. Halle (Saale) Erscheint jährl. 1993 (1994) 1994 (1996) 1995 (1996) - Ae 330 (K) - Heimatblätter der Kreises Artern. [Hrsg.: Kulturbund zur demokratischen Erneue- rung Deutschlands, Kreisleitung Sangerhausen in Verbindung mit dem Rat des Kreises, Abteilung Kultur, Sangerhausen]. Sangerhausen Auch u.d.T.: Heimatblätter des Kreises Sangerhausen. - Erschien mehrmals jährl. 6 (1954) 7-9, 13 (1955) 17, 18 (1956) - Ec 70 (K) - Zeitschrift des Vereins für Heimatkunde, Geschichte und Schutz von Artern e. V. - Aratora : (Neugründung 29.10.1990). Hrsg. vom Vorstand des Heimatvereins Ara- tora Artern e.V. Artern Erscheint jährl. 1 (1991) 4 (1994) 7 (1997) 2 (1992) 5 (1995) 8 (1998) 3 (1993) 6 (1996) - Ec 37 (G) - Aschersleben Schulprogrammschriften des Gymnasiums 1831 - 1910 - Ea 65-67 (K) - Die 150jährige Geschichte des Wasserheilbades Bad Lauterberg im Harz : Wirkung und Hoffnung - das ganzheitliche Gesundheitsprinzip Sebastian Kneipps bleibt immer gültig. Hrsg. vom Kneippverein Bad Lauterberg im Harz e.V. Bad Lauterberg [1989?] - Bh 207 (K) - Heimatbuch und Wanderführer für Bad Sachsa. [Zsgest. von Hans Horn und F. W. Biertimpel-Gallen]. Osterode/Harz 1950. 75, [16] S. - Bg 38 (K) - Blankenburg Schulprogrammschriften des Gymnasiums 1841 - 1915 - Bd 103 / Bd 132 (K) - Der Kurgast : amtliche Kurzeitung des Heilbades Blankenburg, Harz. -

Heile Welt Nationalpark? Tagung 2018 in Drübeck
SCHRIFTENREIHE AUS DEM NATIONALPARK HARZ - BAND 17 Heile Welt Nationalpark? Tagung 2018 in Drübeck Heile Welt Nationalpark? Tagung 2018 in Drübeck Herausgegeben von der Nationalparkverwaltung Harz Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz Band 17 Zitiervorschlag: NATIONALPARKVERWALTUNG HARZ (2019) (Hrsg.): Heile Welt Nationalpark? Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz, Band 17. 84 Seiten. Impressum Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz ISSN 2199-0182 Herausgeber: Nationalparkverwaltung Harz Lindenallee 35 38855 Wernigerode www.nationalpark-harz.de Für den Inhalt der Artikel sind ausschließlich die jeweiligen Autoren verantwortlich. Redaktion: Nationalpark Harz Dr. Kathrin Baumann Titelfoto: Dr. Kathrin Baumann 1. Auflage 2019 INHALT | 3 Inhalt Vorwort 4 Nationalparke als Käseglocken? Ergebnisse aus der naturwissenschaftlichen Forschung KATHLEEN PREISSLER, VANESSA SCHULZ, SEBASTIAN STEINFARTZ, Leipzig Das Bedrohungspotential von Amphibien-Chytridpilzen für die Charakterart Feuersalamander – Fokus Nationalpark Harz 5 OLE ANDERS, St. Andreasberg Nationalparks – Eine Chance für den Luchs? 14 HERWIG ZANG, Goslar Langzeitstudien an Kleinhöhlenbrütern im Harz 19 KATHRIN BAUMANN, Wernigerode Neuartige Veränderungen der Vegetation und der Libellenfauna in den Mooren des Harzes ‒ Grenzen der Schutzmöglichkeiten eines Nationalparks 25 PETER MEYER, Göttingen Natürliche Dynamik mitteleuropäischer Fichtenwälder unter dem Einfluss des Klimawandels am Beispiel der Waldforschungsfläche Bruchberg im Nationalpark Harz 34 Rechtliche Rahmenbedingungen für -

K1b L Ö SUNG 1. in Welcher Stadt Wurde
K1b L Ö S U N G 1. In welcher Stadt wurde Heinrich IV. geboren? Goslar Am 11. November 1050 wurde der erste männliche Nachfahre (Heinrich IV.) und heißersehnter Thronfolger des Sachsenkaisers Heinrich III. und Agnes von Poitou aus Aquitanien in Goslar geboren. 2. Welche beiden Persönlichkeiten spielten beim Kniefall von Chiavenna die entscheidenden Rollen? Heinrich der Löwe Friedrich I. Barbarossa Der Kniefall von Chiavenna 1176 Kaiser Friedrich Barbarossa wollte die frühere Macht des Römerreiches wiederherstellen, stieß jedoch auf den erbitterten Widerstand der oberitalienischen Städte, die von Papst Alexander III. unterstützt wurden. Für seine Hilfe hatte er dem Braunschweiger Fürsten, „Heinrich, der Löwe“, das Herzogtum Bayern als Lehen zugesprochen. Als Friedrich erneut Hilfe erbat, verlangte sein Vetter Heinrich dafür Goslar und den Rammelsberg; der Kaiser lehnte ab. Heinrich war daraufhin nicht zur Heerfolge bereit. Später wurde der mächtige Heinrich verbannt und ging zu seinem Schwiegervater, dem König von England. Auch das bayrische Lehen wurde ihm wieder abgenommen. So endete der Streit der beiden überragenden politischen Figuren des 12. Jahrhunderts zugunsten des Kaisers. 3. Welche beiden großen Persönlichkeiten der damaligen Zeit trafen sich in Goslar zur Weihe der Stiftskirche St. Simon und Judas Thaddäus (Goslarer Dom)? Papst Victor II. Heinrich III. Kaiser Heinrich III. aus dem Hause der Salier empfing Papst Viktor II., der mit großem Gefolge anreiste. In Anwesenheit vieler Bischöfe wurde die Weihe des Domes vorgenommen. Heinrich III. residierte damals in der Kaiserpfalz und befand sich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Sein Reich umfasste Deutschland, Italien und Burgund, und sein Einfluss reichte weit in die östlichen Länder. Wenige Wochen später jedoch starb er auf einer Jagd im Harz. -

Der Ilsetaler Wernigerode – Ilsenburg – Plessenburg – Drei Annen Hohne Täglich 10:30 Uhr Und Samstags Zusätzlich 14:00 Uhr (U
Erleben Sie Wernigerodes Altstadt unter sachkundiger Führung: Ramona Reichpietsch Foto: Der Ilsetaler Wernigerode – Ilsenburg – Plessenburg – Drei Annen Hohne täglich 10:30 Uhr und samstags zusätzlich 14:00 Uhr (u. a. Themenführungen) Treffpunkt: Tourist-Information Wernigerode Busfahrplan · Routenplan Marktplatz 10 Ihre Nummer Informationen und Empfehlungen für Fahrplan- und Ihr Ansprechpartner vor Ort: ILSENBURG andere Auskünfte Wernigerode Tourismus GmbH Entdecken Sie Ilsenburg (0391) 5363180 Marktplatz 10 und den schönsten Weg zum Brocken. 38855 Wernigerode Telefon (0 39 43) 5 53 78-35 www.ilsenburg.de Fax (0 39 43) 5 53 78-99 www.wernigerode-tourismus.de [email protected] Veranstaltungen im Nationalpark Harz 2016 Wandern & Natur 15. Juni, 12. Juli & 13. September, jeweils 10 Uhr Der schönste Weg zum Brocken – Heinrich-Heine-Wanderweg | Mit dem Ranger im Ilsetal auf Goethes und Heines Spuren, ca. 3-4 Stunden Harzer Klosterwanderweg | wildromantisches Ilsetal | Treffpunkt: Ilsenburg, Nationalparkhaus Ilsetal, 9 Uhr (Nähe Haltestelle Nr. 13) Harzer Grenzweg „Am Grünen Band“ | Nationalparkhaus im Ilsetal 16. August, 10 Uhr Wanderung mit dem Nationalpark-Förster zwischen Ecker und Ilse auf dem Kultur Grünen Band, ca. 2-3 Stunden Klöster Ilsenburg & Drübeck | Hütten- und Technikmuseum | Öffnungszeiten Treffpunkt: Ilsenburg, Marktplatz, 10 Uhr (Nähe Haltestelle Nr. 11) Di - Fr 12 - 18 Uhr Ilsenburger Eisenpfad Sa - So 10 - 18 Uhr Mit dem Ilsetaler erreichen Sie außerdem bequem mit der ganzen Familie den Ferien in Sachsen-Anhalt Löwenzahn-Entdeckerpfad (Haltestelle Nr. 22) und das Natur-Erlebniszentrum Mo - So 10 - 18 Uhr Aktiv bilderfabrik – Das Fotostudio © Foto: HohneHof (Haltestelle Nr. 21) mit seinem umfangreichen Programmangebot. Die Öffnungszeiten können variieren. Erlebniswald Ilsetal-Kletterpark | Ilsetaler Cross Roller | Kneippanlage | Bitte informieren Sie sich telefonisch MTB- und E-Bike Verleih | MTB Streckennetz Auskünfte und Informationen zu diesen und weiteren Angeboten und Veranstal- oder auf unserer Internetseite. -

Gastgeberverzeichnis 2018 C D Crolastraße B3/B4 Darlingeröder Straße D5 GÜTESIEGEL Ankommen
Straßenverzeichnis Straßenverzeichnis KLASSIFIZIERUNG Ilsenburg Ortsteil Drübeck Hotelklassifi zierung DEHOGA Zimmerklassifi zierung DTV A A ILSENBURG Apfelweg A3 Am Kamp C5 Luxus Erstklassiger Komfort Zusatz S Superior Auf der See B2 Am Thie C4/C5 First Class Gehobener Komfort Spitzenbetrieb innerhalb einer Kategorie Alte Gartenstraße A1 Am Schützenhaus C4/D4 Die herzlichsten Gastgeber im Harz Komfort mit besonders hohem Dienstleistungsmaß. Alte Schmiedestraße A3 Am Osttor D6 Guter Komfort Blaue-Stein-Straße C1 B Standard Mittlerer Komfort Buchbergtraße C1/C2 Backhausgasse C5 Tourist Einfacher Komfort Gastgeberverzeichnis 2018 C D Crolastraße B3/B4 Darlingeröder Straße D5 GÜTESIEGEL Ankommen . Entspannen . Genießen D F Damaschkestraße B3/B4 Forstweg C5 Qualität mit Flair und Siegel F H Alle Flair Hotels erfüllen mindestens die 3-Sterne-Klassifi zierung des Deutschen Hotel- und Gast- Faktoreistraße B2 Hauptstraße C5 stättenverbandes DEHOGA. Friedensstraße A2/A3 I G Ilsenburger Straße C4/C5 Gütesiegel ServiceQualität Deutschland Goetheweg B4 K Hotels mit Qualitätsmanagementsystem zur Überprüfung und Verbesserung der Servicequalität. Grüne Straße B2 Klostergarten C5 H Kirschberg D5 Hagenbergstraße B3 Kutschweg D5 Harzburger Straße A2/B2 Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland Kinder unter 16 Jahre L Gütesiegel für wanderfreundliche Gastgeber (nach den Kriterien des Deutschen Heinrich-Heine-Straße B3/4 Lindenallee E5 Hochofenstraße B3 Wanderverbandes). Kurtaxe frei O I Oehrenfelder Straße D5 Bitte beachten Sie, dass die aufgeführten Klassifi -

Schule Träger ESF-Programmschulen Und
ESF-Programmschulen und Projektträger im Landkreis Harz Stand: November 2019 Schule Träger IB Mitte gGmbH, NL Sachsen-Anhalt, Kinder- und Berufsbildende Schulen "Geschwister Scholl" Standort Halberstadt Jugendhilfezentrum Harz IB Mitte gGmbH, NL Sachsen-Anhalt, Kinder- und Berufsbildende Schulen "J.P.C. Heinrich Mette" Quedlinburg Jugendhilfezentrum Harz IB Mitte gGmbH, NL Sachsen-Anhalt, Kinder- und Berufsbildende Schulen Landkreis Harz Jugendhilfezentrum Harz Bosseschule Quedlinburg AWO Kreisverband Harz e.V. IB Mitte gGmbH, NL Sachsen-Anhalt, Kinder- und Europa- und Ganztagsschule "August Bebel" Blankenburg Jugendhilfezentrum Harz Fallstein-Gymnasium Osterwieck Gemeinnützige Paritätische Sozialwerke - PSW GmbH Caritasverband für das Bistum Magdeburg, Dekanat Förderschule "Albert Schweitzer" Halberstadt Halberstadt Caritasverband für das Bistum Magdeburg, Dekanat Förderschule "David-Sachs-Schule" Quedlinburg Halberstadt Förderschule "Pestalozzi" Wernigerode Gemeinnützige Paritätische Sozialwerke - PSW GmbH IB Mitte gGmbH, NL Sachsen-Anhalt, Kinder- und Goethe-Sekundarschule Ilsenburg Jugendhilfezentrum Harz Seite 1 ESF-Programmschulen und Projektträger im Landkreis Harz Stand: November 2019 Schule Träger Grundschule "Albert Klaus" Badersleben AWO Kreisverband Harz e.V. Grundschule "Am Regenstein" Blankenburg Gemeinnützige Paritätische Sozialwerke - PSW GmbH Grundschule "Aue-Fallstein" Hessen Gemeinnützige Paritätische Sozialwerke - PSW GmbH Grundschule "Auf den Höhen" Thale Sozialzentrum Bode e. V. Grundschule "Dr. Wilhelm Schmidt" -

Beitrag Zur Kenntnis Der Molluskenfauna Des
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Hercynia Jahr/Year: 2003 Band/Volume: 36 Autor(en)/Author(s): Unruh Michael Artikel/Article: Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna des östlichen Nordharzes 261- 284 ©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ISSN 0018-0637 Hercynia N. F. 36 (2003): 261–284 261 Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna des östlichen Nordharzes* Michael UNRUH 5 Abbildungen und 5 Tabellen ABSTRACT Unruh, M.: Notes on the mollusc fauna of the northern Harz Mountains. - Hercynia N.F. 36 (2003): 261–284. Between 1998 and 2003 the mollusc fauna had been investigated in the eastern part of the northern Harz Mountains in 73 terrestrial and 16 limnic habitats. The study mainly concentrated on regions of the moun- tain Brocken and of the core zone of the National Park “Hochharz”, where rough ecological conditions especially extreme temperatures and a lack of nutrients prevail. Furthermore the valleys of the rivulets Ecker and Ilse had been studied more intensively. Finally known records of species characteristic for the Harz Mountains were checked to receive a picture of the current status of rare species. Altogether 83 species of terrestrial snails, 6 species of water snails, and 8 species of mussels were found. The number of species increases with diminishing altitude, with improving climatic conditions, as well as with improving nutrient availability. It reaches its peak in the nutrient-rich, buffered alder-ash forests and slope-ravine forests of the lower Harz Mountains. In the spruce forests, the spectrum consists only of 3–4 species. -

Wegeplan Für Den Nationalpark Harz Wegeplan Für Den Nationalpark Harz 2011 - 2020
2011 - 2020 Wegeplan für den Nationalpark Harz Wegeplan für den Nationalpark Harz 2011 - 2020 Herausgegeben von der Nationalparkverwaltung Harz Wernigerode, März 2011 Impressum Nationalparkverwaltung Harz Lindenallee 35 38855 Wernigerode www.nationalpark-harz.de Titelfoto: S. Richter 2011 INHALT | 3 Inhalt Teil I: Allgemeiner Teil 3 Umsetzungsstand der bisherigen Wegepläne 19 3.1 Allgemeines 19 Gegenwärtiger Zustand und beabsichtigte 3.2 Wege und Wegenutzung 19 Entwicklung der Wege, Loipen und sonstigen 3.2.1 Betriebliche Wege 21 Flächen, die nicht dem öffentlichen Verkehr 3.2.2 Wanderwege 22 gewidmet sind 3.2.2.1 Allgemeine Wanderwege 22 3.2.2.2 Sonderwege 22 1 Rechtlicher Rahmen für die Wegeplanung 6 3.2.3 Wintersporteinrichtungen 24 1.1 Allgemeine Vorgaben 6 3.2.3.1 Loipen 24 1.2 Gesetzliche Sonderregelungen im 3.2.3.2 Skiwanderwege 24 Zusammenhang mit Betretensrecht 6 3.2.3.3 Winterwanderwege 24 3.2.3.4 Wettkampfloipen 24 2 Bestand (Stand: 31.12.2009) 8 3.2.3.5 Alpinski 24 2.1 Allgemein 8 3.2.3.6 Rodeln 24 2.1.1 Wegebestand 8 3.2.4 Rad- und Mountainbike-Wege 24 2.1.2 Verkehrssicherung 8 3.2.5 Reitwege 25 2.2 Wege und Wegenutzung 9 3.2.6 Kutsch- und Schlittenfahrten 25 2.2.1 Betriebliche Wege 9 3.3 Infrastruktur 25 2.2.2 Wanderwege 10 3.3.1 Parkplätze 25 2.2.2.1 Allgemeine Wanderwege 10 3.3.2 Aussichtspunkte 26 2.2.2.2 Sonderwege 10 3.3.3 Besucherlenkungseinrichtungen 26 2.2.3 Wintersporteinrichtungen 11 3.3.4 Erholungseinrichtungen 26 2.2.3.1 Loipen 11 3.3.5 Besondere Besuchereinrichtungen 26 2.2.3.2 Skiwanderwege 12 3.3.6 Sonstiges -

Flyer Wandern Web.Pdf
ILSESTEIN-TOUR SCHARFENSTEIN-TOUR DARLINGERÖDER SCHWEIZ KLEINE DRÜBECKER RUNDTOUR BLOCHHAUER - ILSESTEIN - ILSETAL - ECKERSTAUSEE - Östlich von Ilsenburg lockt die „Darlingeröder Schweiz“. Durch Aktive Erholung bietet der Erholungswald Drübeck. In dem hügeliges, wiesenreiches Gebiet führen wenig frequentierte, zertifizierten Waldgebiet wird viel Wert auf den gepflegten Zu- ( ) SCHARFENSTEIN - ILSETAL ( ) PLESSENBURG - ILSEFÄLLE - ILSETAL wunderschöne Wanderwege mit Blick auf das Harzer Gebirgs- stand von Wegen und Bänken gelegt. Hier wird besonders auf massiv und in das weite Harzvorland. den Erhalt von Biotopbäumen und Mischwald geachtet. Am Blochhauer, dem zentralen Wanderpunkt und Anfang vieler Vom Wanderparkplatz Ilsetal geht es zunächst ca. 3 km ent- Wanderwege, geht es über die Holzbrücke, gleich rechts dem lang der Ilse. Am Ende des Weges überquert Ihr auf einer Brü- roten Punkt folgend bergauf in Richtung Ilsestein. Am Ilsestein cke die Ilse und wandert nach rechts – dem blauen Kreuz fol- SANDTALRUNDE ( ) DURCH DEN ERHOLUNGSWALD ( ) angelangt, sollte der Aufstieg zum Kreuz nicht versäumt wer- gend – zum Kruzifix. Hier lädt ein Rastplatz zum Verweilen ein. Der Weg startet am Parkplatz an der Tourist-Information in Darlinge- Vom Sportplatz in Drübeck folgt Ihr zunächst der Wegmarkie- den, von wo man einen schönen Blick zum Brocken und auf Nach einer kleinen Pause führt Euch das blaue Kreuz über den rode und führt über das Wegkreuz an der kleinen Brücke, bis zum rung mit dem gelben Punkt in Richtung Naturlehrpfad. Dann Ilsenburg hat. Hier lädt Euch die Raststätte Ilsestein zur Stär- Dielenweg bis zum Eckerstausee. Hier angekommen, über- Waldbad. Von dort aus geht es bis ins Jägertal zur Schutzhütte. Er geht es links ab auf den Europäischen Fernwanderweg E11, am kung ein.