Christina Nikolajew
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Nepaisant Nieko Pokalbis Su Smuikininku Džeraldu Bidva „Portretas Latvijoje
Kultūros savaitraštis „7 meno dienos“ | www.7md.lt 2019 m. sausio 18 d., penktadienis Nr. 3 (1282) | Kaina 1,30 Eur D ailė | M uzika | T eatras | K inas | Š okis 2 Nepaisant nieko Pokalbis su smuikininku Džeraldu Bidva „Portretas Latvijoje. 20-as amžius. Veido išraiškos“, arba kaip būti geru žiūrovu 4 Monika Krikštopaitytė Onutės Narbutaitės „Trys Dievo Motinos Rengėjams gali būti pikta, jei kas simfonijos“ nors greitu žingsniu nudrožia per ekspoziciją, o kaltas dėl to dažniau- siai bus išankstinis žinojimas. Lie- tuvos dailės gyvenimėlyje, didesnės apimties grupinėje parodoje parei- gingas žiūrovas bus jau daug ką ma- 7 tęs, sustos prie mėgstamų darbų, Ciklo „Gyvoji baleto istorija“ koncertas pasikartojimai jį mažai sudomins, o visai naujų kūrinių parodoje, ko gero, bus daug panašių į jau ma- tytus. Nebent kuratorius sugebės pasakyti ką nors naujo ar įdomaus. Parodos rengėjai gali manyti, kad geras žiūrovas skaitys viską, kas pa- rašyta, ir tada supras. Tačiau tai ne- realistinis planas. Tik suinteresuo- tas žiūrovas nevaidins, kad skaito, grynai iš mandagumo, bet greičiau- siai vietoje neskaitys ir jis, o gaus parankinės medžiagos. Manau, 4 sakiniai yra maksimali riba. Ar toks skubantis ir neskaitantis lankytojas yra blogas? Ar jam kamuotis kalte? Natalia LL, iš serijos „Vartotojų menas“. 1975 m. Kaip tapti geram? Prisiverčiant? Bet © József Rosta / „Ludwig Museum“ – „Museum of Contemporary Art“ tada jau geriau jis neis iš viso. Mano manymu, geru žiūrovu tampama, kai keliami klausimai kuratoriui Kaip dailės pasaulis švenčia moterų ir kūriniams. Gera paroda bus, jei Oto Skulme, „Kompozicija portretui (Sievas)“. 1923 m. Zuzāno kolekcija balsavimo teisės šimtmetį ekspozicijoje kyla klausimai ir jie 9 yra numanomi, kaip nors atsakomi kuratorei Gintai Gerhardei-Upe- eksponuojama ir Jānio Mitrēvico arba lieka vaisingi. -

PADOMJU LAIKZĪMES Gustavs Terzens
LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI SSĪ. SEJliS K ACTA UNIVERSITATIS LATVIENSIS ii m Communication ACTA UNIVERSITĀTI? LATVIENSIS WBIĒ §11 Communication Discourse of Culture and History The University of Latvia Press LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI 183. §SJ! Kōcija Kultūras un vēstures diskurss Latvijas Universitātes BIBLIOTĒKA LU Akadēmiskais apgāds UDK 070(082) Ko 442 Galvenā redaktore Inta Brikše Redkolēģija Ullamaija Kivikuru (Somija), Ābrams Kleckins, Māra Rubene, Teresa Sasinska-Klasa (Polija), Peters Vihalems (Igaunija), VitaZelče Literārā redaktore Ieva Jansone Angļu teksta redaktors Kārlis Streips Māksliniece Ināra Jēgere Maketētājs Oskars Jūrmalnieks Pārpublicēšanas gadījumā nepieciešama Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas atļauja. Citējot atsauce uz izdevumu obligāta. ISSN 1407-2157 © Latvijas Universitāte, 2005 ISBN 9984-770-97-4 © Ināra Jēgere, mākslinieciskais noformējums, 2005 Saturs VĒSTURE MAINĪBĀ Skaidrīte Lasmane. Vēsturiskā atmiņa un tolerance 7 Ābrams KLeckins. Cilvēka laiks un vēstures laiks (Pārdomas par Latvijas 20. gadsimta vēstures zinātnisko un publisko diskursu) 23 Ojārs Skudra. Latvijas mūsdienu vēstures "tēli" un "gleznas" žurnāla "Nedēļa" 2004. gada publikācijās 32 PADOMJU LAIKZĪMES Gustavs Terzens. PSKP CK ģenerālsekretāru bēru rituāli padomju Latvijas presē (1953-1985) 50 MārtiņšKaprāns. Jaunā cilvēka konstrukcija 20. gadsimta 60. gadu latviešu prozā 73 DZIMTES DISKURSS Jānis Buholcs. Vīrieša dzimtes konstrukcija žurnālā "Padomju Latvijas Sieviete" (1952-1968) 97 Vineta -

Literatūrzinātne, Folkloristika, Māksla Literature, Folklore, Arts
LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI 732. SĒJUMS Literatūrzinātne, folkloristika, māksla Latviešu literatūra un reliģija SCIENTIFIC PAPERS UNIVERSITY OF LatVIA VOLUME 732 Literature, Folklore, Arts Latvian Literature and Religion SCIENTIFIC PAPERS UNIVERSITY OF LatVIA VOLUME 732 Literature, Folklore, Arts Latvian Literature and Religion Latvijas Universitāte LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI 732. SĒJUMS Literatūrzinātne, folkloristika, māksla Latviešu literatūra un reliģija Latvijas Universitāte UDK 82.0:821+398+7(082) Li 848 Galvenā redaktore Dr. philol., prof. Ausma Cimdiņa Krājuma sastādītājas: Dr. philol., asoc. prof. Ieva Kalniņa, Dr. phil. Iveta Leitāne Redkolēģija: Dr. habil. philol., prof. Juris Kastiņš – LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. habil. philol., prof. Sigma Ankrava – LU Moderno valodu fakultāte Dr. habil. philol., prof. Janīna Kursīte – LU Filoloģijas fakultāte Dr. philol., prof. Ilze Rūmniece – LU Filoloģijas fakultāte Dr. philol., prof. Ludmila Sproģe – LU Filoloģijas fakultāte Dr. habil. art. / Dr. philol., prof. Silvija Radzobe – LU Filoloģijas fakultāte Dr. art., asoc. prof. Valdis Muktupāvels – LU Filoloģijas fakultāte Dr. philol., prof. Viktors Freibergs – LU Moderno valodu fakultāte Dr. philol. Helmuts Vinters – Vācija Dr. habil. philol. Irina Belobrovceva – Tallinas Universitāte (Igaunija) Ph.D., Prof. Kārlis Račevskis – Ohaio Universitāte (ASV) Prof. Lalita Muižniece – Rietummičiganas Universitāte, Kalamazū (ASV) Prof. Jurate Sprindīte – Lietuviešu literatūras un mākslas institūts (Lietuva) Prof. Nijole Laurinkiene -

Gimbutas.Pdf
THE BALTS by Marija Gimbutas Thames and Hudson London 1963 5 CONTENTS List of Illustrations ............................................ 6 Foreword ........................................................... 11 Introduction ....................................................... 13 I Linguistic and Historic Background ................. 21 II Their Origins ..................................................... 37 III The Bronze and the Early Iron Age of the Maritime Balts ................................................... 54 IV The Bronze and the Early Iron Age of the Eastern Balts ..................................................... 91 V The “Golden Age”............................................. 109 VI The Baltic “Middle Iron Age” .......................... 141 VII The Balts Before the Dawn of History .............. 155 VIII Religion ............................................................. 179 Notes ................................................................. 205 Bibliography ...................................................... 214 Sources of Illustrations ...................................... 224 The Plates .......................................................... 227 Notes On the Plates ........................................... 269 Index .................................................................. 277 6 ILLUSTRATIONS All images have been omitted from this PDF version of the book, in order to make the size of the file smaller. If you would like to see them, they are all available on the HTML version of this -

Latvijas Universitāte 1999-2003
LATVIJAS UNIVERSITĀTE 1999-2003 Latvijas Universitāte 1999-2003 Latvijas Universitātes SLIOTĒKA LU Akadēmiskais Apgāds UDK 378.4(474.3) La 811 Redkolēģija:Juris Krūmiņš, Indriķis Muižnieks, Ojārs Judrups, Ināra Popova, Evija Rūsīte, Ilze Upacere, Jānis Palkavnieks, v Alīna Gržibovska, Astra Kravčenko, Anna Smite, Ieva Račko Teksta redaktore Vija Kaņepe Maketu un vāka dizainu veidojusi Kristīne Krēsliņa ISBN 9984-770-43-5 © Latvijas Universitāte, 2004 SATURS Priekšvārds 7 Latvijas Universitātes struktūra 11 Fakultātes 12 LU juridiski patstāvīgie institūti 14 LU institūti un akadēmiskās struktūvienības 17 LU Studiju centri 19 Administratīvās struktūrvienības 21 Latvijas Universitātes 85 gadu hronika 23 Akadēmiskās, kultūras un sporta dzīves hronika 27 LU aizstāvētās doktora disertācijas 40 Senāts (1998) 53 Senāts (2001) 54 Senāts (2004) 55 Padomnieku Konvents 56 Goda tiesa un šķīrējtiesa 57 Goda doktori 58 Goda biedri 62 Emeritus profesori 64 Pirmoreiz ievēlētie asociētie profesori un profesori 66 LZA akadēmiķi un korespondētājlocekļi 72 LZA balvu laureāti 74 Starptautiskās konferences, semināri, simpoziji 86 Starptautiskā sadarbība 95 Akadēmiskais personāls 99 Akadēmisko struktūrvienību personāls 110 Administrācijas personāls 121 Saimniecības pārvaldes personāls 124 Absolventi 128 Bioloģijas fakultāte 128 Ekonomikas un vadības fakultāte 131 Filoloģijas fakultāte 182 Fizikas un matemātikas fakultāte 190 Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 199 Juridiskā fakultāte 204 Ķīmijas fakultāte 213 Medicīnas fakultāte 216 Moderno valodu (Svešvalodu) -

Proto-Indo-European Religion Evolved, Attributes of Gisches Wörterbuch (In German)
דאוס ديوس (Pashto for angel) َم ََليِ َکه http://thepashto.com/word.php?english=angel (Pashto for Dyēus) ډيَيُوس ډيوس http://jame-ghor.com/pashtoobooks/0006_06122012_adabi.pdf Δεύς Dyeus Dyēus (also *Dyēus ph2ter, alternatively spelled dyēws) is believed to have been chief deity in the religious tra- ditions of the prehistoric Proto-Indo-European societies. Part of a larger pantheon, he was the god of the day- light sky, and his position may have mirrored the posi- tion of the patriarch or monarch in society. This deity is not directly attested; rather scholars have reconstructed this deity from the languages and cultures of later Indo- European peoples. 1 Later gods etymologically con- nected with Dyeus • In Greek mythology Zeus[1] • In Roman mythology Jupiter (pronounced Iuppiter)[2] • In Historical Vedic religion Dyauṣ Pitār[3] Roman god Jupiter is a form of Dyeus. • Dionysus, especially with the Thracians and Sabines Rooted in the related but distinct Indo-European word *deiwos is the Latin word for deity, deus. The Latin word is also continued in English divine, “deity”, and the orig- inal Germanic word remains visible in “Tuesday” (“Day of Tīwaz”) and Old Norse tívar, which may be continued in the toponym Tiveden (“Wood of the Gods”, or of Týr). The following names derive from the related *deiwos: • Germanic Tīwaz (known as Týr in Old Norse) • Latin Deus (not originally the name of any single god, but later adopted as the name of the Christian god) • Indo-Iranian Deva/Daeva • Baltic Dievas • Celtic mythology e.g. Gaulish Dēuos • Slavic mythology div(-ese) (miracle) Estonian Tharapita bears similarity to Dyaus Pita in name, although it has been interpreted as being related to the god Thor. -

Russian & Slavic
Encyclopedia of Russian & Slavic Myth and Legend Encyclopedia of Russian & Slavic Myth and Legend Mike Dixon-Kennedy Santa Barbara, California Denver, Colorado Oxford, England Copyright © 1998 by Mike Dixon-Kennedy All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, except for the inclusion of brief quotations in a review, without prior permission in writing from the publishers. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Dixon-Kennedy, Mike, 1959– Encyclopedia of Russian and Slavic myth and legend. p. cm. Includes bibliographical references and index. Summary: Covers the myths and legends of the Russian Empire at its greatest extent as well as other Slavic people and countries. Includes historical, geographical, and biographical background information. 1. Mythology, Slavic—Juvenile literature. [1. Mythology, Slavic. 2. Mythology—Encyclopedias.] I. Title. BL930.D58 1998 398.2'0947—dc21 98-20330 CIP AC ISBN 1-57607-063-8 (hc) ISBN 1-57607-130-8 (pbk) 0403020100999810987654321 ABC-CLIO, Inc. 130 Cremona Drive, P.O. Box 1911 Santa Barbara, California 93116-1911 Typesetting by Letra Libre This book is printed on acid-free paper I. Manufactured in the United States of America. For Gill CONTENTS Preface, ix How to Use This Book, xi Brief Historical and Anthropological Details, xiii Encyclopedia of Russian and Slavic Myth and Legend, 1 References and Further Reading, 327 Appendix 1, 331 Glossary of Terms Appendix 2, 333 Transliteration from Cyrillic to Latin Letters Appendix 3, 335 The Rulers of Russia Appendix 4, 337 Topic Finder Index, 353 vii PREFACE Having studied the amazingly complex sub- This volume is not unique. -

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav Jazykovědy a Baltistiky
MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav jazykovědy a baltistiky Magisterská diplomová práce 2014 Bc. Marta Běťáková 1 MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav jazykovědy a baltistiky Baltistika Bc. Marta Běťáková Baltská mytologie v historiografických a folklorních zdrojích s přihlédnutím k lotyšským matkám Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Tomáń Hoskovec, CSc. 2014 2 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s vyuţitím uvedených pramenů a literatury. Marta Běťáková 3 Chtěla bych poděkovat doc. Tomáńi Hoskovcovi za pomoc s administrativními záleņitostmi ohledně nástupu ke studiu po dlouhém přeruńení, prof. Janīně Kursīte a Aldisi Pūtelisovi za odborné konzultace a laskavé poskytnutí svých článků a Indře Strīķe-Bozkuńe za pomoc s některými překlady z lotyńtiny. 4 Anotace Tato magisterská diplomová práce se zabývá obrazem litevské a lotyńské mytologie v historiografických a folklorních zdrojích. Těņińtě práce spočívá a) v chronologickém přehledu těchto zdrojů b) v analýze toho, co tyto zdroje vypovídají o jedné kategorie lotyńských mytických bytostí – matek (lot. Mātes). Annotation This master thesis deals with the historiographical and folklore sources that include information on Lithuanian and Latvian mythology. The thesis focuses on a) comprehensive list of these sources b) analysis of what these sources reveal about one category of Latvian mythical beings – mothers (Latv. Mātes). Klíčová slova Mytologie, baltská mytologie, Litva, Lotyńsko, lotyńská mytologie, historiografické zdroje, -
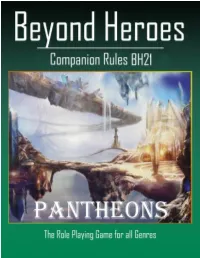
The Beyond Heroes Roleplaying Game Book I: the Player's Guide
1 The Beyond Heroes Roleplaying Game Book XXI: The Book of Pantheons Writing and Design: Marco Ferraro The Book of Pantheons Copyright © 2019 Marco Ferraro. All Rights Reserved This is meant as an amateur free fan production. Absolutely no money is generated from it. Wizards of the Coast, Dungeons & Dragons, and their logos are trademarks of Wizards of the Coast LLC in the United States and other countries. © 2019 Wizards. All Rights Reserved. Beyond Heroes is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Wizards of the Coast LLC. Contents Foreword 4 Timeline 4 Earth Pantheons 6 Afghani 7 Afrikana 9 Arabian 16 Armenian 23 Australian Aboriginal 24 Aztec 28 Babylonian 34 Baltic 41 Basque 48 British 49 Burmese 50 Cambodian 53 Canaanite 56 Celtic 58 Chinese 68 Egyptian 76 Eskimo 80 Estonian 82 Etruscan 85 Filipino 93 Finnish 105 Gaulish 108 Greek 111 Hindu 116 Hittite 123 Hungarian 125 2 Hurrian 128 Inca 133 Indonesian 135 Irish 139 Islander 144 Japanese 155 Korean 162 Lusitanian 165 Malaysian 174 Maori 178 Mayan 179 Mesopotamian and Sumerian 186 Mongolian 192 Native American 194 Norse 201 Ossetian 207 Phoenician 208 Pop Culture 212 Primordial 215 Roman 221 Sami 233 Scottish 234 Semitic 236 Slavic 237 Syrian 240 Thai 241 Thracian 244 Tibetan 245 Voodun 256 Welsh 265 DC Comics Entities 269 Marvel Comics Entities 275 Dungeons and Dragons 279 Eternal Champion 297 Middle Earth 299 Palladium Fantasy 301 Pathfinder 302 Warhammer Fantasy 302 The Pantheon Creation Guide 304 Spheres for Gods 317 Mana and Deities 320 Creating Cosmic Beings 325 Characters who Ascend 327 Characters who Ascend II 328 List of Cosmic Powers 331 Organizations 338 3 Foreword while countless points of light flare and The Beyond Heroes Role Playing Game die in the interior. -

Encyclopedia of Russian & Slavic Myth and Legend
Encyclopedia of Russian & Slavic Myth and Legend Encyclopedia of Russian & Slavic Myth and Legend Mike Dixon-Kennedy Santa Barbara, California Denver, Colorado Oxford, England Copyright © 1998 by Mike Dixon-Kennedy All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, except for the inclusion of brief quotations in a review, without prior permission in writing from the publishers. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Dixon-Kennedy, Mike, 1959– Encyclopedia of Russian and Slavic myth and legend. p. cm. Includes bibliographical references and index. Summary: Covers the myths and legends of the Russian Empire at its greatest extent as well as other Slavic people and countries. Includes historical, geographical, and biographical background information. 1. Mythology, Slavic—Juvenile literature. [1. Mythology, Slavic. 2. Mythology—Encyclopedias.] I. Title. BL930.D58 1998 398.2'0947—dc21 98-20330 CIP AC ISBN 1-57607-063-8 (hc) ISBN 1-57607-130-8 (pbk) 0403020100999810987654321 ABC-CLIO, Inc. 130 Cremona Drive, P.O. Box 1911 Santa Barbara, California 93116-1911 Typesetting by Letra Libre This book is printed on acid-free paper I. Manufactured in the United States of America. For Gill CONTENTS Preface, ix How to Use This Book, xi Brief Historical and Anthropological Details, xiii Encyclopedia of Russian and Slavic Myth and Legend, 1 References and Further Reading, 327 Appendix 1, 331 Glossary of Terms Appendix 2, 333 Transliteration from Cyrillic to Latin Letters Appendix 3, 335 The Rulers of Russia Appendix 4, 337 Topic Finder Index, 353 vii PREFACE Having studied the amazingly complex sub- This volume is not unique. -

A Baltic Music: the Folklore Movement in Lithuania
A BALTIC MUSIC: THE FOLKLORE MOVEMENT IN LITHUANIA, LATVIA, AND ESTONIA, 1968-1991 Guntis Smidchens Submitted to the faculty of the University Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in the Department of Folklore, Indiana University April 1996 Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. Accepted by the Graduate Faculty, Indiana University, in partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy. /> Linda Ddgh, Ph.D. S c t ^y. ~ ~ T Sandra K. Dolby, Ph.D. 14V y>_ a Henry Glassie, Ph.UT </, Toivo U. Raun, Ph.D. September 1, 1994 ii Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. ® 1996 Guntis Smidchens ALL RIGHTS RESERVED Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. There is a Baltic music beyond words and language... — Ivar Ivask iv Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. Acknowledgements When I departed from Latvia in June of 1992, Helm! Stalte turned to me with her warm gaze and generous smile, "May there always be good people around you!" Her wish was true to life. Many, many people and organizations have helped me in my work. I owe the most to my teachers. Linda D6gh, an inspiring scholar and demanding Committee Chair, guided me into the study of folklore. She was always generous with advice, constructive critique, and encouragement. Toivo Raun’s meticulously precise, broadly conceived historical research, and his collegial friendship are challenging models which I strive to emulate. -

Mācītie Ļaudis Un Vienkāršā Tauta. Divas Tradīcijas Latviešu Mitoloģijā
III STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE „MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ” MĀCĪTIE ĻAUDIS UN VIENKĀRŠĀ TAUTA. DIVAS TRADĪCIJAS LATVIEŠU MITOLOĢIJĀ The Learned and the Common People. Two Traditions in the Latvian Mythology Aldis Pūtelis Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve, e-pasts: [email protected] Abstract. The present article follows the formation of a view on the Latvian mythology, distinctly different from the one that can be drawn from the analysis of the folklore texts. It can be concluded that the cause for this discrepancy is the attitude of the learned men authoring the different texts describing the mythology of the local people in more or less detail. They relied basically on writings of other authors instead of the living tradition itself, as any folkloristic or anthropological approach was yet the matter of far future. By repeating the data found in other written works, this information appears to be widely known and completely reliable. The ultimate collection of all the data is to be found in an appendix to the “Latvian Grammar” by Gotthard Friedrich Stender – an outstanding representative of Enlightenment in Latvia. In order to trace the development of the particular corpus of data included in this work, the probable earlier sources are analysed, comparing the available data to establish their relations. Keywords: folklore, mythology, history, Latvianness, tradition, texts, oral history. „Nav iespējams izveidot ilglaicīgu pasaules iekārtu, kas ignorētu vispārējās nāciju ilgas pēc sakņu meklēšanas etniskajā pagātnē, kā arī nāciju un nacionālisma pētījumi, kas pilnībā ignorē šo pagātni, nevar būt auglīgi” (Smith, 1988: 5). Ar šādiem vārdiem ievadu savai grāmatai noslēdz Antonijs Smits.