Regnitzflora
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Übernachten 2014
Komm in die Gänge! Städteregion Nürnberg Entdecken Sie das Fürth Erlangen Schwabach wahre Herz Nürnbergs. Erleben Sie die Historischen Felsengänge und kosten Sie fränkische Gerichte bei einem frischen Bier in der Hausbrauerei Altstadthof übernachten » Führungen täglich von 11 bis 18 Uhr » Gruppenführungen nach Vereinbarung » Veranstaltungen in den Historischen Felsengängen und in der Hausbrauerei 2014 tourismus.nuernberg.de Altstadthof accommodation » Original Nürnberger Brautradition in der Hausbrauerei am Fuß der Nürnberger Infos, Tickets und Reservierungen: Kaiserburg Bergstraße 19 · 90403 Nürnberg » Tel 0911 / 23 60 27 31 · Fax 0911 / 23 55 53 65 Räume für bis zu 90 Personen www.historische-felsengaenge.de » BrauereiLaden mit originellen Produkten www.hausbrauerei-altstadthof.de rund ums Bier Pensionen Gasthöfe Hotels garni Hotels 13_0913_UKV_2014_Umschlag_03.indd 1-4 02.12.13 09:03 Pep14_210x297_Unterkunftsverz.indd 1 16.09.13 12:36 Anz GST Röstla A5 quer 01.indd 1 06.09.13 08:38 203x297_Unterkunftsverzeichnis_engl_NC.indd 1 21.10.13 14:50 UNSEUNSERERE HOTELS Information und Buchung: hotel.nuernberg.de | Telefon: +490049 911 911 2336 2336 121 121 UNSEREUNSERE HOTELS Information und Buchung: hotel.nuernberg.de | Telefon: 0049+49 911 911 2336 2336 121 121 Beherbergungsbetriebe / Nürnberg Umgebung südlich Beherbergungsbetriebe / Nürnberg Umgebung westlich Accommodation / Outskirts of Nuremberg south Accommodation / Outskirts of Nuremberg west Landhaus Kaiser Karte Seite 10 map page 10 XX Karte Seite 10 map page 10 XX G Hotel Frankenhöhe R Windsbacher Straße 32 Betten / Zimmer Preise inkl. Frühstück Ausstattung / comfort Entfernung distance (km) (beds / rooms) prices incl. breakfast Adresse / address Betten / Zimmer Preise inkl. Frühstück Ausstattung / comfort Entfernung distance (km) 91183 Abenberg (beds / rooms) prices incl. -

Reise in Die Römerzeit Erkunden Sie Diesen Faszinierenden Abschnitt Unserer Geschichte
Verkehrsamt Oettingen i. Bay. Schloßstraße 36, 86732 Oettingen eMail: [email protected] Internet: www.oettingen.de Tourenvorschläge für Gruppenreisen Das Verkehrsamt Oettingen bietet für Gruppen geführte Touren zu Sehenswürdigkeiten im Ries und Umgebung an. Reise in die Römerzeit Erkunden Sie diesen faszinierenden Abschnitt unserer Geschichte. Besuchen Sie mit uns den Limes, Gutshöfe und Militärlager, wandern Sie mit uns auf alten Römerstraßen. Oettingen – Westheim – Gnotzheim – Theilenhofen – Weißenburg – Ellingen – Burgsa lach – Oettingen Westheim Am Ortsrand von Westheim wurde von Archäologen ein früh mittelalterlicher Friedhof mit etwa 260 Bestattungen ausgegraben. Am Rande des Friedhofes wurde eine kleine Holzkapelle entdeckt, die aus der Zeit um 600 n. Chr. stammt. Sie ist bisher der älteste Nachweis der Christianisierung unserer Gegend. Das Gebäude wurde rekonstruiert, im Inneren sind Infotafeln zum Gräberfeld. Gnotzheim Am Ortsrand befinden sich die Reste des römischen Kas tells Medianis. An der Ortskirche eingemauerte Inschrif tensteine der dort stationierten III. Thrakerkohorte, die zu Ehren des Kaisers Antoninus Pius, anlässlich des Kastell baus in Stein um 144 n. Chr., gesetzt wurden. Theilenhofen Römisches Kastell Iciniacum und Badebäude. Stand ort der III. Cohors Bracaraugustanorum. Das Kastell entstand nach der Aufgabe der römischen Militär lager im Ries um 110 n. Chr. Vermutlich war es das Nachfolgekastell von Munningen südlich Oettingen. Weißenburg Mitten in Weißenburg liegen die Überreste des Römerkastells Biricianis. Der Ort war militärisches und wirtschaftliches Zentrum in diesem Limesabschnitt. Das Nordtor des Lagers und eine Thermenanlage sind restauriert. Der bekannte Weißen burger Schatzfund ist wohl das Inventar eines ehemaligen Tem pels, das während unruhiger Zeiten vergraben wurde. Ellingen Auf einer Anhöhe oberhalb des Ortes liegt das teilweise restau- rierte Römerkastell. -

Stadtverkehr Lichtenfels
VGN Info-Service Lokal spezial www.vgn.de 1 x buchen – MobiCard – Stadtverkehr VGN Onlineshop und VGN-App – Kolvenbach-Post WerbeAtelier 12 Monate extra-günstig mobil die fl exible Wochen- und Monatskarte immer für Sie bereit! shop.vgn.de Lichtenfels • für eine Person • für bis zu 6 Personen (max. 2 ab 18 Jahre) Sie können VGN-Tickets einfach ausdrucken, mit der Post • an 12 aufeinander folgenden Monaten gültig • Mitnahme: Montag bis Freitag ab 9 Uhr, Gratis-App Online Tickets erhalten oder auf dem Handy anzeigen lassen. kaufen • günstigste Fahrkartenart am Wochenende und an Feiertagen rund um die Uhr VGN Fahrplan & Tickets • Zusendung nach Hause, • 2 Fahrräder* anstelle von 2 Personen bequeme Abbuchung • 1 Hund shop.vgn.de • Kündigung monatlich möglich • unentgeltlich übertragbar ForchheimLichtenfels 9-Uhr-Spar-Tipp: • 7 oder 31 Tage gültig Ab 9 Uhr • Gültigkeitsbeginn frei wählbar fahren & sparen Mit der Gratis-App „VGN Fahrplan & Tickets“ Mehr Auswahl beim Fahren & Sparen kaufen Sie Einzelfahrkarten und TagesTickets www.mobicard.de schnell & komfortabel. Schnupper-Abo für 3 Monate – Einfach App laden und abfahren! Fahrplan-Info ideal zum Ausprobieren 6 Monate günstig mobil – für Ihren Einsatz nach Wunsch, re z. B. als Winter-Abo -F ize N i G t V Ihr Abo plus Mitnahme Den ganzen Tag oder • für bis zu 6 Personen (max. 2 ab 18 Jahre) das gesamte Wochenende mobil • Mitnahme: Montag bis Freitag ab 19 Uhr, • für bis zu 6 Personen (max. 2 ab 18 Jahre) am Wochenende und an Feiertagen rund • Mitnahme ganztags um die Uhr • Fahrräder* anstelle von Personen VGN-Freizeit-Linien (1.5.–1.11.2019) • 2 Fahrräder* anstelle von 2 Personen • 1 Hund • 1 Hund • Wochenend-Bonus: Am Samstag gekauft, ist der Sonntag mit drin! Steigen Sie ein: z. -

Strukturdaten Des IHK-Gremiums Weißenburg Gunzenhausen Stand Februar 2019
Strukturdaten des IHK-Gremiums Weißenburg Gunzenhausen Strukturdaten des IHK-Gremiums Weißenburg Gunzenhausen Stand Februar 2019 Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken Ulmenstraße 52 | 90443 Nürnberg Tel: 0911 1335-375 | Fax: 0911 1335-150375 | [email protected] | www.ihk-nuernberg.de Strukturdaten des IHK-Gremiums Weißenburg Gunzenhausen Das IHK-Gremium Weißenburg Gunzenhausen Vorsitz Paul Habbel, Lebendige Organisation GmbH Im Winkel 40 91757 Treuchtlingen [email protected] Telefon: 09141 9975-101 Stellvertretende Vorsitzende 1. Stellvertretender Vorsitz Hans-Georg Degenhart, Degenhart Eisenhandel GmbH & Co. KG Leiter der IHK Geschäftsstelle Karin Bucher, IHK Nürnberg für Mittelfranken, Bahnhofsplatz 8 91522 Ansbach [email protected] Telefon: 0981 209570-01 Telefax: 0981 209570-29 Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken Ulmenstraße 52 | 90443 Nürnberg Tel: 0911 1335-375 | Fax: 0911 1335-150375 | [email protected] | www.ihk-nuernberg.de Strukturdaten des IHK-Gremiums Weißenburg Gunzenhausen Das IHK-Gremium Weißenburg Gunzenhausen Mitglieder Wahlgruppe Dienstleistung Markus Etschel, Etschel netkey GmbH, Weißenburg i. Bay. Klaus Horrolt, Parkhotel Altmühltal GmbH & Co. KG, Gunzenhausen Stefan Hueber, Hueber GmbH & Co. KG, Pleinfeld Harald Höglmeier, HB-B Höglmeier Beratungs- und Beteiligungs GmbH, Ellingen Gerhard Müller, Hotel Adlerbräu GmbH & Co. KG, Gunzenhausen Matthias Schork, Spedition Wüst GmbH & Co. KG, Weißenburg Wahlgruppe Handel Hans-Georg Degenhart, Degenhart Eisenhandel GmbH & Co. KG, Gunzenhausen Erika Gruber, Zweirad Gruber GmbH, Gunzenhausen Reiner Hackenberg, STABILO International GmbH, Heroldsberg Christina Kühleis, Foto Gebhardt & Lahm Inh. Christina Kühleis e. K., Treuchtlingen Mathias Meyer, Karl Meyer Buch + Papier Inh. Mathias Meyer, Weißenburg i. Bay. Hans Riedel, Huber & Riedel GmbH, Gunzenhausen Henriette Schlund, Wohnwiese Einrichtungen Jette Schlund, Ellingen Wahlgruppe Industrie Dr.-Ing. -

Begründung Mit Umweltbericht Zum Entwurf Vom 27. September 2018
Begründung mit Umweltbericht zum Entwurf vom 27. September 2018 Vorhaben Projekt: Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das Sondergebiet “Photovoltaikanlagen Wolfsloch” Gemeinde: Hochstadt am Main Landkreis: Lichtenfels Vorhabensträger: SÜDWERK Projektgesellschaft mbH, Burgkunstadt Entwurfsverfasser: SÜDWERK Projektgesellschaft mbH, Burgkunstadt Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Sondergebiet „Photovoltaikanlagen Wolfsloch“, Gemeinde Hochstadt am Main Seite 1 1. ANGABEN ZUR GEMEINDE .................................................................................................... 3 2. ZIELE UND ZWECKE DES VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLANES „PHOTOVOLTAIKANLAGEN WOLFSLOCH“ ............................................................................ 3 3. ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN UND ÖRTLICHE PLANUNGEN ..................................... 4 3.1. RAUMPLANUNG ......................................................................................................................... 4 3.1.1 Standort für Gewerbe und Dienstleistungen, Infrastruktur ............................................... 4 3.2. VORHANDENE VERBINDLICHE UND INFORMELLE PLANUNGEN ....................................................... 4 3.2.1 Vorhandene rechtsverbindliche Bebauungspläne ............................................................ 4 3.2.2 Flächennutzungsplan ........................................................................................................ 4 3.2.2 Städtebaulicher Rahmenplan .......................................................................................... -

Veranstaltungen
Juli August Oktober November 03.07. Handwerkerverein 125 Jahre und Jahrestag 01.08. MF Frankenbüffel Weißwurstfrühschoppen 01.- Gemeinde Kirchweih 06.11. Fischereiverein Vereinsfest mit Gnotzheim 10.00 MZH Gnotzheim Westheim 10.00 Büffelheim Westheim 03.10. Polsingen Trendel Hahnenkamm Schafkopfturnier 04.07. Gemeinde Gemeinde- und 01.08. Ursheimer Vereine Dorffest 01.- Gemeinde Kirchweih 19.00 Alte Turnhalle Auhausen Kindergartenfest 01.08. Markt Heidenheim Badfest 04.10. Westheim Hüssingen 06.11. Schützenverein Schlachtschüssel im Klosterhof 11.00 Freibad 02.10. Schützenverein Preisschafkopfen Auhausen Schützenhaus Auhausen 04.07. FFW Westheim Kapellenfest 08.08. Gartenbau- u. Kapellfest "Zur Linde" Schützenheim Döckingen 06.11. DJK Gnotzheim Schafkopfturnier 9.30 Dorfplatz Westheim Fremdenverkehrs- 10.00 Kapell Hechlingen Döckingen 19.30 Sportheim Gnotzheim 04.07. Evangelische Chor- u. Orgelkonzert verein Hechlingen 02.10. Kirchengemeinde Konzert "Musica aliter und 14.11. Volkstrauertag Kirchengemeinde "Treuchtlinger Kantorei" 15.08. KKV Hüssingen- Dorffest Auhausen CordAria", Klosterkirche 16.11. Volksschule PrayDay Heidenheim 19.30 Münster Zirndorf 10.30 Dorfplatz Hüssingen Auhausen Hahnenkamm 04.07. AWO Heidenheim Sommerfest 08.- Markt Heidenheim Kirchweih 19.11. DJK Gnotzheim Kickerturnier 04.07. Diakonie Gartenfest - Sommerfest 11.10. Hechlingen 19.30 Sportheim Gnotzheim (Polsinger Heime) September 11.09. MF Frankenbüffel Sommerparty 26.11. DJK Gnotzheim Pokerturnier Westheim Büffelheim Westheim 10.07. DJK Gnotzheim Mitternachtsgauditurnier 10.- FFW Auhausen Einweihung Neues 19.30 Sportheim Gnotzheim 13.00 Sportplatz 12.09. Feuerwehrhaus 14.- Markt Gnotzheim Kirchweih Gnotzheim/ Dezember 10.07. SKV Ostheim Grillabend mit im Klosterhof 18.10. Spielberg 03.- Fa. Stark und Vereine Weihnachtsmarkt Heimatliedersingen 15.- Gemeinde Kirchweih 16.09. Motorradfreunde Kirchweihanstich 05.12. Betriebsgelände Fa. Stark 19.00 FW-Haus Ostheim Frankenbüffel Büffelheim Westheim 18.10. -

WEISMAINER Jurabote JURABOTE02/2018 1 Mitteilungsblatt Der Stadt Weismain
Weismainer WEISMAINER Jurabote JURABOTE02/2018 1 Mitteilungsblatt der Stadt Weismain Nr. 2 22. Februar 2018 23. Jg. Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, turbulente Faschingstage lie- Seit Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei - doch es reifen gen hinter uns: Los ging’s mit wahrscheinlich schon die ersten Pläne für die nächste Saison. Die der Erstürmung des Rathauses wird dann wieder etwas länger sein: Der Gaudiwurm wird sich durch die Närrischen Weiber, die 2019 erst am 3. März in Bewegung setzen. frischen Wind in die verschla- fene Stadtverwaltung brachten. Abschließend darf ich Sie noch auf eine kulturelle Veranstaltung Gestärkt durch eine aufbauende im Rathauskeller aufmerksam machen. Am Samstag, 10. März, Gesichtsmaske aus Gurken und hat der Museums- und Kulturverein den „Bairisch diatonischen Quark war zumindest ich für die Jodelwahnsinn“ eingeladen. Der Vorverkauf hat bereits begonnen tollen Tage bestens gerüstet. Als - der Verein freut sich über viele Besucherinnen und Besucher Höhepunkt der närrischen Saison des anarchisch-kultigen Musikkabaretts! durfte natürlich wieder unser Gaudiwurm gelten, der trotz des Es grüßt Sie herzlichst nicht so schönen Wetters tausen- Ihr Udo Dauer de Faschingsbegeisterte nach Weismain lockte. Erfreulich war, Erster Bürgermeister dass diese Großveranstaltung ohne große Zwischenfälle über die Bühne ging und dass viele unbeschwert auf unserem Marktplatz feiern konnten. Ein herzliches Dankeschön dem rührigen Weismainer Faschings- komitee, das mit dem Kaulhaaz’n-Fieber wieder für eine furiose Veranstaltung im Rathauskeller sorgte. Dank sei aber auch allen anderen Vereinen oder Wirtshäusern gesagt, die jedes Jahr den Weismainer Fasching mit eigenem Narrentreiben bereichern. Mei- ne Hochachtung gilt ebenso dem Rathaus- und Bauhof-Personal, das sich mutig, unerschrocken und mit viel Fantasie gegen den Rathaussturm der Weiber stemmte (auch wenn der Schlüssel dann Mobiles Internet: Internet Stick für doch verloren ging). -

Liniennetz Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
Liniennetz Landkreis Weißenburg - Gunzenhausen Stand: 13.12.2020 RE 60 RE 60 Regionalbahn mit Haltestelle 744 Mitteleschenbach Pleinfeld innerhalb des VGN 622 Spalt Schienenstrecke außerhalb des VGN 625 Windsbach Obererlbach 631 Georgensgmünd Buslinie mit Haltestelle RB 80 Ansbach 618 Marktbreit RE 7 Nürnberg 625 Georgensgmünd Bergen Aue Kalben- innerhalb des VGN Straßenhaus steinberg Spalt Wasserzell RE 16 Nürnberg 631 Roth Forsthaus Haundorf RE 17 Nürnberg Stadtverkehr ohne Liniendarstellung Seitersdorf Schnittling RE 60 Nürnberg Eichenberg Großweingarten RB 16 Nürnberg Anrufsammeltaxi Igelsbach Fünf- Hagsbronn Muhr am See Brand bronn Stockheim Mühlstetten Röttenbach Mörsach Büchelberg Gothendorf Gräfensteinberg Georgenhaag Enderndorf Erlingsdorf Laubenzedel Geislohe 741 Arberg Geiselsberg Bechhofen Streudorf Brombach Absberg Birklein Stirn Höhberg Altmühlsee Sinderlach Endhaltestellen Pleinfeld RB 80 Hohenweiler Steinabühl Wald Brombachsee Allmannsdorf Mackenmühle RB 62 Oberhambach Schlungenhof Langlau Endhaltestellen Gunzenhausen Gunzenhausen Rehenbühl Unterhambach RB 62 RB 62 Ramsberg Mannholz wurmbach Unter- Gundelshalm Thannhausen 642 Oberasbach Pleinfeld Mischelbach Filchenhard Ober- Veitserlbach 619 Greding Cronheim Obenbrunn Kleinweingarten Walting Pfofeld Rittern Walkerszell St. Veit Maicha Aha Edersfeld Unterasbach Dorsbrunn Kemnathen Engelreuth Dornhausen Reisach Gündersbach Göppersdorf 829 Wassertrüdingen Stetten Theilenhofen Tiefenbach Ottmarsfeld Reuth unter Neuhaus Nordstetten Pflaumfeld Windsfeld Hörlbach Ettenstatt Dannhausen -

Urlaubam Brombachsee
GUNDELSHALMTHEILENHOFEN WACHSTEIN REHENBÜHL PFOFELD GUNDELSHEIM FURTHMÜHLE LANGLAUALESHEIM 2020 NEUHERBERGTHANNHAUSENRITTERN BROMBACHSEE AM für Gastgeber und Wissenswertes URLAUB Staatlich anerkannter Erholungsort anerkannter Staatlich Familien Tipps Rothenburg o. d. Tauber NÜRNBERG Bad Windsheim Heilsbronn Schwabach Feucht A 6 Wendelstein Neumarkt ANSBACH Pyrbaum Colmberg Neuendettelsau Rednitzhembach Lichtenau Seligenporten Leutershausen WOLFRAMS- WINDSBACH Wernfels ABENBERG A 9 Wassermungenau Büchenbach ESCHENBACH Aurau ROTH A 6 Selgenstadt Theilenberg Rednitz WEIDENBACH Untererlbach MITTELESCHENBACH Pflugsmühle Brunnau ALLERSBERG Herrieden Obererlbach Mäbenberg Rothaurach Irrebach Triesdorf MERKENDORF Schnittling Altenfelden BECHHOFEN A.D.H. MÖNCHSWALD Fünfbronn SPALTER HÜGELLAND Kalbensteinberg SPALT Eichelburg ORNBAU Heglau Oberhöhberg Untersteinbach Oberheckenhofen Heubühl Reckenstetten ARBERG Seitersdorf Möning Hirschlach Keilberg Wasserzell Haundorfer HAUNDORF Gern Weiher Mosbach Wernsbach Birkach Hagsbronn Roth Polsdorf Rohr Nesselbach Igelsbach Stockheim Großweingarten Eichenberg Mörsach GEORGENSGMÜND Grashof Brand Mauk Wallesau Klein- / Büchelberg Kronmühle Lampersdorf Großenried MUHR A.SEE Gräfensteinberg Schnackensee Göggelsbuch Geislohe Höhberg Oberbreitenlohe Eckersmühlen Ebenried Streudorf IGELSBACHSEE Niedermauk Eismannsdorf Röttenbach Freystadt Laubenzedel Geiselsberg Unterbreitenlohe ROTHSEE Brombach Enderndorf Birklein A 9 B 13 am See Haimpfarrich Schellhof Erlingsdorf Main-Donau-Kanal ABSBERG Ottmannsberg Mühlstetten -

Liebe Mitbürgerinnen Und Mitbürger, Unsere
SEBASTIAN GEORG JOSEF HANS HEINRICH GÜNTER RALF MÜLLER MÜLLER STARK BERGMANN REINLEIN SCHNEIDER LIEBE MITBÜRGERINNEN UND MITBÜRGER, 26 JAHRE • LISTE 2 PLATZ 7 (207) 63 JAHRE • LISTE 2 PLATZ 8 (208) 68 JAHRE • LISTE 2 PLATZ 9 (209) 62 JAHRE • LISTE 2 PLATZ 22 (222) 55 JAHRE • LISTE 2 PLATZ 23 (223) 28 JAHRE • LISTE 2 PLATZ 24 (224) wir tragen unseren Landkreis Lichtenfels im Herzen. „Gemeinsam Mit Leidenschaft, Kreativität und Kompetenz. für einen starken Landkreis Lichtenfels“ heißt, dass wir gemeinsam Ihre Ideen und Impulse sind uns wichtig. Wir werden Ihnen dabei Lichtenfels | Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Bad Staffelstein | Rentner Marktzeuln | Industriekaufmann i.R. Lichtenfels / Schney | Oberstudienrat Lichtenfels | Hauptschullehrer Lichtenfels | Prozess- & Fertigungsplaner mit Ihnen die Zukunft unseres Landkreises gestalten möchten. zuhören. Denn Sie stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Juso-Kreisvorsitzender, Vorsitzender des TV Ober- Kreis- und Stadtrat, Bürgermeister a.D., Vorsit- Altbürgermeister, Kreisrat, Seniorenbeauftrag- Stadtrat, 1. Vorsitzender der Freien Turnerschaft Stellv. Ortsvereinsvors. SPD LIF, Leiter der Volley- Migrations- und Integrationsbeauftrager der wallenstadt, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr zender der Kultur- und Freizeitfreunde e.V. Bad ter, Schatzmeister BLSV-Kreis LIF, Kassier SPD- Schney, Stellv. Vorsitzender des SPD-OV Schney, ballabteilung TS LIF, Präsident der Ariccia-Abtei- SPD Lichtenfels, Mitglied der aktiven Bürger Das liegt uns am Herzen: Wallenstadt und der SK Oberwallenstadt. Staffelstein. -

Ziele Und Grundsätze
Raumstruktur Ziele und Grundsätze _________________________________________________________________________________ 2 Raumstruktur 2.1 Raumstrukturelles Leitbild (Stand 01.10.2000) 2.1.1 Die Region Nürnberg soll so entwickelt werden, dass die Funktionsfähigkeit der unter- schiedlich strukturierten Teilräume gewährleistet wird und sich die wesentlichen Funktio- nen in den einzelnen Teilräumen möglichst gegenseitig ergänzen und fördern. 2.1.2 Die polyzentrale Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur der Region soll in allen Teilräumen erhalten und weiterentwickelt werden. Eine weit gehende Vernetzung und Kooperation zwischen den einzelnen Teilräumen soll angestrebt werden. Auf eine räumlich, altersstrukturell und sozial ausgewogene Bevölkerungsentwicklung soll hingewirkt werden. 2.1.3 Der notwendige Ausbau der Infrastruktur soll weiter vorangetrieben werden und zur Stär- kung der zentralen Orte und Entwicklungsachsen beitragen. Die siedlungs- und wirt- schaftsstrukturelle Entwicklung soll sich in allen Teilräumen verstärkt an der Verkehrsan- bindung und -erschließung durch die Schiene orientieren. Auf eine günstigere Zuordnung der Funktionsbereiche Wohnen, Arbeiten, Versorgen und Erholen soll hingewirkt werden. 2.1.4 Die wertvollen Landschaftsteile der Region, die sich durch ihre Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, ihre Vielfalt und Schönheit, ihre Erholungseignung sowie ihre besondere klimatische oder wasserwirtschaftliche Funktion auszeichnen, sollen unter Berücksichti- gung der Belange und der Funktion der Land- und Forstwirtschaft dauerhaft -
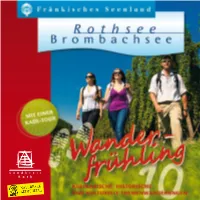
LR Wanderfr 10 05 INT.Pdf
Erleben Sie den Landkreis Roth diesmal aber auch mit dem Rad. Erstmalig wurde eine Radltour in den „Wander - frühling“ mit auf genommen. Auf der ehemaligen Bahntrasse der Lokalbahn „Gredl“ radln wir von Hilpoltstein über Seiboldsmühle, Alfershausen und Thalmässing in Richtung Greding. An der Strecke war- die kalte Jahreszeit hat sich verabschiedet, der Früh - tet so manche Attraktion und Aktion auf Sie. Lassen ling steht vor der Tür! Mit dem „Wanderfrühling 2010“ Sie sich das Mahlen von Mehl in der Schweizermüh - haben wir Ihnen auch dieses Jahr wieder einen bunten le bei Hilpoltstein erklären oder besichtigen Sie das Strauß an Themenwanderungen zusammengestellt. Michael-Kirschner-Museum in Stauf. Am Sportug - platz in Schutzendorf bietet sich die Möglichkeit, den Nördlich des Marktes Allersberg tauchen wir ein in Landkreis auch von der Luft aus zu entdecken. Und die vergangene Zeit der Drahtbarone Allersbergs. wem danach nach einer Stärkung ist, kann sich im Ein Besuch im Gilardihaus führt Ihnen deutlich den Milchhof Walter auf Yoghurt und frische Milch aus damaligen Lebensstil vor Augen. Lassen Sie Ihren Tag der Region freuen. anschließend in den Gaststätten und Cafés um den Allersberger Marktplatz ausklingen. Sie werden sehen, es ist für jeden Geschmack etwas Auf einem Teilstück des Jakobsweges von Nürnberg dabei! nach Ulm pilgern Sie dann an Pngsten von Schwabach über Kammerstein nach Abenberg und lassen sich bei Wir freuen uns auf Sie! meditativen Gedanken vom Alltag entrücken. Im Juni lockt schließlich eine besondere Dämmerungs - wanderung am Teufelsknopf! Fantasie und Wahrheit zahlreicher Sagen und Legenden treen sich hier im Waldgebiet um die Ruine Wartstein nahe dem Ort Herbert Eckstein Eichelburg am Rothsee.