Das Vergessen Der Pazifistischen Antisemitismusabwehr
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Holocaust/Shoah the Organization of the Jewish Refugees in Italy Holocaust Commemoration in Present-Day Poland
NOW AVAILABLE remembrance a n d s o l i d a r i t y Holocaust/Shoah The Organization of the Jewish Refugees in Italy Holocaust Commemoration in Present-day Poland in 20 th century european history Ways of Survival as Revealed in the Files EUROPEAN REMEMBRANCE of the Ghetto Courts and Police in Lithuania – LECTURES, DISCUSSIONS, remembrance COMMENTARIES, 2012–16 and solidarity in 20 th This publication features the century most significant texts from the european annual European Remembrance history Symposium (2012–16) – one of the main events organized by the European Network Remembrance and Solidarity in Gdańsk, Berlin, Prague, Vienna and Budapest. The 2017 issue symposium entitled ‘Violence in number the 20th-century European history: educating, commemorating, 5 – december documenting’ will take place in Brussels. Lectures presented there will be included in the next Studies issue. 2016 Read Remembrance and Solidarity Studies online: enrs.eu/studies number 5 www.enrs.eu ISSUE NUMBER 5 DECEMBER 2016 REMEMBRANCE AND SOLIDARITY STUDIES IN 20TH CENTURY EUROPEAN HISTORY EDITED BY Dan Michman and Matthias Weber EDITORIAL BOARD ISSUE EDITORS: Prof. Dan Michman Prof. Matthias Weber EDITORS: Dr Florin Abraham, Romania Dr Árpád Hornják, Hungary Dr Pavol Jakubčin, Slovakia Prof. Padraic Kenney, USA Dr Réka Földváryné Kiss, Hungary Dr Ondrej Krajňák, Slovakia Prof. Róbert Letz, Slovakia Prof. Jan Rydel, Poland Prof. Martin Schulze Wessel, Germany EDITORIAL COORDINATOR: Ewelina Pękała REMEMBRANCE AND SOLIDARITY STUDIES IN 20TH CENTURY EUROPEAN HISTORY PUBLISHER: European Network Remembrance and Solidarity ul. Wiejska 17/3, 00–480 Warszawa, Poland www.enrs.eu, [email protected] COPY-EDITING AND PROOFREADING: Caroline Brooke Johnson PROOFREADING: Ramon Shindler TYPESETTING: Marcin Kiedio GRAPHIC DESIGN: Katarzyna Erbel COVER DESIGN: © European Network Remembrance and Solidarity 2016 All rights reserved ISSN: 2084–3518 Circulation: 500 copies Funded by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media upon a Decision of the German Bundestag. -
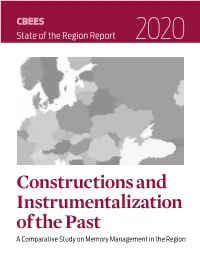
Constructions and Instrumentalization of the Past: a Comparative Study on Memory Management in the Region
CBEES State of the Region Report 2020 Constructions and Instrumentalization of the Past A Comparative Study on Memory Management in the Region Published with support from the Foundation for Baltic and East European Studies (Östersjstiftelsen) Constructions and Instrumentalization of the Past A Comparative Study on Memory Management in the Region December 2020 Publisher Centre for Baltic and East European Studies, CBEES, Sdertrn University © CBEES, Sdertrn University and the authors Editor Ninna Mrner Editorial Board Joakim Ekman, Florence Frhlig, David Gaunt, Tora Lane, Per Anders Rudling, Irina Sandomirskaja Layout Lena Fredriksson, Serpentin Media Proofreading Bridget Schaefer, Semantix Print Elanders Sverige AB ISBN 978-91-85139-12-5 4 Contents 7 Preface. A New Annual CBEES Publication, Ulla Manns and Joakim Ekman 9 Introduction. Constructions and Instrumentalization of the Past, David Gaunt and Tora Lane 15 Background. Eastern and Central Europe as a Region of Memory. Some Common Traits, Barbara Trnquist-Plewa ESSAYS 23 Victimhood and Building Identities on Past Suffering, Florence Frhlig 29 Image, Afterimage, Counter-Image: Communist Visuality without Communism, Irina Sandomirskaja 37 The Toxic Memory Politics in the Post-Soviet Caucasus, Thomas de Waal 45 The Flag Revolution. Understanding the Political Symbols of Belarus, Andrej Kotljarchuk 55 Institutes of Trauma Re-production in a Borderland: Poland, Ukraine, and Lithuania, Per Anders Rudling COUNTRY BY COUNTRY 69 Germany. The Multi-Level Governance of Memory as a Policy Field, Jenny Wstenberg 80 Lithuania. Fractured and Contested Memory Regimes, Violeta Davoliūtė 87 Belarus. The Politics of Memory in Belarus: Narratives and Institutions, Aliaksei Lastouski 94 Ukraine. Memory Nodes Loaded with Potential to Mobilize People, Yuliya Yurchuk 106 Czech Republic. -

The Jewish Contribution to the European Integration Project
The Jewish Contribution to the European Integration Project Centre for the Study of European Politics and Society Ben-Gurion University of the Negev May 7 2013 CONTENTS Welcoming Remarks………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1 Dr. Sharon Pardo, Director Centre for the Study of European Politics and Society, Jean Monnet National Centre of Excellence at Ben-Gurion University of the Negev Walther Rathenau, Foreign Minister of Germany during the Weimar Republic and the Promotion of European Integration…………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 Dr. Hubertus von Morr, Ambassador (ret), Lecturer in International Law and Political Science, Bonn University Fritz Bauer's Contribution to the Re-establishment of the Rule of Law, a Democratic State, and the Promotion of European Integration …………………………………………………………………………………………………………………8 Mr. Franco Burgio, Programme Coordinator European Commission, Brussels Rising from the Ashes: the Shoah and the European Integration Project…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13 Mr. Michael Mertes, Director Konrad-Adenauer-Stiftung, Israel Contributions of 'Sefarad' to Europe………………………………………………………………………………………………………………………21 Ambassador Alvaro Albacete, Envoy of the Spanish Government for Relations with the Jewish Community and Jewish Organisations The Cultural Dimension of Jewish European Identity………………………………………………………………………………….…26 Dr. Dov Maimon, Jewish People Policy Institute, Israel Anti-Semitism from a European Union Institutional Perspective………………………………………………………………34 -

Dezember 2017
★ ★ ★ Dezember ★ ★ 2017 ★ ★ ★ Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Europäischen Parlaments e. V. Editorial Rita Pawelski Informationen ...Grüße aus dem Saarland Termine Personalien Titelthemen Mitgliederreise Saarland und Luxemburg Berichte / Erlebtes Europäische Assoziation Jahreshauptversammlung in Bonn Mein Leben danach Erlesenes Aktuelles Die Geschäftsführerin informiert Jubilare © Carmen Pägelow Editorial Informationen Willkommen in der Vereinigung der ehemaligen Abgeordneten, Termine © Thomas Rafalzyk liebe neue Ehemalige! 20.03.2018 Frühlingsempfang der DPG (voraussichtlich) Für mehr als 200 Abgeordnete 21.03.2018 Mitgliederversammlung der DPG (voraussichtlich) beginnt nun eine neue Lebens- 14./15.05.2018 Mitgliederveranstaltung mit zeit. Sie gehören dem Deutschen Empfang des Bundespräsidenten / Bundestag nicht mehr an. Je Jahreshauptversammlung mit Wahl / nach Alter starten sie entweder Studientag „Die Zukunft Europas“ in eine neue Phase der Berufs- 12.-20. Juni 2018 Mitgliederreise nach Rumänien tätigkeit oder sie bereiten sich auf ihren dritten Lebensabschnitt vor. Aber egal, was für sie für sich und ihre Zukunft geplant haben: die Zeit im Bundestag ist nun Vergangenheit. Personalien Ich weiß aus Erfahrung, dass der Übergang in die neue Zeit von vielen Erinnerungen – und manchmal auch von Wehmut – begleitet wird. Man hat doch aus Überzeugung im Deutschen Bundestag gearbeitet… und oft auch mit Herzblut. Man hatte sich an den Arbeitsrhythmus gewöhnt und daran, dass der Tag oft 14 bis 16 Arbeitsstunden hatte. Man schätzte die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro, die Planungen über- © Deutscher Bundestag / Achim Melde nommen, Reisen gebucht, an Geburtstage erinnert, den Termin- kalender geführt, Sitzungen vorbereitet und Akten sortiert haben. Auf einmal ist man selbst dafür zuständig: welchen Zug muss ich nehmen, wann fährt der Bus, wer hat wann Geburtstag. -

SPD � 19863 B Dem Antrag Der Abgeordneten Ing Rid Köppe Und Der Gruppe BÜNDNIS 90/ Dr
Plenarprotokoll 12/229 Deutscher Bundestag Stenographischer Bericht 229. Sitzung Bonn, Freitag, den 20. Mai 1994 Inhalt: Erweiterung und Absetzung von Punkten in Verbindung mit von der Tagesordnung 19863 A Zusatztagesordnungspunkt 11: Zur Geschäftsordnung Beratung der Beschlußempfehlung und des Berichts des Innenausschusses zu Gunter Weißgerber SPD 19863 B dem Antrag der Abgeordneten Ing rid Köppe und der Gruppe BÜNDNIS 90/ Dr. Jürgen Rüttgers CDU/CSU 19864 B DIE GRÜNEN: Neue Kriminalpolitik — Hermann Rind F.D.P. 19865 A Initiative gegen Gewaltkriminalität durch Verschärfung des Waffenrechts Dr. Uwe-Jens Heuer PDS/Linke Liste . 19865D (Drucksachen 12/5948, 12/7442) Dr. Wolfgang Ullmann BÜNDNIS 90/DIE in Verbindung mit GRÜNEN 19866 D Zusatztagesordnungspunkt 12: Tagesordnungspunkt 23 a und d: Beratung der Beschlußempfehlung und Zweite und dritte Beratung des von den des Berichts des Innenausschusses Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. zu dem Entschließungsantrag der Frak- eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes tion der SPD zur Änderung des Strafgesetzbuches, der Straßprozeßordnung und anderer zu dem Entschließungsantrag der Abge- ordneten Ingrid Köppe und der Gruppe Gesetze (Verbrechensbekämpfungsge- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setz) (Drucksache 12/6853) Zweite und dritte Beratung des von der zur Großen Anfrage der Abgeordneten Fraktion der SPD eingebrachten Ent- Dr. Jürgen Meyer (Ulm) Günter Graf, Dr. Hans de With, weiterer Abgeord- wurfs eines Zweiten Gesetzes zur neter und der Fraktion der SPD Bekämpfung des illegalen Rauschgift- Si- handels und anderer Erscheinungsfor- cherheitsbedürfnis der Bevölkerung (Drucksachen men der Organisierten Kriminalität und Massenkriminalität (Drucksachen 12/6784, 12/7584, 12/7585) 12/5926, 12/5953, 12/3633, 12/5452, 12/7569) Beratung der Beschlußempfehlung und des Berichts des Innenausschusses zu Norbert Geis CDU/CSU 19868A dem Antrag der Abgeordneten Ulla Jelpke und der Gruppe der PDS/Linke Dr. -

KULTURA FIZYCZNA XII Nr 1
KULTURA FIZYCZNA XII nr 1 RADA NAUKOWA Ryszard ASIENKIEWICZ (Uniwersytet Zielonogórski) Tomáš DOHNAL (Uniwersytet Techniczny w Libercu) Karol FEČ (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach) Elena GODINA (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego, Sportu i Turystyki) Wiktor Władimirowicz GRIGORIEWICZ (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały) Jerzy KOSIEWICZ (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie) Wojciech LIPOŃSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu) Andrzej MALINOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Eligiusz MAŁOLEPSZY (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) Josef OBORNÝ (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie) Mirosław PONCZEK (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach) Joanna RODZIEWICZ-GRUHN (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) Lidia TEHAKO (Narodowa Akademia Nauk Białorusi) Bernard WOLTMANN (Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu) Barbara WOYNAROWSKA (Uniwersytet Warszawski) LISTA RECENZENTÓW dr hab. prof. UZ Piotr GODLEWSKI prof. dr hab. Karol FEČ dr hab. prof. AWF Tomasz JUREK dr hab. prof. AJD Eligiusz MAŁOLEPSZY dr hab. prof. AWF Leonard NOWAK prof. dr hab. Marek ORDYŁOWSKI dr hab. Artur PASKO prof. dr hab. Bernard WOLTMANN prof. dr hab. Stanisław ZABORNIAK dr hab. prof. AJD Klaudia ZUSKOVA Nadesłane do redakcji artykuły są oceniane anonimowo przez dwóch Recenzentów PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie KULTURA FIZYCZNA tom XII nr 1 pod redakcją Joanny Rodziewicz-Gruhn Eligiusza Małolepszego Częstochowa 2013 Redaktorzy naukowi Joanna RODZIEWICZ-GRUHN, Eligiusz MAŁOLEPSZY Sekretarz redakcji Arkadiusz PŁOMIŃSKI Redaktor statystyczny Paulina UCIEKLAK-JEŻ Redaktor językowy Dariusz JAWORSKI Redaktor naczelny wydawnictwa Andrzej MISZCZAK Korekta Dariusz JAWORSKI Redaktor techniczny Piotr GOSPODAREK Projekt okładki Sławomir SADOWSKI PISMO RECENZOWANE Pierwotną wersją periodyku jest publikacja papierowa © Copyright by Akademia im. -

Gegen Alle Machtblöcke Die Grünen, Der Ost-West-Konflikt Und Die Deutsche Frage
PAPERS JOCHEN WEICHOLD GEGEN ALLE MACHTBLÖCKE DIE GRÜNEN, DER OST-WEST-KONFLIKT UND DIE DEUTSCHE FRAGE ROSA LUXEMBURG STIFTUNG IMPRESSUM PAPERS 4/2019 wird herausgegeben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung V. i. S. d. P.: Henning Heine Franz-Mehring-Platz 1 · 10243 Berlin · www.rosalux.de ISSN 2194-0916 · Redaktionsschluss: Oktober 2019 Lektorat: TEXT-ARBEIT, Berlin Layout/Herstellung: MediaService GmbH Druck und Kommunikation Jochen Weichold Gegen alle Machtblöcke Die Grünen, der Ost-West-Konflikt und die deutsche Frage 30 Jahre nach dem Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) zur Bundesrepublik Deutschland (BRD) und drei Jahrzehnte nach dem Ende der Blockkonfrontation lohnt es sich, einen Blick zurück auf diese Ereignisse und auf die daran beteiligten politischen Kräfte zu werfen. Im Folgenden soll es um die Partei Die Grünen gehen, die Entwicklung ihrer Positionen zum Ost-West-Konflikt und zur darin eingebetteten deutschen Frage. Dabei ist die Positionierung der Grünen nur adäquat nachzuvollziehen, wenn man das generelle Politikverständnis der Akteure dieser Partei berücksichtigt. «Wir sind weder rechts noch links, sondern vorn!»,1 lautete das Credo, mit dem sich Die Grünen als «Alternative zu den herkömmlichen Parteien»2 Ende der 1970er Jahre präsentierten und sich quer zum bestehenden Parteiensystem in der BRD verorteten. Mit gleicher Radikalität postulierten sie in ihrem Saarbrücker Bundesprogramm von 1980 ihre Gegnerschaft zu den sogenannten Industriegesellschaften in Ost und West: «Sowohl aus der Wettbewerbswirtschaft als auch aus der Konzentration wirtschaftlicher Macht in staats- und privatkapitalistischen Monopolen gehen jene ausbeuterischen Wachstumszwänge hervor, in deren Folge die völlige Verseuchung und Verwüstung der menschlichen Lebensbasis droht.»3 Die Partei machte sich für einen ökologisch-humanistisch-pazifistischen dritten Weg stark. -

19. Oktober 1981: Sitzung Der Landesgruppe
CSU-LG – 9. WP Landesgruppensitzung: 19. 10. 1981 19. Oktober 1981: Sitzung der Landesgruppe ACSP, LG 1981: 15. Überschrift: »Protokoll der 18. Landesgruppensitzung am 19. Oktober 1981«. Zeit: 20.00–20.20 Uhr. Vorsitz: Zimmermann. Anwesend: Althammer, Biehle, Bötsch, Faltlhauser, Fellner, Geiger, Glos, Handlos, Hartmann, Höffkes, Höpfinger, Graf Huyn, Keller, Kiechle, Klein, Kraus, Kunz, Lemmrich, Linsmeier, Niegel, Probst, Regenspurger, Röhner, Rose, Rossmanith, Sauter, Spilker, Spranger, Stücklen, Voss, Warnke, Zierer, Zimmermann. Sitzungsverlauf: A. Bericht des Landesgruppenvorsitzenden Zimmermann über die Bonner Friedensdemonstration vom 10. Oktober 1981, die Haushaltslage, den Deutschlandtag der Jungen Union in Köln, die USA-Reise des CDU-Parteivorsitzenden Kohl und die Herzerkrankung des Bundeskanzlers. B. Erläuterungen des Parlamentarischen Geschäftsführers Röhner zum Plenum der Woche. C. Allgemeine Aussprache. D. Erläuterungen zu dem Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion zum Schutze friedfertiger Demonstrationen und Versammlungen. E. Vorbereitung der zweiten und dritten Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs über die Anpassung der Renten der gesetzlichen Rentenversicherung im Jahr 1982 und der zweiten und dritten Beratung des Entwurfs eines Elften Gesetzes über die Anpassung der Leistungen des Bundesversorgungsgesetzes (Elftes Anpassungsgesetz-KOV). [A.] TOP 1: Bericht des Vorsitzenden Dr. Zimmermann begrüßt die Landesgruppe. Er gratuliert den Kollegen Dr. Dollinger, Keller und Hartmann zu ihren Geburtstagen. Dr. Zimmermann betont, daß sich selten die politische Lage in der Bundesrepublik Deutschland zwischen zwei Landesgruppensitzungen so verändert habe: Friedensdemonstration1, Haushaltslage und Gesundheit des Kanzlers.2 Drei grundverschiedene Bereiche, von denen jeder allein auf die Koalition destabilisierende Wirkung habe. Was die Haushaltslage angehe, so bedeute eine Lücke von 5 bis 7 Mrd. DM, wie Matthöfer sie für den Haushalt 1982 zugebe, das Ende des vorliegenden Entwurfs.3 1 Zur Friedensdemonstration in Bonn am 10. -

Bibliotheksbestand LAMV Stand 16.01.2020.Xlsx
Verfasser Titel Untertitel Ort Jahr Signatur Kernkraft in der DDR: Zwischen nationaler Industriepolitik und sozialistischer Zusammenarbeit Kernenergieentwicklung in der DDR. Atomkraftwerke und Widerstand gegen Atomkraft in Abele, Johannes 1963-1990 der DDR. Dresden 2000 Ge-199/26 Politischer Umbruch und Neubeginn in Wismar von Politischer Umbruch in der DDR und in Wismar 1989.Vorgeschichte 1985-1989. Profilierung Abrokat, Sven 1989 bis 1990: der politischen Parteien.+ Dokumente Hamburg 1997 Ge-403 Ackermann, Anton An die lernende und suchende deutsche Jugend: Berlin; Leipzig 1946 DDR-212 Die Jenaer Schulen im Fokus der Staatssicherheit: Eine Abhandlung zur Mitarbeit von Lehrern und Schülern beim Ministerium für Staatssicherheit der DDR-Schulwesen. Führungs-IM -System in Jena. Mitarbeit von Lehrern und Schülern beim Ackermann, Jens P. DDR Ministerium für Staatssicherheit. Weimar 2005 Ge-1021 Christliche Frauen in der DDR: Alltagsdokumente Ackermann, Sonja einer Diktatur in Interviews Studie zur Situation christlicher Frauen in der DDR. 97 Interviews. Leipzig 2005 Ge-1024 A.S. Makarenko- Erzieher im Dienste der Bad Adolphes, Lotte Revolution: Versuch einer Interpretation Eine Makarenko-Studie. Godesberg 1962 Ge-1009 Agsten, Rudolf; Bogisch, LDPD auf dem Weg in die DDR: Zur Geschichte der Manfred LDPD in den Jahren 1946-1949 Berlin 1974 DDR-0001 Feiertage der DDR - Feiern in der DDR. Zwischen Ahbe, Thomas Umerziehung und Eigensinn Feiertage in der DDR. Ritale und Botschaften. Jugendweihe. Erfurt 2017 Ge-1744 Ostalgie: Zu ostdeutschen Erfahrungen und Ahbe, Thomas Reaktionen nach dem Umbruch Umgang mit DDR-Vergangenheit. Entstehung der Ostalgie nach 1990 und ihre Ursachen. Erfurt 2016 Ge-1668 Ostalgie: Zu ostdeutschen Erfahrungen und Ahbe, Thomas Reaktionen nach dem Umbruch Umgang mit DDR-Vergangenheit. -

Parteien in NRW
Stefan Marschall (Hg.) Parteien in NRW Stefan Marschall (Hg.) Parteien in NRW Liebe Leserin! Lieber Leser! Die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen fördert die politisch bildende Literatur, indem sie entsprechende Buchprojekte konzeptionell und redaktionell begleitet sowie finanziell unterstützt. Auch dieses Buch ist mit maßgeblicher Beteiligung der Landeszentrale entstanden. Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen 1. Auflage Juni 2013 Satz und Gestaltung: Klartext Medienwerkstatt GmbH, Essen (www.k-mw.de) Umschlaggestaltung: Volker Pecher, Essen ISBN ePDF 978-3-8375-1116-1 ISBN Print 978-3-8375-0771-3 Alle Rechte vorbehalten © Klartext Verlag, Essen 2013 www.klartext-verlag.de Inhalt Parteien in Nordrhein-Westfalen – Einleitung . 7 Stefan Marschall I. Querschnittsperspektiven Historische Dimensionen des Parteiensystems in Nordrhein-Westfalen . 17 Christoph Nonn Das NRW-Parteiensystem im Wandel – Ein schleichender Prozess? . 37 Christoph Strünck Parteienrechtliche Rahmenbedingungen in NRW – Von den Freiheiten der Landesverbände . 57 Heike Merten Die Parteiorganisationen in Nordrhein-Westfalen . 71 Marcel Lewandowsky Parteien und Verbände in Nordrhein-Westfalen . 91 Jürgen Mittag Parteien und Medien in Nordrhein-Westfalen – Das Beziehungsgeflecht von Politik und Medien aus journalistischer und parteipolitischer Sicht . 107 Melanie Diermann Parteien und Internet in Nordrhein-Westfalen . 127 Christoph Bieber Direkte Demokratie und Parteien in Nordrhein-Westfalen – Ein Nullsummenspiel? . 145 Andreas Kost -

Als PDF Zum Download
MONITORING (Extrem) rechte Strukturen #12 und das zivilgesellschaftliche September 2020 Gegenengagement. 33 36 (Extrem) Rechte organisieren sich Verschwörung und Antisemitismus in Hamburg gegen Covid-19 Sicher- - wie bedingen sie sich? heitsmaßnahmen oder geben ideolo- Wenn man über das Geldsystem redet, wird gische Grundlagen zur Corona-Kritik man sofort als Antisemit abgestempelt“, Ende April gab es eine Zunahme von Protes- äußerte Ken Jebsen schon 2016 auf einer ten gegen Corona-Maßnahmen, die zunächst KenFM-Demonstration vor dem Kanzler- unter der Bezugnahme auf das Grundgesetz amt. Seine Aussage erweckt den Eindruck, stattfanden. Verschwörungserzählungen dass an Machtinstitutionen geäußerte nahmen an Fahrtwind auf, insbesondere von Kritik sofort als Antisemitismus diffamiert Vertreter_innen, die sich als Allgemeinmedizi- wird. Warum seine Aussagen nicht antise- ner_innen äußerten. mitisch sind, erklärt er nicht. 312 Der Diaspora Salon Hamburg im Selbstinterview Der Diaspora Salon gründete sich Ende 2017 als Initiative von Freund*innen aus Ham- burg in Kooperation mit der GWA St. Pauli. Die Gruppe möchte eine Bühne bieten für (post-)migrantische Stimmen, Schwarze Perspektiven sowie Akteur*innen of Colour . 316 Vom vergessenen zum langsamen Erinnern Nach fast sechs Jahren ihres Bestehens erzielte die Initiative für ein Gedenken an Đỗ Anh Lân und Nguyễn Ngọc Châu einen Erfolg: Die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte hat sich endlich dafür ausgesprochen, dass in unmittelbarer Nähe des Tatortes ein würdiger Gedenkort geschaffen wird. Vorwort . 2 Das Mobile Beratungsteam gegen Blitzlichter Rechts . .20 Rechtsextremismus . 26 Vermischtes . 21 Impressum . 26 MONITORING #12 | SEPTEMBER 2020 VORWORT Die Monitoring-Berichte des MBT Hamburg beobachten die Organisations- und Aktionsformen der (extremen) Rechten genauso wie die ausgrenzenden Artikulations- und Ausdrucksformen der sogenannten Mitte der Gesellschaft. -

Gesetzentwurf Der Abgeordneten Dr
Deutscher Bundestag Drucksache 12/2112 12. Wahlperiode 18. 02. 92 Sachgebiet 100 Gesetzentwurf der Abgeordneten Dr. Wolfgang Schäuble, Dr. Wolfgang Bötsch, Johannes Gerster (Mainz), O tto Hauser (Esslingen), Dr. Rolf Olderog, Wilhelm Rawe, Dr. Else Ackermann, Ulrich Adam, Dr. Walter Franz Altherr, Anneliese Augustin, Jürgen Augustinowitz, Dietrich Austermann, Heinz-Günter Bargfrede, Dr. Wolf Bauer, Brigi tte Baumeister, Richard Bayha, Meinrad Belle, Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Hans-Dirk Bierling, Dr. Joseph-Theodor Blank, Renate Blank, Dr. Heribert Blens, Peter Bleser, Dr. Norbert Blüm, Wilfried Böhm (Melsungen), Dr. Maria Böhmer, Wolfgang Börnsen (Bönstrup), Friedrich Bohl, Wilfried Bohlsen, Jochen Borchert, Klaus Brähmig, Paul Breuer, Monika Brudlewsky, Georg Brunnhuber, Klaus Bühler (Bruchsal), Ha rtmut Büttner (Schönebeck), Dankward Buwitt, Manfred Cartens (Emstek), Peter Harry Carstensen (Nordstrand), Joachim Clemens, Wolfgang Dehnel, Gertrud Dempwolf, Karl Deres, Albe rt Deß, Renate Diemers, Werner Dörflinger, Hubert Doppmeier, Hansjürgen Doss, Dr. Alfred Dregger, Jürgen Echternach, Wolfgang Ehlers, Udo Ehrbar, Maria Eichhorn, Wolfgang Engelmann, Rainer Eppelmann, Horst Eylmann, Anke Eymer, Ilse Falk, Dr. Ku rt Faltlhauser, Jochen Feilcke, Dr. Karl H. Fell, Dirk Fischer (Hamburg), Leni Fischer (Unna), Winfried Fockenberg, Klaus Francke (Hamburg), Herbert Frankenhauser, Dr. Gerhard Friedrich, Erich G. Fritz, Hans-Joachim Fuchtel, Johannes Ganz (St. Wendel), Michaela Geiger, Norbert Geis, Dr. Heiner Geißler, Dr. Wolfgang von Geldern, Horst Gibtner, Michael Glos, Dr. Reinhard Göhner, Ma rtin Göttsching, Peter Götz, Dr. Wolfgang Götzer, Joachim Gres, Elisabeth Grochtmann, Wolfgang Gröbl, Claus-Peter Grotz, Dr. Joachim Grünewald, Horst Günther (Duisburg), Carl-Detlev Freiherr von Hammerstein, Klaus Harries, Gottfried Haschke (Großhennersdorf), Udo Haschke (Jena), Gerda Hasselfeldt, Rainer Haungs, Hansgeorg Hauser (Rednitzhembach), Klaus-Jürgen Hedrich, Manfred Heise, Dr.