Geschichtskultur Nach Auschwitz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Holocaust/Shoah the Organization of the Jewish Refugees in Italy Holocaust Commemoration in Present-Day Poland
NOW AVAILABLE remembrance a n d s o l i d a r i t y Holocaust/Shoah The Organization of the Jewish Refugees in Italy Holocaust Commemoration in Present-day Poland in 20 th century european history Ways of Survival as Revealed in the Files EUROPEAN REMEMBRANCE of the Ghetto Courts and Police in Lithuania – LECTURES, DISCUSSIONS, remembrance COMMENTARIES, 2012–16 and solidarity in 20 th This publication features the century most significant texts from the european annual European Remembrance history Symposium (2012–16) – one of the main events organized by the European Network Remembrance and Solidarity in Gdańsk, Berlin, Prague, Vienna and Budapest. The 2017 issue symposium entitled ‘Violence in number the 20th-century European history: educating, commemorating, 5 – december documenting’ will take place in Brussels. Lectures presented there will be included in the next Studies issue. 2016 Read Remembrance and Solidarity Studies online: enrs.eu/studies number 5 www.enrs.eu ISSUE NUMBER 5 DECEMBER 2016 REMEMBRANCE AND SOLIDARITY STUDIES IN 20TH CENTURY EUROPEAN HISTORY EDITED BY Dan Michman and Matthias Weber EDITORIAL BOARD ISSUE EDITORS: Prof. Dan Michman Prof. Matthias Weber EDITORS: Dr Florin Abraham, Romania Dr Árpád Hornják, Hungary Dr Pavol Jakubčin, Slovakia Prof. Padraic Kenney, USA Dr Réka Földváryné Kiss, Hungary Dr Ondrej Krajňák, Slovakia Prof. Róbert Letz, Slovakia Prof. Jan Rydel, Poland Prof. Martin Schulze Wessel, Germany EDITORIAL COORDINATOR: Ewelina Pękała REMEMBRANCE AND SOLIDARITY STUDIES IN 20TH CENTURY EUROPEAN HISTORY PUBLISHER: European Network Remembrance and Solidarity ul. Wiejska 17/3, 00–480 Warszawa, Poland www.enrs.eu, [email protected] COPY-EDITING AND PROOFREADING: Caroline Brooke Johnson PROOFREADING: Ramon Shindler TYPESETTING: Marcin Kiedio GRAPHIC DESIGN: Katarzyna Erbel COVER DESIGN: © European Network Remembrance and Solidarity 2016 All rights reserved ISSN: 2084–3518 Circulation: 500 copies Funded by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media upon a Decision of the German Bundestag. -
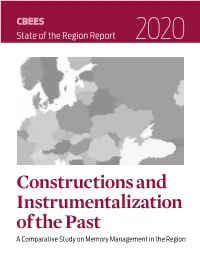
Constructions and Instrumentalization of the Past: a Comparative Study on Memory Management in the Region
CBEES State of the Region Report 2020 Constructions and Instrumentalization of the Past A Comparative Study on Memory Management in the Region Published with support from the Foundation for Baltic and East European Studies (Östersjstiftelsen) Constructions and Instrumentalization of the Past A Comparative Study on Memory Management in the Region December 2020 Publisher Centre for Baltic and East European Studies, CBEES, Sdertrn University © CBEES, Sdertrn University and the authors Editor Ninna Mrner Editorial Board Joakim Ekman, Florence Frhlig, David Gaunt, Tora Lane, Per Anders Rudling, Irina Sandomirskaja Layout Lena Fredriksson, Serpentin Media Proofreading Bridget Schaefer, Semantix Print Elanders Sverige AB ISBN 978-91-85139-12-5 4 Contents 7 Preface. A New Annual CBEES Publication, Ulla Manns and Joakim Ekman 9 Introduction. Constructions and Instrumentalization of the Past, David Gaunt and Tora Lane 15 Background. Eastern and Central Europe as a Region of Memory. Some Common Traits, Barbara Trnquist-Plewa ESSAYS 23 Victimhood and Building Identities on Past Suffering, Florence Frhlig 29 Image, Afterimage, Counter-Image: Communist Visuality without Communism, Irina Sandomirskaja 37 The Toxic Memory Politics in the Post-Soviet Caucasus, Thomas de Waal 45 The Flag Revolution. Understanding the Political Symbols of Belarus, Andrej Kotljarchuk 55 Institutes of Trauma Re-production in a Borderland: Poland, Ukraine, and Lithuania, Per Anders Rudling COUNTRY BY COUNTRY 69 Germany. The Multi-Level Governance of Memory as a Policy Field, Jenny Wstenberg 80 Lithuania. Fractured and Contested Memory Regimes, Violeta Davoliūtė 87 Belarus. The Politics of Memory in Belarus: Narratives and Institutions, Aliaksei Lastouski 94 Ukraine. Memory Nodes Loaded with Potential to Mobilize People, Yuliya Yurchuk 106 Czech Republic. -

The Jewish Contribution to the European Integration Project
The Jewish Contribution to the European Integration Project Centre for the Study of European Politics and Society Ben-Gurion University of the Negev May 7 2013 CONTENTS Welcoming Remarks………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1 Dr. Sharon Pardo, Director Centre for the Study of European Politics and Society, Jean Monnet National Centre of Excellence at Ben-Gurion University of the Negev Walther Rathenau, Foreign Minister of Germany during the Weimar Republic and the Promotion of European Integration…………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 Dr. Hubertus von Morr, Ambassador (ret), Lecturer in International Law and Political Science, Bonn University Fritz Bauer's Contribution to the Re-establishment of the Rule of Law, a Democratic State, and the Promotion of European Integration …………………………………………………………………………………………………………………8 Mr. Franco Burgio, Programme Coordinator European Commission, Brussels Rising from the Ashes: the Shoah and the European Integration Project…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13 Mr. Michael Mertes, Director Konrad-Adenauer-Stiftung, Israel Contributions of 'Sefarad' to Europe………………………………………………………………………………………………………………………21 Ambassador Alvaro Albacete, Envoy of the Spanish Government for Relations with the Jewish Community and Jewish Organisations The Cultural Dimension of Jewish European Identity………………………………………………………………………………….…26 Dr. Dov Maimon, Jewish People Policy Institute, Israel Anti-Semitism from a European Union Institutional Perspective………………………………………………………………34 -

KULTURA FIZYCZNA XII Nr 1
KULTURA FIZYCZNA XII nr 1 RADA NAUKOWA Ryszard ASIENKIEWICZ (Uniwersytet Zielonogórski) Tomáš DOHNAL (Uniwersytet Techniczny w Libercu) Karol FEČ (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach) Elena GODINA (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego, Sportu i Turystyki) Wiktor Władimirowicz GRIGORIEWICZ (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały) Jerzy KOSIEWICZ (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie) Wojciech LIPOŃSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu) Andrzej MALINOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Eligiusz MAŁOLEPSZY (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) Josef OBORNÝ (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie) Mirosław PONCZEK (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach) Joanna RODZIEWICZ-GRUHN (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) Lidia TEHAKO (Narodowa Akademia Nauk Białorusi) Bernard WOLTMANN (Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu) Barbara WOYNAROWSKA (Uniwersytet Warszawski) LISTA RECENZENTÓW dr hab. prof. UZ Piotr GODLEWSKI prof. dr hab. Karol FEČ dr hab. prof. AWF Tomasz JUREK dr hab. prof. AJD Eligiusz MAŁOLEPSZY dr hab. prof. AWF Leonard NOWAK prof. dr hab. Marek ORDYŁOWSKI dr hab. Artur PASKO prof. dr hab. Bernard WOLTMANN prof. dr hab. Stanisław ZABORNIAK dr hab. prof. AJD Klaudia ZUSKOVA Nadesłane do redakcji artykuły są oceniane anonimowo przez dwóch Recenzentów PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie KULTURA FIZYCZNA tom XII nr 1 pod redakcją Joanny Rodziewicz-Gruhn Eligiusza Małolepszego Częstochowa 2013 Redaktorzy naukowi Joanna RODZIEWICZ-GRUHN, Eligiusz MAŁOLEPSZY Sekretarz redakcji Arkadiusz PŁOMIŃSKI Redaktor statystyczny Paulina UCIEKLAK-JEŻ Redaktor językowy Dariusz JAWORSKI Redaktor naczelny wydawnictwa Andrzej MISZCZAK Korekta Dariusz JAWORSKI Redaktor techniczny Piotr GOSPODAREK Projekt okładki Sławomir SADOWSKI PISMO RECENZOWANE Pierwotną wersją periodyku jest publikacja papierowa © Copyright by Akademia im. -

Germany and Japan As Regional Actors in the Post-Cold War Era: a Role Theoretical Comparison
Alexandra Sakaki Germany and Japan as Regional Actors in the Post-Cold War Era: A Role Theoretical Comparison Trier 2011 GERMANY AND JAPAN AS REGIONAL ACTORS IN THE POST-COLD WAR ERA: A ROLE THEORETICAL COMPARISON A dissertation submitted by Alexandra Sakaki to the Political Science Deparment of the University of Trier in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Submission of dissertation: August 6, 2010 First examiner: Prof. Dr. Hanns W. Maull (Universität Trier) Second examiner: Prof. Dr. Christopher W. Hughes (University of Warwick) Date of viva: April 11, 2011 ABSTRACT Germany and Japan as Regional Actors in the Post-Cold War Era: A Role Theoretical Comparison Recent non-comparative studies diverge in their assessments of the extent to which German and Japanese post-Cold War foreign policies are characterized by continuity or change. While the majority of analyses on Germany find overall continuity in policies and guiding principles, prominent works on Japan see the country undergoing drastic and fundamental change. Using an explicitly comparative framework for analysis based on a role theoretical approach, this study reevaluates the question of change and continuity in the two countries‘ regional foreign policies, focusing on the time period from 1990 to 2010. Through a qualitative content analysis of key foreign policy speeches, this dissertation traces and compares German and Japanese national role conceptions (NRCs) by identifying policymakers‘ perceived duties and responsibilities of their country in international politics. Furthermore, it investigates actual foreign policy behavior in two case studies about German and Japanese policies on missile defense and on textbook disputes. -

Maschine Zur Brutalisierung Der Welt«
Axel Weipert Salvador Oberhaus Detlef Nakath Bernd Hüttner (Hrsg.) »Maschine zur Brutalisierung der Welt«? Der Erste Weltkrieg – Deutungen und Haltungen 1914 bis heute WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT WESTFÄLISCHES Weipert / Oberhaus / Nakath / Hüttner (Hrsg.) „Maschine zur Brutalisierung der Welt“? Axel Weipert / Salvador Oberhaus / Detlef Nakath / Bernd Hüttner (Hrsg.) „Maschine zur Brutalisierung der Welt“? Der Erste Weltkrieg – Deutungen und Haltungen 1914 bis heute WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT Gefördert durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung Inhalt Axel Weipert / Salvador Oberhaus / Detlef Nakath / Bernd Hüttner Vorwort der Herausgeber 7 Teil I: Erinnerung und geschichtspolitische Deutung Wolfgang Kruse Der Erste Weltkrieg im 20. Jahrhundert und Heute. Interpretationen und geschichtspolitische Zuweisungen in Wissenschaft und Politik 14 Jürgen Angelow Revisionistische Deutungen und linke Orientierungsangebote zum Kriegsausbruch von 1914 31 Salvador Oberhaus Über Verantwortlichkeiten nachdenken. Zur deutschen Politik in der Juli-Krise 57 Teil II: Die langen Linien: Erster Weltkrieg, Faschismus und Nationalsozialismus Marcel Bois Zurück ins Bewusstsein. Ein kurzer Ausblick auf hundert Jahre Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Revolution und Kriegsende 76 Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Ángel Alcalde Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über George L. Mosses These der Brutalisierung und ihre Kritik: Eine http://dnb.d-nb.de abrufbar. geschichtswissenschaftliche -

Memories of Heidelberg Kriegsblindkriegsblind Undund Friedenstaubfriedenstaub
Diego Castro: Memories of Heidelberg KriegsblindKriegsblind undund FriedenstaubFriedenstaub “Anerkennung der Ostgrenze Afghanistans”, Aktion vor der Deutschen Botschaft, Warschau, 2010 Diego Castro: Memories of Heidelberg Kriegsblind und Friedenstaub Gitte Bohr - Galerie für Kunst und politisches Denken, Berlin. In a solo-exhibition at Gitte Bohr Gallery, Diego Castro shows videos, drawings and an installation from a series of works, which deals with the return of an expansive and warlike Germany in the globalised context. In the works, he sardonically makes ambiguous connections between Germany’s foreign deployment of troops and politically incorrect references. A renaissance of restorative national politics is being approached with acid-tongued humour. Special guests: Erika Steinbach, Willy Brandt, Carl-Theodor zu Guttenberg, Pablo Picasso, Horst Köhler, Rudolf Hess, Nicole, Blondi and others. text by Eva May top: “Picasso-Retrospektive Kundus”, acrylic and wax on wood, behind closed grey curtain bottom: with curtain opened. measurements: 190 x 240 cm On February 6, 2003, the then U.S. Secretary of State, Colin Powell presented the UN and the world with so-called evidence of Iraqi possession of weapons of mass destruction. This became the basis for the invasion of Iraq a little over a month later. In a strange and symbolic gesture, the U.S. government had opted for hiding the large tapestry reproduction of Picasso’s Guernica that hangs in the vestibule of the UN building in which the presentation took place. The horrors of this famous -

2020 De Soet Jeannine Vanessa 1266901 Ethesis
This electronic thesis or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ Defence reviews in times of economic turmoil British and German reserve forces in transformation (2010-2015 / 1970-1979) De Soet, Jeannine V De Soet Awarding institution: King's College London The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. END USER LICENCE AGREEMENT Unless another licence is stated on the immediately following page this work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ You are free to copy, distribute and transmit the work Under the following conditions: Attribution: You must attribute the work in the manner specified by the author (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Non Commercial: You may not use this work for commercial purposes. No Derivative Works - You may not alter, transform, or build upon this work. Any of these conditions can be waived if you receive permission from the author. Your fair dealings and other rights are in no way affected by the above. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 27. Sep. 2021 KING’S COLLEGE LONDON University of London Faculty of Social Science and Public Policy School of Security Studies / School of Politics & Economics Department of War Studies / Department of Political Economy DOCTORAL THESIS Defence Reviews in Times of Economic Turmoil: British and German Reserve Forces in Transformation (2010-2015 / 1970-1979) Submitted by Jeannine V. -

Synagogue As Memorial: Architectural Interventions to Polish Synagogues Page 3 3 Rebecca D
OVERVIEW ABOUT THE AUSCHWITZ JEWISH CENTER Established in 2000, the Auschwitz Jewish Center (AJC), a partner of the Museum of Jewish Heritage—A Living Memorial to the Holocaust, is a cultural and educational institution located in Oświęcim, Poland. Located less than two miles from Auschwitz-Birkenau, the AJC strives to juxtapose the enormity of the destruction of human life with the vibrant lives of the Jewish people who once lived in the adjacent town and throughout Poland. The AJC’s mission is also to provide all visitors with an opportunity to memorialize victims of the Holocaust through the study of the life and culture of a formerly Jewish town and to offer educational programs that allow new generations to explore the meaning and contemporary implications of the Holocaust. The AJC—including a museum, education center, synagogue, and café—is a place of understanding, education, memory, and prayer for all people. In addition to on-site educational offerings, the AJC offers international academic opportunities including the American Service Academies Program, Fellows Program, Program for Students Abroad, Human Rights Summer Program, and Customized Programs throughout the year. REFLECTIONS | 2016 AUSCHWITZ JEWISH CENTER ANNUAL ALUMNI JOURNAL ABOUT REFLECTIONS Reflections is an annual academic journal of selected pieces by AJC program alumni. Its aim is to capture the perspectives, experiences, and interests of that year’s participants. The AJC Newsletter, published three times per year, provides snapshots of the Center’s work; Reflections is an in-depth supplement that will be published at the end of each year. The following are authored by alumni of the following programs: The American Service Academies Program (ASAP) is a two-week educational initiative for a select group of cadets and midshipmen from the U.S. -

Diego Castro Memories of Heidelberg: Kriegsblind Und Friedenstaub
presents: Diego Castro Memories of Heidelberg: Kriegsblind und Friedenstaub Opening: May 5, 19H Duration of exhibition: May 6 - 28, 2011 Thursday – Saturday 14 – 18H Die Erneuerung des Kniefalls von Warschau (2010). Super-8 transferred to DVD. Still. In a solo-exhibition in Gitte Bohr, Diego Castro shows videos, drawings and an installation from a series of works, which deals with the re- turn of an expansive and warlike Germany in the globalised context. In the works, he sardonically makes ambiguous connections between Germany’s foreign deployment of troops and politically incorrect references. A renais- sance of restorative national politics is being approached with acid-tongued humour. Special guests: Erika Steinbach, Willy Brandt, Carl-Theodor zu Guttenberg, Pablo Picasso, Horst Köhler, Rudolf Hess, Nicole, Blondi and others. ooo On February 6, 2003, the then U.S. Secretary of State, Colin Powell presented the UN and the world with so-called evidence of Iraqi possession of weapons of mass destruction. This became the basis for the invasion of Iraq a little over a month later. In a strange and symbolic gesture, the U.S. government had opted for hiding the large tapestry reproduction of Picas- so’s Guernica that hangs in the vestibule of the UN building in which the presentation took place. The horrors of this famous anti-war painting were meant to remain un-associated with what was going on before its blindfol- ded eyes. But the more clear it became that the invasion was based on a lie, the more that curtain became not only a symbol of the veil of deception, but something that could be read as a gesture of acknowledgement of the power of art and the relevance of Picasso’s message with his painting and stated hin his famous quote: ”Il faut créer des images inacceptables.” The presence of the curtain only made the picture’s critical eyes more piercing. -

Normalisierung Auf Umwegen. Polen in Den Politischen Konzeptionen Willy Brandts 1939-1966
35 Willy Brandts Kniefall vor dem Mahnmal im Warschauer Ghetto ist in die Ge- schichte eingegangen. Aber hat der deutsche Bundeskanzler sich wirklich für Polen interessiert? Wie intensiv und seit wann? Der Kölner Historiker Rainer Behring stellt diese Fragen und kommt zu einem irritierenden Befund: Brandts Blick nach Osten ging über Polen hinweg und richtete sich vor allem auf die Sowjetunion, die in seinen Augen lange keine Bedrohung für die Freiheit Polens darstellte. Das änderte sich erst 1947/48, als der Sozialdemokrat mit linkssozialistisch-revolutionärer Vergangenheit alle Illusionen über Moskau verlor. Polen gewann in Brandts Vorstellungswelt nun langsam eigenes Gewicht, auch wenn keine Rede davon sein kann, daß von solchen Einsichten ein gerader Weg zur Aussöhnung und zum Warschauer Vertrag von 1970 führte. ■■■■ Rainer Behring Normalisierung auf Umwegen Polen in den politischen Konzeptionen Willy Brandts 1939–1966 Die kollektive Erinnerung in Deutschland und der Welt verbindet die Begriffe Willy Brandt und Polen nahezu refl exartig mit dem Kniefall von Warschau am 7. Dezember 1970. Das Foto des knienden Bundeskanzlers vor dem Denkmal für die Opfer des Warschauer Ghettos ist „zur politischen Ikone geworden“1. Brandts Geste „verdichtete den moralischen Aspekt der Aussöhnung mit dem Osten; das Bild ging um die Welt und gehört seitdem zur Ikonographie der Bundesrepu- blik: Ein deutscher Bundeskanzler bat um Vergebung für die Verbrechen seines Volkes; der Kniefall war das spektakuläre Symbol der neuen Ostpolitik“2. So oder ähnlich lautet der Konsens in jüngeren Darstellungen zur Geschichte der Bundes- republik. Dabei bleibt durchaus unklar, wem Brandts Geste galt. Er selbst äußerte sich dazu stets denkbar vage3. -
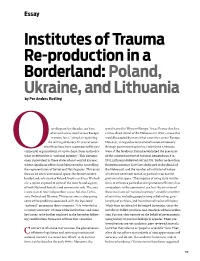
Institutes of Trauma Re-Production in a Borderland: Poland, Ukraine, and Lithuania by Per Anders Rudling
Essay Institutes of Trauma Re-production in a Borderland: Poland, Ukraine, and Lithuania by Per Anders Rudling ver the past few decades, we have trend started in Western Europe. It was France that frst observed a new trend across Europe: criminalized denial of the Holocaust in 1990, a move that “memory laws,” aimed at regulating would be copied by many other countries across Europe. the writing of history. In several coun- However, in regard to institutionalization of memory tries these have been accompanied by gov- through government agencies, Poland and Lithuania ernmental organizations set up to shape, form and police were at the forefront. Poland established the precursor what is referred to as “national memory.” This phenom- of the current Institute of National Remembrance in enon is prevalent in those states of east-central Europe, 1991, Lithuania followed suit in 1992. Today, no less than where signifcant eforts have been vested in controlling fourteen countries have laws dedicated to the denial of the representation of Soviet and Nazi legacies. This essay the Holocaust, and the number of institutes of nation- focuses on one transnational space, the former eastern al memory continues to rise, in particular across the borderlands of interwar Poland, known as Kresy Wschod- post-socialist space.3 The impetus of using state institu- nie, a region exposed to some of the most brutal aspects tions to enforce a particular interpretation of history has of both National Socialist and communist rule. The area antecedents in the communist era, but the activities of is now part of four independent states: Belarus, Lithu- these institutes of “national memory” straddle a number ania, Poland and Ukraine.