„Hie Ligt Begraben…“
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bade in Einem Meer Aus Blumen, Tauch Ein in Den Duftenden Tag Und Lass Dich Treiben in Blühenden Momenten
Pfarrverband St. Stefan ob Stainz Jahrgang 32 | Ausgabe 4 | Juli 2019 und St. Josef in der Weststeiermark Bade in einem Meer aus Blumen, tauch ein in den duftenden Tag und lass dich treiben in blühenden Momenten. GEDANKEN ZUR ZEIT Pfarrverband St. Stefan - St. Josef Pfarrverband Pfarrer St. Stefan - St. Josef Friedrich Trstenjak 8511 St. Stefan 12 03463/81215; Fax -15 [email protected] www.st-stefan-stainz.graz-seckau.at Alles hat seine Zeit! 8503 St. Josef 12 „Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte 03136/81173 Zeit: [email protected] www.st-josef-weststeiermark.graz- • eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben, eine Zeit zum Pflanzen und eine seckau.at Zeit zum Ausreißen der Pflanzen, • eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen, eine Zeit für die Klage und eine Pfarrer KonsR Kan. Friedrich Trstenjak Zeit für den Tanz, 0676/87426480 • eine Zeit zum Steinewerfen und eine Zeit zum Steine sammeln, eine Zeit zum Umar- [email protected] men und eine Zeit, die Umarmung zu lösen, Pastoralassistentinnen • eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren, eine Zeit zum Schweigen und eine Rita Harold Zeit zum Reden. 0676/87426965 • Was auch immer geschehen ist, war schon vorher da, und was geschehen soll, ist [email protected] schon geschehen und Gott wird das Verjagte wieder suchen. Silvia Treichler 0676/87426945 Alles hat seine Zeit deutet Kohelet (3,1-15). Davon spricht das Buch Kohelet und deutet [email protected] in verschiedenen Bildern das Leben des Menschen. -

Broschüre 2021
INFORMATIONS- BROSCHÜRE 2021 Marktgemeinde Lannach Fotos: P. Rimovetz P. Fotos: www.lannach.gv.at Stand 11/2020 1/18 Vorwort Bgm. Josef Niggas Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! Unsere neu gedruckte Infobroschüre bietet Ihnen die wesentlichen Angebote unserer Marktgemeinde. Neben den Kontaktdaten der Bediensteten der Gemeindeverwaltung und des Fuhrparks finden Sie in dieser Broschüre auch die wichtigsten Einrichtungen der Gemeinde sowie die Auflistung aller Vereine und Institutionen mit den Verantwortlichen. Trotz des dramatischen Einbruchs an Kommunalsteuer und Ertragsanteilen des Bundes durch die Coronakrise, ist es trotzdem für das kommende Jahr wiederum möglich, diverse Zuschüsse und Förderungen – wie kaum in einer anderen Gemeinde – zu gewähren. In der Hoffnung, Ihnen mit dieser Broschüre einen möglichst umfassenden Leitfaden über die wesentlichsten Gemeinde-Themen anbieten zu können, grüße ich Sie sehr herzlich. Sollten dennoch Fragen für Sie offenbleiben, finden Sie weitere Informationen auch auf unserer Homepage www.lannach.gv.at bzw. stehe ich gemeinsam mit meinem Team der Verwaltung gerne unterstützend zur Seite. Herzlichst Ihr Josef Niggas Bürgermeister Stand 11/2020 2/18 Kontakt Marktgemeinde Lannach Rathaus Hauptplatz 1 8502 Lannach Telefon: 03136/82104-0 Fax: 03136/82104-21 bzw. 20 E-Mail: [email protected] Homepage: www.lannach.gv.at Bürgermeister: Josef Niggas………………….……................82104-19 [email protected] Amtsleitung, OAR Ing. Daniel Kahr………….….………....82104-13 RHV, Wahlen, StA, [email protected] -
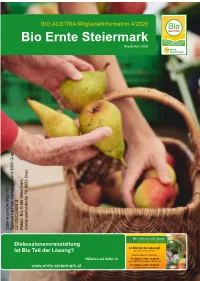
Bio Ernte Steiermark
BIO AUSTRIA Mitgliederinformation 4/2020 Bio Ernte Steiermark September 2020 bio ernte steiermark Österreichische Post AG Österreichische Post 8052 Graz Sponsoring Post Verlagspostamt GZ 03Z034858 S Retour: Bio Ernte Steiermark, Krottendorferstraße 79, 8052 Graz WirWir schauen schauen aufsaufs Ganze DieDie Biobäuerinnen Biobäuerinnen && BiobauernBiobauern Diskussionsveranstaltung IIst st BBioio TTeileil der Lösung? Auswege aus der globalen Krise Ist Bio Teil der Lösung? Impulsvorträge und Diskussion Impulsvorträge und Diskussion Näheres auf Seite 14 19.30.Oktober März 2020, 2020, 18.00 18.00 Uhr Uhr GemeindezentrumforumKLOSTER, Rathausplatz , 8181 Mitterdorf 5, 8200 an der Gleisdorf Raab 5 20. OktoberEintritt 2020, frei! 18.00 Uhr www.ernte-steiermark.at Kulturhaus Straden, 8345 Straden Bio-Kontrollkostenzuschuss nicht vergessen: Zahlung beantragen! Umsteller auf biologische Wirtschaftswei- % der bezahlten „Netto“ Bio-Kontrollkos- Das Formular „Zahlungsantrag“ findet se oder HofübernehmerInnen von einem ten ausmacht. Eine Unterbrechung für ein sich hier: Bio-Betrieb konnten den Bio-Kontrollkos- Jahr oder mehrere Jahre ist möglich. Es tenzuschuss in der ÖPUL-Programmpe- sind in der Programmlaufzeit max. 5 An- riode 2014-2020 über die Vorhabensart träge bzw. Auszahlungen des Kontrollkos- 3.1.1. (Teilnahme an Lebensmittel-Quali- tenzuschusses zulässig. tätsregelungen) beantragen und geför- dert werden. Im einmaligen Förderantrag Beizulegen sind die Rechnung der Kont- wurden die gesamten Kontrollkosten für rollstelle über die Flächenkontrollkosten fünf Jahre angeben. Es ist jedoch pro und den Grundbeitrag im Original, die jährlicher Kontrolle ein Zahlungsantrag Überweisungsbestätigung (Kontoauszug zu stellen! Im Laufe der Jahre kann dies oder Umsatzliste) des bezahlten Betrages Übernommen von natürlich leicht vergessen werden, was an die Kontrollstelle und eine Kopie des Bio-Zentrum Kärnten/ jedoch schade ist, da der Fördersatz 80 Kontrollvertrages. -

Stadtmagazin 5/2015
DEUTSCHLANDSBERG 08Z037783P AUSGABE 5/2015 P.B.B. Neu in der Stadt • Unser Hauptplatz – unsere Perle: Ihre Meinung ist uns wichtig! • Es weihnachtet sehr in Deutschlandsberg • 90 Jahre Rathaus • Veranstaltungskalender • Theater- und Konzertvorschau • Vereine stellen sich vor • In die Stadt kommt Bewegung • u. v. m. GEMEINDE-INFO Neu in der Stadt 4 Gebaut in der Stadt 7 Sprechstunden der Ortsteilvertreter; Bürgerservice 8 Einkaufsgutschein; Bereitschaftsdienst; Jagdpachtentgelt 9 City-Taxi Fahrplan; Wahlinformation 10 Jugendbeteiligungsprojekte 11 Unser Hauptplatz – unsere Perle: Ihre Meinung ist uns wichtig ! 11 Es weihnachtet sehr in Deutschlandsberg 12 Koralmtunnel KAT 2: Bisher 175 Mio. Euro für die Region 14 90 Jahre Rathaus 15 UMWELT Haus der Energie: Von der Artischocke bis zur Zitronengurke 16 Brennholzbörse 16 So schenken Sie nachhaltig 17 JUGEND & EKiZ: Ort der Begegnung und des Austauschs 18 BILDUNG Einschreibung für das Kindergartenjahr 2016/17 18 Kindergärten 19 Volksschulen berichten 20 NMS 1 und NMS 2 Deutschlandsberg 24 Neu: Mädchencafé 25 Musikschulen berichten 26 FS Schloss Frauenthal: Kursangebot für Erwachsene 29 Veranstaltungskalender zum Herausnehmen 30 KULTUR theaterzentrum: Programmvorschau 33 Verschiedene Veranstaltungstipps 34 Kulturkreis Deutschlandsberg: Die nächsten Konzerte 35 Archeo Norico: Rückblick auf die Museumssaison 2015 37 Künstlerporträt: In der Wolle liegt die Kraft 37 SPORT & FREIZEIT Jackpot: In die Stadt kommt Bewegung 38 Tag des Sports: Volltreffer auf ganzer Linie 39 Vereine stellen sich vor -

ÖKOPROFIT Deutschlandsberg Nachhaltige Wirtschaftsförderung Für Unternehmen Und Einrichtungen
ÖKOPROFIT Deutschlandsberg Nachhaltige Wirtschaftsförderung für Unternehmen und Einrichtungen GoWe = © Goach >> AUSZEICHNUNG 2013 >> Inhaltsverzeichnis >> Geleitworte ..................................................................................................... 3 >> Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit .................................................................. 4 >>>> Berater ........................................................................................................... 5 >> ÖKOPROFIT goes Steiermark ....................................................................... 6 >> Bericht ÖKOPROFIT Deutschlandsberg 2013 ................................................. 8 >> Internorm Bauelemente GmbH ........................................................................ 10 >> Landesfeuerwehrverband Steiermark .............................................................. 12 >> LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH .................................. 14 >> MSG Mechatronic Systems GmbH .................................................................. 16 >> Nahwärme Eibiswald eGen ............................................................................. 18 >> Nahwärme Gleinstätten GmbH ........................................................................ 20 >> Partner ........................................................................................................... 22 << 2 ÖKOPROFIT Deutschlandsberg >> Geleitworte Mag. Christoph Holzner Geschäftsführer, CPC Austria „Nachhaltiges Wirtschaften“ -

A Prämiete Betriebe 2012 Nach Gemeinde
Landesprämierung Steirisches Kürbiskernöl g.g.A 2012 Bezirk Deutschlandsberg Bad Gams Ganster Rudolf Niedergams 31 8524Bad Gams Deutsch Barbara Furth 1 8524Bad Gams Deutschlandsberg Reiterer Josef Bösenbacherstraße 94 8530 Deutschlandsberg Eberhardt Margaretha Dorfstraße 29 8530 Deutschlandsberg Leopold Ölmühle Frauentalerstraße 120 8530 Deutschlandsberg Schmuck Johann Blumauweg-Wildbach 77 8530 Deutschlandsberg Hamlitsch KG Ölmühle Wirtschaftspark 28 8530 Deutschlandsberg Frauental an der Laßnitz Jauk Josef Grazerstraße 231 8523 Frauental an der Laßnitz Groß Sankt Florian Weißensteiner Gabriele Vocherastraße 27 8522 Groß Sankt Florian Schmitt Jakob Kelzen 14 8522 Groß Sankt Florian Wieser Johann Grazerstraße 118 8522 Groß Sankt Florian Otter Anton Gussendorfgasse 21 8522 Groß Sankt Florian Jauk Josef Hubert Petzelsdorfstraße 31 8522 Groß Sankt Florian Großradl Wechtitsch Angelika Oberlatein 32 8552 Großradl Lannach Jöbstl Prof. Mag. MAS Hauptstraße 7 8502 Lannach Niggas Theresia Radlpaßstraße 13 8502 Lannach Rumpf Herta Kaiserweg 4 8502 Lannach Limberg bei Wies Gollien Josef Eichegg 62 8542 Limberg bei Wies Pitschgau Stampfl Gudrun Hörmsdorf 23 8552 Pitschgau Kürbisch Anna Bischofegg 20 8455 Pitschgau Kainacher Inge Haselbach 8 8552 Pitschgau Jauk Karl Heinz Bischofegg 14 8455 Pitschgau Pölfing-Brunn Michelitsch Karl Pölfing 29 8544 Pölfing-Brunn Jauk Christian Brunn 45 8544 Pölfing-Brunn Preding Gurt Dorothea Preding 80 8504 Preding Bauer Margarete Wieselsdorf 38/39 8504 Preding Hödl Elisabeth Klein-Preding 36 8504 Preding Rassach Zmugg Johann Rassach 23 8510 Rassach Wippel Herbert Lasselsdorf 41 8522 Rassach Becwar Ing. Ulrike Herbersdorf 9 8510 Rassach Hirt Renate Herbersdorf 35 8510 Rassach Simon Josef Graschuh 18 8510 Rassach Primus Josefine Rassach 62 8510 Rassach Bauerngemeinschaft Rassach Rassach 45 8510 Rassach Sankt Josef Kokal Robert St. -

Deutschlandsberg, Steiermark, Die Kraft Gesetzlicher Vermutung Unter Denkmalschutz Stehen, Unter Die Bestimmungen Des § 2A Denkmalschutzgesetz Gestellt Werden
Verordnung des Bundesdenkmalamtes vom 20. Februar 2001, mit der 117 unbewegliche Denkmale des politischen Bezirkes Deutschlandsberg, Steiermark, die kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehen, unter die Bestimmungen des § 2a Denkmalschutzgesetz gestellt werden. Gemäß § 2a des Denkmalschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 170/1999, wird verordnet: § 1 Folgende 117 unbeweglichen Denkmale des politischen Bezirkes Deutschlandsberg, Steiermark, werden unter die Bestimmungen des § 2a Denkmalschutzgesetz gestellt: Objekt Adresse Gemeinde Ger.Bez. Gdst.Nr. EZ KG Kath. Filialkirche St. 8552 Aibl Eibiswald .143; 114 61139 Anton in Bachholz/Hl. .144 St Lorenzen Antonius der Einsiedler Kath. Filialkirche 8552 Aibl Eibiswald .103 51 61139 St. Leonhard in der Ebene St. Lorenzen Kath. Pfarrkirche 8552 Aibl Eibiswald .54/1 36 61139 hl. Laurentius St. Lorenzen Pfarrhof 8552 Aibl Eibiswald .55 15 61139 St. Lorenzen Messkapelle hl. Klemens 8552 Aibl Eibiswald 102/5 38 61137 Rothwein Hauptschule Aichberg 4 8552 Aibl Eibiswald .65 118 61102 Aichberg Kath. Pfarrkirche 8524 Bad Stainz .1 43 61207 hl. Bartholomäus Gams Gams Pfarrhof Bad Gams 1 8524 Bad Stainz .2 278 61207 Gams Gams Kammer für Arbeiter und Rathausgasse 8530 Deutschla .254 311 61006 Angestellte 3 Deutschlandsb ndsberg Deutsch- erg landsberg Bezirkshauptmannschaft Kirchengasse 1 8530 Deutschla .136 83 61006 2 Deutschlandsb ndsberg Deutsch- erg landsberg Bezirkshauptmanschaft/ Kirchengasse 7 8530 Deutschla .100 83 61006 Gesundheitsamt Deutschlandsb ndsberg Deutsch- erg landsberg Rathaus Hauptplatz 35 8530 Deutschla .53/1 55 61006 Deutschlandsb ndsberg Deutsch- erg landsberg Bezirksgericht Hauptplatz 18 8530 Deutschla .2 67 61006 Deutschlandsb ndsberg Deutsch- erg landsberg Kath. Pfarrkirche 8530 Deutschla .1 95 61006 Allerheiligen Deutschlandsb ndsberg Deutsch- erg landsberg Burgruine Burgstraße 19 8530 Deutschla .2/1; .2/2; 95 61005 Deutschlandsberg Deutschlandsb ndsberg 233/7; Burgegg erg 233/11; 24 Kath. -

Landesprämierung Steirisches Kürbiskernöl G.G.A. 2020 Bezirk Deutschlandsberg Deutschlandsberg Deutsch Barbara Furth 1 8524 Bad Gams Eberhardt Martina U
Landesprämierung Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. 2020 Bezirk Deutschlandsberg Deutschlandsberg Deutsch Barbara Furth 1 8524 Bad Gams Eberhardt Martina u. Andreas Dorfstraße 29 8530 Deutschlandsberg Farmer-Rabensteiner Furth 8 8524 Bad Gams Ganster Rudolf Niedergams 31 8524 Bad Gams Hamlitsch GmbH & Co KG Wirtschaftspark 28 8530 Deutschlandsberg Imhof Alexander Freidorf 5 8542 Sankt Peter im Sulmtal Leopold - Mühle - KG Frauentalerstraße 120 8530 Deutschlandsberg Mandl Manfred Niedergams 22 8524 Bad Gams Reiterer Josef Bösenbacherstraße 94 8530 Deutschlandsberg Schmuck Isabella Blumauweg 77 8530 Deutschlandsberg Eibiswald EMK Handel Moser Peter e.U. Hörmsdorf 133 8552 Eibiswald Grubelnik "Aibler Ölpresse" Martin Aibl 201 8552 Eibiswald Kainacher Anton Haselbach 8 8552 Eibiswald Kremser Gudrun Hörmsdorf 23 8552 Eibiswald Kürbisch Andreas Bischofegg 20 8455 Oberhaag Moser Peter Hörmsdorf 133 8552 Eibiswald Groß Sankt Florian Floriani-Ölmühle Marktring 17 a 8522 Groß Sankt Florian Jauk Josef u. Aloisia Petzelsdorfstraße 31 8522 Groß Sankt Florian Jauk Gregor Petzelsdorfstraße 31 8522 Groß Sankt Florian Lamprecht Stefan Kraubathstrasse 34 8522 Groß Sankt Florian Mandl jun. Anton Nassau 8 8522 Groß Sankt Florian Schmitt Margret Kelzen 14 8522 Groß Sankt Florian Stelzer Manfred u. Gertrude Florianerstraße 61 8522 Groß Sankt Florian Wieser Johann u. Waltraud Grazerstraße 118 8522 Groß Sankt Florian Lannach Jöbstl Karl Teiplbergstraße 64 8502 Lannach Niggas Theresia Radlpaßstraße 13 8502 Lannach Rumpf Herta Kaiserweg 4 8502 Lannach Pölfing-Brunn Gaisch Udo-Markus Jagernigg 15 8544 Pölfing Brunn Jauk Christian Brunn 45 8544 Pölfing Brunn Mayer Adolf Hauptstraße 235 8544 Pölfing Brunn Orthaber Annemarie Pölfing 8 8544 Pölfing Brunn Zöhrer Manfred Brunn 46 8544 Pölfing Brunn Preding Bauer Erwin Wieselsdorfer Straße 51 8504 Preding Gurt Stefan Gruberweg 17 8504 Preding Hödl Elisabeth u. -

Bezirksprofil Deutschlandsberg
Deutschlandsberg A12 - Wirtschaft und Tourismus | Referat Tourismus TOURIS FACT SHEET (Bezirk) Das (Tourismus)Jahr 2020: Daten & Fakten Region & Angebot Nachfrage & Herkunft Umsatz & Beschäftigte Strukturen (Stand Januar 2021) Nachfrageindikatoren2 2020 Sparte „Tourismus- & Freizeitwirtschaft“5 Merkmal Anzahl Anteil STMK 1 Indikator DL STMK Rang3 Indikator DL STMK Rang Tourismusverbände 4 4,2% Nächtigungen 175.485 11.263.534 12 Beschäftigte (Stand 2019)6 1.707 49.717 11 davon Einzelverbände 1 1,7% Veränderung zum Vorjahr -17,0% -14,8% 7 Veränderung zum Vorjahr +4,6% +2,6% 3 davon §4 Abs. 3 Verbände 3 8,3% Trend 2016-2020 -12,6% -9,1% 6 Trend 2015-2019 +8,0% +8,4% 5 Anteil an STMK-Nächtigungen 1,6% - 12 Tourismusgemeinden (Ortskl.: A, B, C) 11 5,0% Anteil an STMK-Beschäftigten 3,4% - 11 Nächtigungsdichte4 2,9 9,0 11 davon in §4 Abs. 3 Verbänden 10 6,3% Anteil geringfügig Beschäftigte 24,4% 19,7% 2 Ausländeranteil 22,3% 36,8% 9 Nicht-Tourismusgemeinden (Ortskl.: D) 4 6,1% Anteil Frauen 73,1% 67,2% 4 Ankünfte 61.306 3.420.236 12 Umsatz (in Mio. €; Stand 2018)7 67,1 2.268,4 11 Veränderung zum Vorjahr -21,8% -20,4% 8 Veränderung zum Vorjahr +2,4% +4,1% 8 Tourismusverbände (Stand Januar 2021) Trend 2016-2020 -16,6% -13,9% 6 Anteil an STMK-Umsatz 3,0% - 11 §4 Abs. 3 Verbände Anteil an STMK-Ankünften 1,8% - 12 Tourismus- und Freizeitbetriebe8 796 15.954 10 Ausländeranteil 18,9% 29,9% 9 Mittlere Aufenthaltsdauer 2,9 3,3 8 Anteile der einzelnen Fachverbände Inländer 2,7 3,0 7 (Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen) Ausländer 3,4 4,0 9 Beschäftigte Umsatz FV 601 9% 10% FV 602 TOP5-Herkunftsländer 2020 (Nächtigungen) 26% 31% 44% 59% FV 603 Land Anteil an ausländ. -

Bgbl II 243/2012
1 von 4 BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 2012 Ausgegeben am 4. Juli 2012 Teil II 243. Verordnung: Bezirksgerichte-Verordnung Steiermark 2012 243. Verordnung der Bundesregierung über die Zusammenlegung von Bezirksgerichten und über die Sprengel der verbleibenden Bezirksgerichte in der Steiermark (Bezirksgerichte-Verordnung Steiermark 2012) Auf Grund des § 8 Abs. 5 lit. d des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920, BGBl. Nr. 368/1925, in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 64/1997 und der Kundmachung BGBl. I Nr. 194/1999 wird mit Zustimmung der Steiermärkischen Landesregierung verordnet: Zusammenlegung von Bezirksgerichten § 1. Folgende in der Steiermark gelegene Bezirksgerichte werden zusammengelegt: Aufnehmende Bezirksgerichte 1. Bad Radkersburg Feldbach 2. Frohnleiten Graz-West 3. Gleisdorf Weiz 4. Hartberg Fürstenfeld 5. Irdning Liezen 6. Knittelfeld Judenburg 7. Stainz Deutschlandsberg Sprengel der Bezirksgerichte § 2. In der Steiermark bestehen folgende Bezirksgerichte, deren Sprengel nachgenannte Gemeinden umfassen: Bezirksgericht Gemeinden 1. Bruck an der Mur Aflenz Kurort, Aflenz Land, Breitenau am Hochlantsch, Bruck an der Mur, Etmißl, Frauenberg, Gußwerk, Halltal, Kapfenberg, Mariazell, Oberaich, Parschlug, Pernegg an der Mur, Sankt Lorenzen im Mürztal, Sankt Ilgen, Sankt Katharein an der Laming, Sankt Marein im Mürztal, Sankt Sebastian, Thörl, Tragöß, Turnau. 2. Deutschlandsberg Aibl, Bad Gams, Deutschlandsberg, Eibiswald, Frauental an der Laßnitz, Freiland bei Deutschlandsberg, Garanas, Georgsberg, Greisdorf, Gressenberg, Groß Sankt Florian, Großradl, Gundersdorf, Hollenegg, Kloster, Lannach, Limberg bei Wies, Marhof, Osterwitz, Pitschgau, Pölfing-Brunn, Preding, Rassach, Sankt Josef (Weststeiermark), Sankt Martin im Sulmtal, Sankt Oswald ob Eibiswald, Sankt Peter im Sulmtal, Sankt Stefan ob Stainz, Schwanberg, Soboth, Stainz, Stainztal, Stallhof, Sulmeck-Greith, Trahütten, Unterbergla, Wernersdorf, Wettmannstätten, Wielfresen, Wies. 3. -

GB Gbstv OB Obstv 2016 Bis 2021
GB, GB Stv. Adresse PLZ Ort Gemeinde /Ortsteil OB, OB Stv. Vorname Name Telefon E-Mail Deutschlandsberg GB Karoline Bachfischer Bösenbacherstr. 5 8530 Deutschlandsberg 0664 81 23 30 60 [email protected] Trahütten GB Stv., OB Gabriele Wallner Trahütten 29 8530 Deutschlandsberg 0676 64 58 388 [email protected] Burgegg, Leibenfeld, Warnblick OB Josefa Jauk Schlossweg 45 8530 Deutschlandsberg 0680 21 90 329 [email protected] Kloster OB Irmgard Kügerl Rettenbach 5 8530 Deutschlandsberg 03469 546 [email protected] Osterwitz OB Elisabeth Vriznik Osterwitz 23 8530 Deutschlandsberg 0664 57 36 372 [email protected] Deutschlandsberg OB Stv. Martina Eberhardt Dorfstraße 29 8530 Deutschlandsberg 0664 86 67 960 [email protected] Deutschlandsberg OB Stv. Gertraud Herk Hinterleitenstr.321b 8530 Deutschlandsberg 0664 50 88 252 [email protected] Trahütten OB Stv. Rosemarie Lenz Rostock 32 8530 Deutschlandsberg 0676 52 46 850 [email protected] Osterwitz OB Stv. Maria Reinisch Osterwitz 26 8530 Deutschlandsberg 03469 580 [email protected] Kloster OB Stv. Christine Ripper Kloster 30 8530 Deutschlandsberg 03469 620 Eibiswald GB Angelika Wechtitsch Oberlatein 32 8552 Eibiswald 0664 73 68 80 15 [email protected] Soboth GB Stv., OB Manuela Temmel Soboth 62 8554 Soboth 0664 11 37 252 [email protected] Aibl, St.Lorenzen, Rothwein OB Annemarie Brauchart Aibl 14 8552 Eibiswald 0650 30 14 687 [email protected] Kornriegl, Großradl OB Gabriele Marauli Kornriegl 28 8552 Eibiswald 0664 26 07 866 [email protected] St. Oswald ob Eibiswald OB Elisabeth Mauthner Krumbach 30 8553 St.Oswald/E. 0664 49 16 035 [email protected] Aichberg, Staritsch OB Hermine Rossmann Aichberg 31 8552 Eibiswald 0664 73 59 18 80 Stammeregg OB Renate Silly Stammeregg 15 8552 Eibiswald 0664 55 33 341 [email protected] Aibl, St.Lorenzen, Rothwein OB Stv. -

Schwanbergerinnen Und Schwanberger!
Amtliche Mitteilung Gemeindenachrichten zugestellt durch post.at BAD CHWANBERG Stransparent 1/2021 transparent 1/2021 1 Gemeindenachrichten Liebe Schwanbergerinnen und Schwanberger! Die Pandemie hat auch finanzielle musbüro ist die neue Postpartner- Auswirkungen auf unser Gemein- stelle seit Februar eingerichtet. debudget. So haben wir 2020 und In Hollenegg wird eine ein- auch 2021 mit Einnahmenverlus- drucksvolle Kunstinstallation ten von jeweils 500 000 Euro zu umgesetzt. Beim Entstehen des rechnen. Trotz dieser wirtschaft- Projekts Meerohr können wir als lichen Folgen planen wir in die- Zuschauer beiwohnen. Dieser sem Jahr einige wichtige Investi- Brunnen wird dann eine dauer- tionen. So wird die Sanierung des hafte Kunstattraktion bleiben. Kindergartens in Hollenegg abge- Das Land Steiermark führt eine schlossen - die Fassade und der Reform der Tourismusstruktur Sanitärbereich werden erneuert. durch. Die 10 Tourismusverbän- Bei der Volksschule Hollenegg de der Bezirke Deutschlandsberg werden wir einen öffentlichen und Leibnitz werden zur Erlebnis- Spielplatz errichten. Wichtige In- region Südsteiermark zusammen- vestitionen werden in die Sanie- gefasst. Damit soll die touristische Seit fast genau einem Jahr hat die rung des Wasserleitungsnetzes Entwicklung unserer Region leis- Corona – Pandemie gravierende getätigt. So werden die Wasser- tungsfähiger und schlagkräftiger Auswirkungen auf unser Leben. leitungen nach Hohlbach, im Be- werden. Viele Menschen sind leicht oder reich der Edensiedlung und am Unser Herr Pfarrer hat seinen 70. schwer erkrankt und viele leider Sportplatzweg erneuert. Im Stra- Geburtstag gefeiert. Ich möchte auch gestorben. Viele haben ihren ßenbereich werden in allen vier ihm auf diesem Wege noch einmal Arbeitsplatz verloren oder einen Ortsteilen Sanierungen durchge- herzlich gratulieren und mich für großen wirtschaftlichen Schaden führt. Die Straße von Trag nach sein Wirken in unserer Gemeinde erlitten.