Oberläufe Der Gersprenz (6319-302)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

1986L0465 — Fr — 13.03.1997 — 003.001 — 1
1986L0465 — FR — 13.03.1997 — 003.001 — 1 Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions ►BDIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juillet 1986 concernant la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/ CEE (république fédérale d'Allemagne) (86/ /CEE) (JO L 273 du 24.9.1986, p. 1) Modifiée par: Journal officiel no page date ►M1 Directive 89/586/CEE du Conseil du 23 octobre 1989 L 330 1 15.11.1989 ►M2 Décision 91/26/CEE de laCommission du 18 décembre 1990 L 16 27 22.1.1991 ►M3 Directive 92/92/CEE du Conseil du 9 novembre 1992 L 338 1 23.11.1992 ►M4 modifiée par la décision 93/226/CEE de la Commission du 22 avril L 99 1 26.4.1993 1993 ►M5 modifiée par ladécision 97/172/CE de laCommission du 10 février L 72 1 13.3.1997 1997 ►M6 modifiée par ladécision 95/6/CE de laCommission du 13 janvier L 11 26 17.1.1995 1995 1986L0465 — FR — 13.03.1997 — 003.001 — 2 ▼B DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juillet 1986 concernant la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (république fédérale d'Allemagne) (86/ /CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agricul- ture de montagne et de certaines zones défavorisées (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2, vu laproposition de laCommission, vu l'avis de l'Assemblée (3), considérant que la directive 75/270/CEE -

Besiedlung Seit 7.000 Jahren
Hügelgräber Besiedlung seit 7.000 Jahren Panoramafoto des größten Hügelgrabes im Hübnerwald nahe der Tafel. Hügelgräber standen bei ihrer Anlage frei von allen Seiten sichtbar und waren von einem kultisch genutzten Areal umgeben. Dies ist im heute dicht bewachsenen Hübnerwald kaum mehr vorstellbar. Die Vor- und Frühgeschichte in Stockstadt am Main 1950 wurden in der Flur „kleiner Sand“ aufgereihte Findlinge entdeckt, die Aus der Jungsteinzeit ist uns der erste Hinweis auf menschliches Wir- sich als ein angeschnittenes Hügelgrab herausstellten. In der ausgehobe- ken in Stockstadt überliefert. nen Grube zeigte sich eine dunkel verfärbte Sandschicht mit Holzkohlere- Auf der Gersprenzinsel fand sten sowie mit 13 kleineren und man ein Hirschgeweihstück einer größeren Gefäßscherbe. mit Bearbeitungsspuren, das Im Hübnerwald fanden sich in als Sichel oder Erntemesser mehreren Hügelgräbern Ge- genutzt wurde. Das Original wandnadeln, so genannte Bril- wurde im 2. Weltkrieg zer- lenspiralen, Bruchstücke von stört. Eine Nachbildung ist im Bronzeschmuck sowie Keramik- Heimatmuseum Stockstadt scherben. zu sehen. 1978 grub das hessische Denk- malamt Darmstadt direkt an der Von der Gersprenzinsel stam- bayerisch-hessischen Grenze men zahlreiche Steinbeile ein Hügelgrab aus, das der von Band- und Schnurkera- Hallstattzeit zuzuordnen ist. Es mikern aus der Jungsteinzeit, liegt in unmittelbarer Nähe der aus der Bronzezeit von den Grabhügelgruppe auf den Sand- Mittels der Technik des Airborne-Laser-Scans (ALS) kann das Bodenrelief unter der Waldbedeckung sicht- Glockenbecherleuten bis zur Im Heimatmuseum ist eine römische Brandbestat- dünen an der Papiermühle. Die bar gemacht werden. Ein Flugzeug sendet Laserstrah- Urnenfelderzeit. tung rekonstruiert. Funde kamen nach Darmstadt. Bei den Museen der Stadt Aschaffenburg hat sich len auf den Erdboden, der von dort relektiert wird. -
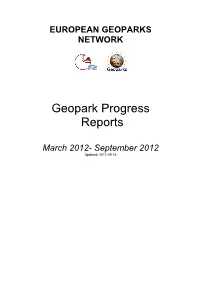
Geopark Progress Reports
EUROPEAN GEOPARKS NETWORK Geopark Progress Reports March 2012- September 2012 Updated: 2012-09-16 INDEX OF GEOPARKS Page Adamello Brenta – ITALY 3 Apuan Alps - ITALY 5 Arouca - PORTUGAL 7 Basque Coast – SPAIN 9 Bauges – FRANCE 11 Beigua - ITALY 13 Bergstrasse-Odenwald - GERMANY 15 Bohemian Paradise – CZECH REPUBLIC 17 Burren and Cliffs of Moher- REPUBLIC OF IRELAND 19 Cabo de Gata – Nijar Natural Park - SPAIN 21 Chelmos Vouraikos – GREECE 23 Copper Coast – IRELAND 24 English Riviera – UK 26 Fforest Fawr – Wales, UK 28 Gea Norvegica – NORWAY 30 GeoMon – Wales, UK 31 Harz Braunschweiger Land Ostfalen – GERMANY 33 Hateg Country Dinosaurs – ROMANIA 35 Katla – ICELAND 37 Madonie Geopark – ITALY 39 Maestrazgo Cultural Park – SPAIN 41 Magma – NORWAY 43 Marble Arch Caves– NORTHERN IRELAND and REP OF IRELAND 45 Muskau Arch – GERMANY and POLAND 47 Naturtejo – PORTUGAL 49 North Pennines AONB – ENGLAND UK 51 Novohrad-Nógrád - HUNGARY and SLOVAKIA 53 Papuk – CROATIA 55 Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Campania – ITALY 57 Park Naturel Régional du Luberon – FRANCE 59 Petrified Forest of Lesvos – GREECE 61 Psiloritis Natural Park – GREECE 63 Rocca di Cerere – ITALY 64 Rokua – FINLAND 66 Shetland – SCOTLAND UK 68 Sierra Norte de Sevilla Natural Park - SPAIN 70 Sierras Subbeticas Natural Park – SPAIN 72 Sobrarbe – SPAIN 74 Steirische Eisenwurzen – AUSTRIA 76 Swabian Alb – GERMANY 78 Terra.Vita Naturpark – GERMANY 80 Vikos Aoos – GREECE 82 Villuercas-Ibores-Jara – SPAIN 84 Vulkaneifel European – GERMANY 86 1 No report from: North West Highlands – SCOTLAND UK; Réserve Géologique de Haute - Provence – FRANCE, Sardenia Geominerario Park – ITALY and Tuskan Mining Geopark - ITALY. 2 Adamello Brenta Nature Park – ITALY Adamello Brenta Nature Park, consistently with its wider and more complex conservation strategy of the natural, historical and cultural heritage, has continued its work to improve the geological heritage conservation and geotouristic and popularization activities. -

Ahsgramerican Historical Society of Germans from Russia
AHSGR American Historical Society of Germans From Russia Germanic Origins Project Legend: BV=a German village near the Black Sea . FN= German family name. FSL= First Settlers’ List. GL= a locality in the Germanies. GS= one of the German states. ML= Marriage List. RN= the name of a researcher who has verified one or more German origins. UC= unconfirmed. VV= a German Volga village. A word in bold indicates there is another entry regarding that word or phrase. Click on the bold word or phrase to go to that other entry. Red text calls attention to information for which verification is completed or well underway. Push the back button on your browser to return to the Germanic Origins Project home page. Bre-Bzz updated Mar 2015 BrechtFN: said by the Kromm version of the Jagodnaja Poljana FSL to be fromUC Redmar, Brunswick Duchy, sent here as an 1812 prisoner of war (p.137). BrechtFN: also see Bracht. BrechenmacherFN: said by the 1816 Glueckstal census (KS:677, 674, 233) to be fromUC Weyer, Elsass, but the GCRA could not find them in those church records. The 1816 census also said they came after a stay in Torschau, Hungary; another source said that the place was Weyer, Hungary. However, the GCRA found evidence they actually may have been in Klein-Ker, Hungary and probably were in Tscherwenka; see their book for detail. Also spelled Brachenmacher. BreckenheimGL, [Hesse-Darmstadt?]: is now a neighborhood some 6 miles E of Wiesbaden city centre, and was said by the Caesarsfeld FSL to be homeUC to a Wenzel family. -

Radwegsituation Stockstadt Am Main Gesprächsergebnis 21
Radwegsituation Stockstadt am Main Gesprächsergebnis 21. Oktober 2016 Limes-Radweg Andere überörtliche Verbindungen Innerörtliche Situation Gesprächsteilnehmer - Herr Bürgermeister Wolf, Markt Stockstadt - Allgemein - Frau Hammann, Markt Stockstadt - Fahrradabstellanlagen - Herr Dr. Schupp, Landratsamt - Wegweisung - Herr Fries, Landratsamt - Herr Hennecken, ADFC - Tempo 30 - Herr Tino Fleckenstein, ADFC ADFC Aschaffenburg-Miltenberg Folie 1 Netzkonzept Landkreis Aschaffenburg Rot ● Hauptwege Grün ● Verbindungen Violett ● Mainradweg ● 8200 Eingeblendet: ● Einwohnerzahlen in Tsd. 8700 7700 16300 ADFC Aschaffenburg-Miltenberg Folie 2 Überörtliche Radwegverbindungen - Nachbargemeinden Nach Großostheim ● Verlängerung Großostheimer Straße (gefährliche Querung) Verbindung Aschaffenburg – Stockstadt ● Entweder ● Radweg entlang Obernburger Str. Mit Schwenk zur Darmstädter Str. ● Durch das Industriegebiet zur Darmstädter Straße ● Über Waldfriedhof und Main zur Rampe an der Brücke Nach Babenhausen ● Weg über Schwimmbad – Kapelle – Waldroute oder über Pferdehöfe ADFC Aschaffenburg-Miltenberg Folie 3 Limesradweg auf Stockstädter Gebiet / Anbindung nach Mainaschaff ADFC Aschaffenburg-Miltenberg Folie 4 Limesradweg auf Stockstädter Gebiet / Mainbrücke Treppe Mainbegleitender Weg Rampe zur Mainbrücke Zudem Fehlanzeige: Weiterführung der Beschilderung Limesradweg, dafür ggf. Route ändern, d.h. am Friedhof vorbei. Limesradweg wird später neu aufgesetzt! Treppe Mainbegleitender Weg Rampe zur Mainbrücke Zudem Fehlanzeige: Weiterführung der Beschilderung -

Rheinmaincard
Regionaler Schienennetzplan Korbach RE30 RB38 RB39 RE98 Brilon Wald RB4 Kassel Kassel RB4 C U-Bahn Frankfurt (ausgewählte Stationen) RB42 Korbach Süd Vöhl-Thalitter B S-Bahn Rhein-Main Vöhl-Herzhausen Wabern-Zennern Wabern hält an allen Stationen RB39 ICE Vöhl-Schmittlotheim Bad Wildungen RB Regionalbahn Westerburg/Au Betzdorf Siegen Vöhl-Ederbringhausen hält außerhalb des S-Bahn-Netzes in der Regel RB90 RB96 RE99 RB95 Frankenberg- an allen Stationen derlaasphe Fra.-Goßberg ICE RheinMainCard Viermünden Frankenberg (Eder) ICE RB41 Bad LaaspheNie Wallau Biedenkopf- BiedenkopfWolfgruben RE RegionalExpress Burgwald-Birkenbringhausen adt- Erndtebrück Wissenscampus Wilhelmshütte hält in der Regel nur an den weiß Burgwald-Wiesenfeld RB38 RB94 Burgwald-Ernsthausen markierten Stationen Friedensdorf Münchhausen chhain nur in der Hauptverkehrszeit Für kleines Geld kreuz und quer durch die Region! zhausen RB euental- Simtshausen Borken- RB95 42 Wetter Bürgeln Anzefahr Kir StadtallendorfNeustadt Schwalmstadt-WieraSchwalmst Neuental- N Borken oder Einzelfahrten Wilsenroth Buchenau Caldern Ster GoßfeldenLahntal- Treysa Schlierbach Zimmersrode Singlis Sarnau RE99 RE30 RB38 RE98 Stationen im Übergangsverkehr Discover the region for next to nothing! Dillbrecht RB94 RE30 RB41 RE98 Frickhofen Allendorf (kein RMV-Gebiet) Cölbe Rodenbach ICE IC Fernverkehrsanschluss Niederzeuzheim ICE RB42 RB94 Marburg ingen furt Haiger- Haiger SechsheldenDillenburg d Obertor NiederscheldBurg Süd Nord Herborn Sinn E RB90 atzen Marburg Süd d g Kassel Göttingen Hadamar K chen -

Unterwegs Mit Der Odenwald-Bahn Freizeit- Und Erlebnistipps
Unterwegs mit der Odenwald-Bahn Freizeit- und Erlebnistipps Neuauflage 2012 Inhalt Vorwort 3 Streckenverlauf 5 Städte und Gemeinden Eberbach am Neckar 6 Hesseneck 7 Beerfelden 8 Erbach im Odenwald 10 Michelstadt 12 Bad König 15 Höchst i. Odw. 18 Groß-Umstadt 20 Babenhausen 24 Mainhausen 26 Seligenstadt 28 Hainburg 31 Hanau 32 Offenbach 35 Otzberg 38 Reinheim 41 Ober-Ramstadt 43 Mühltal 44 Darmstadt 46 Pfungstadt 50 Wandern und Radfahren Freizeitbusse 52 Radtouren 53 Rhein-Main-Vergnügen 54 Fahrradmitnahme 56 Literatur und Internetseiten zum Wandern und Radfahren 57 Ansprechpartner vor Ort 59 RMV-Fahrkartenangebot 60 Impressum 62 Regionaler Schienennetzplan 63 2 Vorwort „Unterwegs mit der Odenwald-Bahn“ Wiebelsbach – Hanau – Offenbach – Frank- haben wir unsere Neuauflage der Broschüre furt) und der RMV-Linie 65 (Eberbach – Erbach mit Freizeit- und Erlebnistipps entlang den – Groß-Umstadt Wiebelsbach – Darmstadt – Bahnstrecken der Odenwald-Bahn betitelt. Frankfurt) können Sie jetzt auch mit der RMV- Mit dem Freizeitführer können Sie die Region Linie 66 (Darmstadt – Pfungstadt) reisen. Seit von Eberbach bis Frankfurt auf der Schiene Dezember 2011 fahren auf der Bahnstrecke erkunden. Die Angaben wurden aktualisiert zwischen Darmstadt und Pfungstadt nach und überarbeitet, so dass Sie einen perfekten über mehr als einem halben Jahrhundert wie- Überblick über Ausflugsziele der Region in der der Personenzüge, und unsere Tipps für einen Hand halten. Besuch in Pfungstadt zeigen, wie lohnend ein Abstecher dorthin sein kann. Unsere Reisebroschüre bietet Ausflugszie- le vom Neckar bis an den Main, lockt mit Die Odenwald-Bahn bringt Sie zum Beispiel Stopps in idyllischen, ländlichen Gegenden, komfortabel zum Erbacher Schloss, zur Seli- lädt ein in pulsierende Städte und lebendige genstädter Benediktinerabtei, zur Fasanerie Ortschaften, zeigt Ihnen Landschaften mit in Hanau-Klein-Auheim, zum Ledermuseum sanften Hügeln und markanten Höhenzügen in Offenbach oder in die Weinstadt Groß- und weckt vielleicht Ihre Neugier auf histo- Umstadt. -

Reichelsheim
Reichelsheim im landschaftlich Reichelsheim ist eine der schönsten Wanderregionen Gewerbe- und Informationsausstellung, Modenschau, Kirchweihfeste schönsten Teil des Odenwaldes im Odenwald. Lichte Mischwälder und grüne Hügel Michelsmarktlauf, Festzug, Vergnügungspark, u.v.m. 1. Wochenende im Juli, Ortsteil Gumpen wechseln sich mit offener Landschaft und beeindru- Planquadrat F5 3. Wochenende im August, Ortsteil Beerfurth Reichelsheim ist Naherholungsgebiet und Ziel vieler ckenden Aussichten reizvoll ab. 1. Wochenende im September, Ortsteil Ober-Ostern Bewohner des Rhein-Main-Neckar Raumes und liegt Märchen- und Sagentage (www.maerchentage.de) 2. Wochenende im September, Ortsteil Rohrbach mitten im Geo-Naturpark Bergstraße/Odenwald mit Letztes Wochenende im Oktober mit mittelalterlichem 3. Wochenende im September, Ortsteile Ober-Kains- fast 9000 Einwohnern. Markt, Kindertheatern, Autoren, Lange Nacht der Mär- bach und Unter-Ostern Unsere lebendige Gemeinde mit seinen Ortsteilen chen, einem großen Mittelaltermarkt, Märchenfest- Letztes Wochenende im September, Kerngemeinde Beerfurth, Bockenrod, Eberbach, Erzbach, Frohnhofen, abend mit Verleihung des Wildweibchenpreises, ver- Reichelsheim Gersprenz, Gumpen, Klein-Gumpen, Laudenau, Ober- kaufsoffenem Sonntag und vielem mehr. Kainsbach, Ober-Ostern, Rohrbach und Unter-Ostern Weihnachtsmärkte bilden den Mittelpunkt des Gersprenztals. Reichelsheim, 1. Advent Planquadrat E5 Beerfurth, 2. Advent Planquadrat H4 Kulturelle Einrichtungen Informationsmaterial erhalten Sie in der Touristinfor- Regionalmuseum -

Low Flow and Drought in a German Low Mountain Range Basin
water Article Low Flow and Drought in a German Low Mountain Range Basin Paula Farina Grosser * and Britta Schmalz Chair of Engineering Hydrology and Water Management, Technical University of Darmstadt, 64287 Darmstadt, Germany; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +49-6151-16-20863 Abstract: Rising temperatures and changes in precipitation patterns in the last decades have led to an increased awareness on low flow and droughts even in temperate climate zones. The scientific community often considers low flow as a consequence of drought. However, when observing low flow, catchment processes play an important role alongside precipitation shortages. Therefore, it is crucial to not neglect the role of catchment characteristics. This paper seeks to investigate low flow and drought in an integrative catchment approach by observing the historical development of low flows and drought in a typical German low mountain range basin in the federal state of Hesse for the period 1980 to 2018. A trend analysis of drought and low flow indices was conducted and the results were analyzed with respect to the characteristics of the Gersprenz catchment and its subbasin, the Fischbach. It was shown that catchments comprising characteristics that are likely to evoke low flow are probably more likely to experience short-term, seasonal low flow events, while catchments incorporating characteristics that are more robust towards fluctuations of water availability will show long-term sensitivities towards meteorological trends. This study emphasizes the importance of small-scale effects when dealing with low flow events. Keywords: low flow; drought; catchment characteristics; low flow indices; drought indices; trend analysis; low mountain range catchment Citation: Grosser, P.F.; Schmalz, B. -

Rock Alteration at the Post-Variscan Nonconformity: Implications for Carboniferous–Permian Surface Weathering Versus Burial Diagenesis and Paleoclimate Evaluation
Solid Earth, 12, 1165–1184, 2021 https://doi.org/10.5194/se-12-1165-2021 © Author(s) 2021. This work is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 License. Rock alteration at the post-Variscan nonconformity: implications for Carboniferous–Permian surface weathering versus burial diagenesis and paleoclimate evaluation Fei Liang1, Jun Niu1,2, Adrian Linsel1, Matthias Hinderer1, Dirk Scheuvens1, and Rainer Petschick3 1Material and Geosciences, Institute of Applied Geosciences, Technical University of Darmstadt, Darmstadt 64287, Germany 2Faculty of Petroleum, China University of Petroleum-Beijing, Karamay Campus, Karamay 834000, China 3Faculty of Geosciences and Geography, Goethe University Frankfurt, Frankfurt 60438, Germany Correspondence: Jun Niu ([email protected]) Received: 29 December 2020 – Discussion started: 25 January 2021 Revised: 17 March 2021 – Accepted: 19 April 2021 – Published: 25 May 2021 Abstract. A nonconformity refers to a hiatal surface located overall order of element depletion in both basaltic andesite between metamorphic or igneous rocks and overlying sedi- and gabbroic diorite during the weathering process is as fol- mentary or volcanic rocks. These surfaces are key features lows: large-ion lithophile elements (LILEs) > rare earth ele- with respect to understanding the relations among climate, ments (REEs) > high-field-strength elements (HFSEs). Con- lithosphere and tectonic movements during ancient times. In cerning the REEs, heavy rare earth elements (HREEs) are this study, the petrological, mineralogical and geochemical less depleted than light rare earth elements (LREEs). Our characteristics of Variscan basement rock as well as its over- study shows that features of supergene physical and chemi- lying Permian volcano-sedimentary succession from a drill cal paleo-weathering are well conserved at the post-Variscan core in the Sprendlinger Horst, Germany, are analyzed by nonconformity despite hypogene alteration. -

Strolling Through Istanbul in 1918. the War Memoirs of the German Private Georg Steinbach
Memoria. Fontes minores ad Historiam Imperii Ottomanici pertinentes Volume 3 Ruben Gallé (Ed.) Strolling Through Istanbul in 1918. The War Memoirs of the German Private Georg Steinbach Memoria. Fontes minores ad Historiam Imperii Ottomanici pertinentes Edited by Richard Wittmann Memoria. Fontes Minores ad Historiam Imperii Ottomanici Pertinentes Volume 3 Ruben Gallé (Ed.) Strolling Through Istanbul in 1918. The War Memoirs of the German Private Georg Steinbach © Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, Bonn 2017 Redaktion: Orient-Institut Istanbul Reihenherausgeber: Richard Wittmann Typeset & Layout: Ioni Laibarös, Berlin Memoria (Print): ISSN 2364-5989 Memoria (Internet): ISSN 2364-5997 Photos on the title page and in the volume are copyrighted and, unless specifed otherwise in the captions, provided through the courtesy of Ruben Gallé. We are particularly grateful to Erald Pauw, Istanbul, for enhancing this publication through his contribution of additional visual materials from his private collection. Title page: Georg Steinbach on a postcard sent from Istanbul to his parents for Christmas 1918. Editor’s Preface We passed by the Princes’ Islands and arrived in Istanbul in the late afternoon. It was an emotio- nal moment when we went ashore, and I stood almost exactly where I had stood earlier as a young soldier. That was 45 years ago! This quote comes from a letter that Georg Steinbach wrote on May 11, 1963 to his friend and former employer Karl (Levi) Lennart. In it, he tells of a Mediterranean cruise he took with his wife on the occasion of his 50th anniversary at the Moses Levi clothing retailer, which brought him to Istanbul for the second and last time. -

Westlicher Odenwald Und Nachbargebiete 2007
HESSEN-FORST Artgutachten 2007 Bericht über die Fischökologische Untersuchung Westlicher Odenwald und Nachbargebiete 2007 FENA Servicestelle für Forsteinrichtung und Naturschutz Bericht über die Fischökologische Un- tersuchung Westlicher Odenwald und Nachbargebiete 2007 (Werkvertrag v. 4.7.2007) Überarbeitete Fassung März 2010 Aufgestellt im Oktober 2007 Im Auftrag des Rainer Hennings Landes Hessen, vertreten FISHCALC© Büro für Fischereiberatung durch Hessen-Forst FENA Nibelungenstraße 23 - 25 Europastraße 10-12 64653 Lorsch 53394 Gießen Tel.: 06251/588 909 Tel.: 0641/4991-0 Unter Mitarbeit von Herbert Redlich, Anna Hennings und Herbert Theißing D:\A_Daten\FISHCALC©\Proj_Resteliste\A_Bericht WOW 2007\Überarbeitung WOW 2010\hennings_westlicherodenwald_2007_gutachten_ueberarb Fassung Stand 03_2010_1.doc Dieser Bericht enthält 172 Seiten und Anlagen Fischökologische Untersuchung Westlicher Odenwald u. Nachbargebiete 2007 Seite 2 von 172 Inhaltsverzeichnis 1 Zusammenfassung 12 2 Aufgabenstellung 15 3 Material und Methoden 18 3.1 Dokumentation der Eingabe in die natis-Datenbank 18 3.2 Erfassungsmethoden 18 3.2.1 Elektrofischerei 18 3.2.2 Vertiefte Untersuchungen 20 4 Untersuchungsgebiet, Gebietebeschreibung 22 4.1 Umgrenzung des Untersuchungsgebiets, Naturräume 22 4.2 Tangierte Einzugsgebiete 22 4.3 Gewässerzonierung 23 4.4 Weschnitz (GKZ 2394, entwässerte Fläche 414 km²) 25 4.5 Winkelbach/Lauter (GKZ 2395, entwässerte Fläche 117 km²) 27 4.6 Modau (GKZ 2396, entwässerte Fläche 204 km²) 28 4.7 Schwarzbach (Ried, GKZ 2398, entwässerte Fläche 512 km²) 29 4.8 Gersprenz (GKZ 2476, entwässerte Fläche 503 km²) 30 4.9 Mümling (GKZ 2474, entwässerte Fläche 377 km²) 32 5 Ergebnisse 35 5.1 Überblick 35 5.2 Weschnitzgebiet 36 5.3 Winkelbachgebiet 41 5.4 Modaugebiet 44 5.5 Schwarzbach 45 5.6 Gersprenz 48 FISHCALC Büro für Fischerei- und Gewässerberatung R.