Den Kompletten Artikel Als PDF Lesen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Genau – Wissen Für Zu Hause
#03 Das MÄRZ 2021 Magazin Menschen im Kampfmodus Radiofeatures als Zeitdokumente Auftakt zum Superwahljahr Demokratie auf Distanz in Zeiten von Corona Genau – Wissen für zu Hause Das neue Onlineportal „Mein privater Konzertsaal.“ Sophie Pacini, Pianistin Unabhängig. Unverzichtbar. Unverwechselbar. Editorial Veranstaltungen #03 Liebe Leserinnen und Leser, der Rundfunk beitrag ist zum 1. Januar nicht um die von der KEF empfohlenen 86 Cent gestiegen, weil nur 15 von 16 Bundesländern der Erhöhung zuge stimmt haben. Das abschließende Urteil des Bundesverfassungsgerichts hierzu steht noch An dieser Stelle finden aus. Unser Ziel ist es, das Programm zu schüt Sie gewöhnlich unsere Veranstaltungsübersicht. zen. Es geht um Vertrauen und Verlässlichkeit. Aufgrund der Verbreitung des CoronaVirus führt Deutschlandradio zurzeit keine öffentlichen Ver anstaltungen durch. Dies erfolgt zum Schutz des Publikums sowie unserer Der Beitrags service von Mitarbeiterinnen und Mit ARD, ZDF und arbeiter. Deutschland radio in Köln Bocklemünd Ausgewählte Veranstal tun gen und Konzerte werden bei Deutschlandradio ohne Publikum aufgezeichnet. Diese können Sie in unseren drei Programmen, in der Dlf Audiothek App und online auf unseren Web seiten Wie wird sich das transatlantische Verhältnis unter Präsident Biden entwickeln? nachhören. Bitte beachten Welche Spuren hinterlässt Corona bei den Menschen, in Wirtschaft und Kultur? Sie, dass sich dennoch Wie werden in diesem Jahr mit sechs Landtagswahlen und einer Bundestagswahl Sendetermine verschieben die Wahlkämpfe aussehen? Wie kann es uns als Gesellschaft gelingen, wieder mehr und Programm änderungen miteinander zu sprechen und nicht nur als Interessengruppen übereinander? ergeben können. Weitere Das sind nur einige der Fragen, die uns in diesem Jahr beschäftigen. Und wie immer Informa tionen hierzu auf werden wir unser Bestes geben, um Sie gut zu informieren. -

Musik Für Eine Humanistischere Ggesellschaft
Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig Institut für Musikpädagogik Masterarbeit Gutachter: Prof. Christoph Sramek, Prof. Tobias Rokahr MMUSIK FÜR EINE HUMANISTISCHERE GGESELLSCHAFT LEBEN UND WERK DES KOMPONISTEN GÜNTER KOCHAN Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Master of Arts vorgelegt von Christian Quinque Danksagung Diese Arbeit hätte nicht entstehen können ohne die Hilfe zahlreicher Menschen, denen ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aussprechen möchte. Dieser gilt zuerst meinem Mentor Prof. Christoph Sramek für seine Bereitschaft, diese Arbeit zu betreuen, für seine Offenheit im Gespräch und die vertrauensvolle, sachkundige und stets unverzügliche Beratung. Ebenfalls danke ich Herrn Prof. Tobias Rokahr für die Übernahme des Zweitgutachtens und für seine Beratung zu Analyseverfahren neuer Musik. Zu großem Dank verpflichtet bin ich Frau Inge Kochan, Frau Hannelore Gerlach und Herrn Peter Aderhold aus Berlin. In unseren Gesprä- chen am 19. und 20. November 2012 und weiteren Telefonaten und Briefwechseln haben sie mir großes Vertrauen und Interesse entgegengebracht, sich auch kritischen Fragen gestellt und meine Arbeit bedingungslos nach Kräften unterstützt. Ohne ihre Ermöglichung der Ein- sichtnahme in ansonsten unzugängliche Materialien, in Manuskripte, Fotos, Partituren, Kon- zertmitschnitte und den kompositorischen Nachlass Günter Kochans und die Erteilung urhe- berrechtlicher Genehmigungen hätten diese Arbeit und insbesondere das Werkeverzeichnis nicht in der vorliegenden Form zustande kommen können. Ich danke auch den Mitarbeiterin- nen des Deutschen Musikarchivs in Leipzig für die freundliche und geduldige Unterstützung und Beratung bei der Recherche nach Ton- und Schriftdokumenten. Dem Studierendenrat der Hochschule für Musik und Theater Leipzig gilt mein herzlicher Dank für die finanzielle Förde- rung dieser Arbeit durch vollständige Übernahme der im Zusammenhang mit den Recherchen entstandenen Unkosten. -

Positionen – Texte Zur Aktuellen Musik
Positionen Inhaltsverzeichnis Hefte 1-93 (1988-2012) Ablinger, Peter, Für und wider das Kunstwerk: Annäherung, 23/1995, 36-39 –, Konventionalität der Musik, 34/1998, 5 –, Differenz und Differenzierung, 41/1999, 6-7 –, Motette, 44/2000, 16-17 –, Opern, Mischformen, Niemandsland ..., Standpunkte von Komponistinnen und Komponis- ten, 55/2003, 30-31 –/Markus Fein, Überschneidungen. Ein Gespräch, 59/2004, 18-21 –, Ausdruck/Sonate, 73/2007, 7-12 –, Keine Überschreitung, 78/2009, 11 –, Überflüssig. Zum Begriff des Experimentellen, 90/2012, 21-23 Abromeit, Peter, Bericht: Grosses Lernen in Bremen, 80/2009, 59 Adkins, Helen, »Dead chickens« Schrottmutationen und Klangapokalypse, 14/1993, 7-8 Albrecht, Norbert, Ruth Zechlin: Kristallisation für Orchester, 3/1989, 20-21 de Alvear, Maria, Zur Verfügbarkeit und Geschichtlichkeit des Materials, 49/2001, 31 –/ Mörchen, Raoul, »Es geht um eine Verrückung...« , 67/2006, 26-27 –, Über Aufmerksamkeit im Alltag, 76/2008, 31-32 Amme, Kristin, Bericht: MachtMusik, 69/2006, 54-56 –, Bericht: Leipzig: stéle 2008, 78/2009, 57 –, Bericht: FreiZeitArbeit in Leipzig: Bahnhofskonzert, 80/2009, 66 –, Bericht: Reisen bildet: Flughafenkonzert, 84/2010, 62 Amzoll, Stefan, Georg Katzers »Multi-Media«-Projekte, 14/1993, 26-28 –, Radio-Oper Die Gebeine des Dantons von Schenker/Mickel, 5/1990, 19-20 –, Zeugnisse: Offener Brief an die Akademie der Künste Berlin-Brandenburg, 22/1995, 54-55 –, Störfall. Gespräch mit Friedrich Schenker, 35/1998, 36-38 –, Von Anfang an dialektisch gedacht, der Hallenser Komponist Thomas Müller, 41/1999, 44-48 –, Goldberg-Passion. Ein Gespräch mit Friedrich Schenker, 42/2000, 50-51 –, Bericht: IX. Randspiele in Zepernick, 48/2001, 64-66 –, Bericht: XI. Randspiele in Zepernick, 56/2003, 55-56 –, Bericht; Pyramidale in Berlin-Hellerdorf, 58/2004, 62-63 –, Bericht: Randspiele Zepernick, 69/2006, 56-57 –, Der Dorn im Fleisch. -
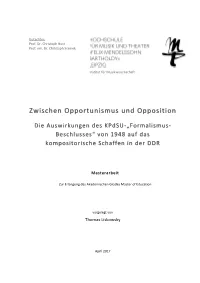
MA Final2acli
!"#$%&#'()* +(,-.*/(.*0&(12#,3&*4"2#* +(,-.*'5.*/(.*0&(12#,3&*6($5'7* * * * *892#1#"#*-:(*;"217<122'92%&$-#* * * * =<12%&'9*>33,(#"9125"2*"9?*>33,21#1,9* * /1'*@"2<1(7"9A'9*?'2*B+?6CDEF,(5$G125"2D H'2%&G"22'2I*J,9*KLMN*$"-*?$2* 7,53,21#,(12%&'*6%&$--'9*19*?'(*//O* * * ;$2#'($(P'1#* ="(*Q(G$9A"9A*?'2*@7$?'512%&'9*!($?'2*;$2#'(*,-*Q?"%$#1,9* * * * * J,(A'G'A#*J,9* R&,5$2*S127,<27T* * * * * * @3(1G*UVKW* /$972$A"9A* F:(*?1'*>--'9&'1#*15*!'23(X%&*"9?*?1'*J'(#($"'92J,GG'*"9?*2$%&7"9?1A'*H'($#"9A*5Y%&#'* 1%&*51%&*P'1*/(.*0&(12#,3&*4"2#*"9?*J,(*$GG'5*P'1*/(.*0&(12#,3&*6($5'7*P'?$97'9.*/$(:P'(* &19$"2*<X('*?1'2'*@(P'1#*91%&#*,&9'*?1'*-$%&G1%&'*B,53'#'9Z*"9?*="$(P'1#*Z$&G('1%&'(*+'(2,D 9'9*19*?'9*H'&Y(?'9*?'(*6#$?#*S'13Z1A*5YAG1%&*A'<'2'9.*[,(*$GG'5*2'1*F($"*H(1A1##'*!'T'(* A'?$97#\*S'1#'(19*?'(*6,9?'(2$55G"9A'9*?'(*;"217$P#'1G"9A*19*?'(*6#$?#P1PG1,#&'7*S'13Z1A\* ,&9'*?1'*'19'*Q1921%&#*19*?'9*]$%&G$22*J,9*4'((9*R('1P5$99*91%&#*5YAG1%&*A'<'2'9*<X('.* /$(:P'(*&19$"2*A1G#*5'19*/$97*F($"*/(.*R&'7G$*BG"##1A*J,5*6X%&212%&'2*6#$$#2$(%&1J*S'13Z1A\* F($"*H'$#'*O'P9'(*J,5*S'13Z1A'(*C91J'(21#X#2$(%&1J\*F($"*8(12*R:(7'*J,5*!'<$9?&$"2$(%&1J\* F($"* B$#&$(19$* H''(* J,9* ?'(* ;"217$P#'1G"9A* ?'(* /'"#2%&'9* ]$#1,9$GP1PG1,#&'7\* F($"* /(.* @GG5"#&*H'&('9?#*J,5*@(%&1J*?'2*;/OD619-,91',(%&'2#'(2*2,<1'*F($"*CG(17'*^1G7'92*J,9*?'(* 6#$21DC9#'(G$A'9P'&Y(?'*S'13Z1A.*F:(*_'AG1%&'*C9#'(2#:#Z"9A*$5*Q9?'*?'(*@(P'1#*A1G#*2%&G1'`D G1%&*5'19*&'(ZG1%&'(*/$97*B$#_$*B($#Z'92#'19\*+$"G$*a$92'9\*6#'--1*B"(#&\*[$G'9#19*!:9#&'(*"9?* A$9Z*P'2,9?'(2*5'19'9*H(:?'(9*;$(#19*"9?*@GP('%&#*2,<1'*5'19'5*[$#'(*[,G7'(*S127,<27T.** D*88*D* * !"#$%&'()*+),-#",'. -

Institutionen, Festivals, Veranstalter, Verlage, Label, Kulturmanagment
Folgende Institutionen, Vereine, Festivals, Ensembles, Kulturmanagementbüros, Komponisten, Musiker, Klangkünstler, Musikwissenschaftler ... = Hörer unterstützen mit ihrer Unterschrift den „Offenen Briefe“ der Initiative „Neue Musik in den RBB“: Institutionen, Festivals, Veranstalter, Verlage, Label, Kulturmanagment Konzerthaus Berlin Intendant Prof. Dr. Frank Schneider Christine Schroeter, Leiterin der Geschäftsstelle „Zukunft Konzerthaus e.V.“ Katharina Hennecke Dr. Dietmar Hiller, Dramaturg Sektion Musik der Akademie der Künste Prof. Udo Zimmermann, Sektionsdirektor Staatstheater Cottbus Dr. Carola Böhnisch, 1. Musikdramaturgin am Staatstheater Cottbus Bernhard Lenort, Dramaturg Brandenburger Theater Christian Kneisel, Intendant/Geschäftsführer singuhr – hörgalerie in Parochial Carsten Seiffarth, Künstlerischer Leiter C.F. Peters Musikverlag Carl Grouwet, Geschäftsführer MaerzMusik Mathias Osterwold, künstlerischer Leiter Randspiele Zepernick Karin Zapf, Kantorin der ev. Sankt-Annen-Gemeinde Zepernick + Organisatorin 1 Intersonanzen. Brandenburgisches Fest der neuen Musik Dr. Michael Schenk, Projektleiter Ich begrüße außerordentlich Ihre Initiative, die natürlich auch ganz konkret die Arbeit unseres Vereins und im speziellen von "intersonanzen" betriff t... der rbb nimmt uns ja seit Jahren nicht wahr, obwohl wir auch mehrfach um Kooperation bzw. zumindest um Reflexion gebeten hatten. Künstlerhaus Bethanien GmbH Christoph Tannert, Direktor Sophiensäle Berlin Amelie Deuflhard, Künstlerische Leiterin Ballhaus Naunynstraße, Berlin-Kreuzberg -

2018 Juli Programm
Programm 2018 Juli Das Rudolstadt-Festival Folk und Weltmusik in unseren Programmen Seite 6 Herr Raue 2 Editorial Inhalt 2 Editorial 3 Aktuell Deutschlandradio Große Reden Ein gemeinsames Projekt von ARTE und seine Auslandskorrespondenten und Deutschlandfunk 4 Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, Klänge aus Thessaloniki „Schmeiß’ das Ding auf den Boden, ich schieße darauf!“ Cameron Carpenter Deutschlandradio/ © Bettina Fürst-Fastré Der Uniformierte bedroht Florian Kellermann mit einem und seine Mega-Orgel Maschinengewehr. Im Hintergrund steht ein russischer Soldat. Gemeint ist der 6 Spezial Laptop unseres Korrespondenten. Florian Kellermann ist einer der wenigen Das Rudolstadt-Festival deutschen Journalisten auf der Krim, als die Russen die Halbinsel annektieren. 8 Literatur Erfahrung und Wissen, journalistisches Handwerk und Stehvermögen zeich- Tage der deutschsprachigen Literatur nen unsere Auslandskorrespondenten aus. Sie wissen, wovon sie reden. Sie Lyriker über Stefan George wägen ab, bevor sie berichten, und sie stehen oftmals im Feuer, auch in den 10 Feature sozialen Netzwerken. Monatsübersicht/Tipps Unübersichtlichkeit und Unsicherheit wachsen, und je komplexer sich euro- 14 Gastbeitrag päische und internationale Zusammenhänge entwickeln, desto größer ist die Dr. Thomas Bellut Herausforderung für Berichterstatter. Die Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten der Deutschlandfunk-Programme bekommen Platz und Sende- 15 Programmkalender Juli 18 zeit für ihre Analysen, Einschätzungen und Kommentare. Sie müssen nicht darum kämpfen, Inhalte unterzubringen. Ihre Berichterstattung ist fester Bestandteil 78 DAB+ unserer Sendungen. Die bundesweite DAB+ Versorgung Deutschlandradio finanziert eigene Korrespondenten in Washington, Moskau, im Kanal 5C Paris, Brüssel, Prag, London und Warschau – Thilo Kößler, Thielko Grieß, Jürgen 79 Lange Nacht König, Bettina Klein und Peter Kapern, Peter Lange, Friedbert Meurer und Florian Im Auge der Sonne Kellermann. -

Programmvorschau 16. Bis 22. Januar 2017
Programmvorschau 16. bis 22. Januar 2017 Mitschnitt Die mit M gekenn zeichneten Sendungen sind für private Zwecke ausschließlich gegen Rechnung, unter Angabe von Name und Adresse für 10,– EUR erhältlich bei: Deutschlandradio Service GmbH, Hörerservice Raderberggürtel 40, 50968 Köln Weitere Informationen erhalten Sie unter Telefon 0221.345 - 1847 deutschlandradio.de Hörerservice Telefon 0221.345 - 1831 Telefax 0221.345 - 1839 [email protected] 3. Mo 16. Januar 2017 1 0.00 Nachrichten 9.05 Kalenderblatt 18.10 Informationen am Abend 0.05 Deutschlandfunk Radionacht Vor 25 Jahren: 18.40 Hintergrund 0.05 Fazit In El Salvador wird der Friedens - 19.00 Nachrichten Kultur vom Tage vertrag zwischen der Regierung 19.05 Kommentar (Wdh.) und der Guerillaorganisation 19.15 Andruck – Das Magazin 1.00 Nachrichten FMLN unterzeichnet für Politische Literatur 1.05 Kalenderblatt 9.10 Europa heute 20.00 Nachrichten 1.10 Interview der Woche 9.30 Nachrichten 20.10 Musikjournal (Wdh.) 9.35 Tag für Tag Das Klassik-Magazin 1.35 Hintergrund Aus Religion und Gesellschaft 21.00 Nachrichten (Wdh.) 10.00 Nachrichten 21.05 Musik-Panorama 2.00 Nachrichten 10.10 Kontrovers * Sommerliche Musiktage 2.05 Sternzeit M Politisches Streitgespräch mit Hitzacker 2016 2.07 Kulturfragen Studiogästen und Hörern György Kurtág Debatten und Dokumente Hörertel.: 00800.4464 4464 Officium breve in memoriam (Wdh.) [email protected] Andreae Szervánsky, op. 28 anschließend ca. 10.30 Nachrichten für Streichquartett 2.30 Zwischentöne 11.00 Nachrichten Thomas Adès -

141/142 Juli/August 2002 Rosa-Luxemburg-Stiftung
Monatliche Publikation, . herausgegeben von der 141/142 Juli/August 2002 Rosa-Luxemburg-Stiftung VorSatz 581 Essay ROLAND CLAUS Die Linke und die Macht 583 Gesellschaft – Analyse & Alternativen WOLF-DIETER NARR Weltmarkt und Menschenrechte 593 SHARIT K. BHOWMIK Arbeitergenossenschaften und Marginalität 604 Sozialstaat im Zwielicht ACHIM TRUBE Paradigmenwechsel im Sozialstaat? 615 FRIEDHELM WOLSKI-PRENGER Arbeitslosenprojekte in der Bürgergesellschaft 629 TIEß PETERSEN Von der Arbeits- zur Tätigkeitsgesellschaft 641 Interview GEORG KATZER »Man muß die Ränder wachsen lassen« Im Gespräch mit Stefan Amzoll 647 Tradition & Programmatik ERNST WURL Macht und Last der Tradition. Das Exempel PDS 666 HELMUT BOCK Erbe und Tradition. Zum geschichtlichen Denken in der PDS 675 STEFAN BOLLINGER PDS-Programmatik und das Schlüsseljahr 1989 682 Blick nach Polen KAROL KOSTRZE˛ BSKI Rechtsextreme in Polen 689 ANDRZEJ KALUZA Zuwanderer aus Polen in Deutschland 699 LIDIA OWCZAREK Die Situation der nationalen Minderheiten in Polen während der Systemtransformation 710 Dokumentierte Geschichte ANNELIES LASCHITZA Ein neuer Brief von Rosa Luxemburg 720 Standorte CHRISTIAN FUCHS Die Bedeutung der Fortschrittsbegriffe von Marcuse und Bloch im informations- gesellschaftlichen Kapitalismus 724 GOTTFRIED STIEHLER Fortschritt und Reaktion im Staatssozialismus 737 Bericht JAN HOFF Klassen – Revolution – Demokratie 743 Festplatte WOLFGANG SABATH Die Wochen im Rückstau 746 Bücher & Zeitschriften Manuel Castells: Die Netzwerkgesellschaft. Das Informationszeitalter: Wirtschaft, -

Vor 20 Jahren: Das Ende Der „Einrichtung Standbild Geschalteten MAZ, Schwarzbild, Nach Artikel 36 Des Einigungsvertrags“ Aus
Rückblick programm zum Silvesterabend, dessen Pro- grammansagen („... mich wollten sie schon nicht mehr reinlassen, es geht nur noch mit Sondergenehmigung“) nochmals eine tech- nische Brücke zu den Olympischen Spielen von 1972 schlugen: Aufgenommen wurden sie mit einer jener Bosch-Studiokameras KCU 40, die nach ihrem Einsatz in Mün- chen als kostengünstige Gebrauchtgeräte in die DDR gelangt waren und das Adlershofer Fernsehen in die Lage versetzten, seine Schwarzweißtechnik einzumotten und zur durchgängigen Farbproduktion überzuge- hen. Letzter Akt unter DFF-Flagge war schließlich eine allerletzte Ausgabe der tra- ditionellen, wie stets vorab im einstigen Chemnitzer Kulturpalast aufgezeichneten Silvestersendung, die mit der bekannten, aus Tänzerinnen des „Fernsehballetts“ ge- bildeten Uhr endete, auf der die letzte Minu- te heruntertickte. Stillstand, Zeilensprung- flimmern der noch von einem Techniker auf Vor 20 Jahren: Das Ende der „Einrichtung Standbild geschalteten MAZ, Schwarzbild, nach Artikel 36 des Einigungsvertrags“ Aus. Hüpfendes Bild der harten Umschal- tung der Sendeleitung. Aufblende des Ost- In diesen Tagen jährt sich zum 20. Mal schen Rundfunk (NDR), der die bestehenden deutschen Rundfunks Brandenburg (ORB) der Abschluss eines Vorgangs, der in Euro- Regionalstudios übernahm und ansonsten mit seinem Intendanten Hansjürgen Rosen- pa seinesgleichen sucht: Die vollständige seine Hamburger Programme durchschalte- bauer, der sich mit einem Gang in die Sen- Auflösung von Rundfunk und Fernsehen der te, die bis heute keine rechte -
UNIVERSITY of CALIFORNIA Los Angeles East
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles East German Journalists and the Wende: A history of the collapse and transformation of socialist journalism in Germany A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in History by Morgan Morille Schupbach Guzman 2015 ABSTRACT OF THE DISSERTATION East German Journalists and the Wende: A history of the collapse and transformation of socialist journalism in Germany by Morgan Morille Schupbach Guzman Doctor of Philosophy in History University of California, Los Angeles, 2015 Professor David Sabean, Chair This dissertation utilizes archival sources and interviews to examine the transformation of the journalism profession in East Germany from the collapse of the German Democratic Republic (GDR) through the unification of the two German states. During this period of dramatic political and social upheaval, East German journalists navigated the divide between socialist journalism of the GDR and democratic journalism of the Federal Republic. By embedding the history of this professional transformation within a broader narrative of the history of the collapse of communism in Germany and Eastern Europe, this dissertation identifies how the actions of journalists were largely determined by outside forces. Socialist journalism in East Germany was envisioned as a means to use the media to control the public, but in practice the ii model primarily succeeding in controlling the journalists. As a result, the profession was at the mercy of larger social and geo-political tensions and was hampered by persistent and lingering structures of control that delayed the ability of journalists to undertake any substantive efforts of reform. However, once those structures eroded, there was a brief window where journalists were freed to reform the profession, and many envisioned a future for a democratic socialist journalism that embraced journalistic freedoms but held true to socialist principles of equality and social justice. -

Komponisten Der Gegenwart (KDG)
Komponisten der Gegenwart (KDG) Grundwerk einschließlich der 50. Nachlieferung Bearbeitet von Hanns-Werner Heister, Walter-Wolfgang Sparrer 1. Auflage 2013. Loseblatt. ca. 10240 S. ISBN 978 3 86916 282 9 Weitere Fachgebiete > Musik, Darstellende Künste, Film > Musikwissenschaft Allgemein > Einzelne Komponisten und Musiker schnell und portofrei erhältlich bei Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte. Inhalt Peter Ablinger von Gerald Resch Joseph Achron von Jascha Nemtsov John Adams von Rainer Fanselau Thomas Adès von Tim Steinke Theodor W. Adorno von Thomas Phleps Coriún Aharonián von Monika Fürst-Heidtmann Kalevi Aho von Anne Weller Necil Kâzım Akses von Martin Greve Alexander Albrecht von Zuzana Martináková Liana Alexandra von Corneliu Dan Georgescu Frangis Ali-Sade von Ulrike Patow Juan Allende-Blin von Klaus Linder Hasan Ferid Alnar von Martin Greve Maria de Alvear von Raoul Mörchen Michael Amann von Christian Heindl Claudio Ambrosini von Joachim Noller Gilbert Amy von Pierre Michel Mark Andre von Ralph Paland Louis Andriessen von Hella Melkert George Antheil von Mauro Piccinini Georges Aperghis von Antoine Gindt Hans Erich Apostel von Dirk Wieschollek Jörn Arnecke von Christoph Becher Vjacˇeslav Artëmov -

Download Heft 1-2/2018
Rundfunk und Geschichte Autorinnen und Autoren dieses Heftes Nr. 1-2/2018 ● 44. Jahrgang Dennis Basaldella, M.A., geb. 1982. Medienwissenschaftler und Filmkritiker. Masterarbeit „Geschichte(n) der DDR. Betrachtung des Internet-Archivs ‚Wir waren so frei … Momentaufnahmen 1989/1990‘ mit Jean- Luc Godard“. Dissertation im Fach „Medienwissenschaft“ an der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg zum Werk des privaten freien Filmherstellers Horst Klein aus der DDR. Seit 2014 Mitarbeit (Teilzeit) im Filmmuseum Potsdam, dort in der Abteilung Filmtechnik/Kinotechnik sowie Filmar- chiv und beim Sichtungsprojekt „Regionale Bilder auf Filmen (1950 – 1990)“ zum Amateurfilm in der DDR. E-Mail: [email protected] Roxane Gray, born 1993, graduated from the University of Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines in France (UVSQ) with a Master‘s degree in Cultural and Social History. She started her research on televi- sion as part of a master‘s thesis on the history of the channel France 5. Since December 2016, she has participated in the collective project „Beyond Public Service: Towards an Expanded History of Television Sound aus dem Archiv in Switzerland, 1960 to 2000“, funded by the Swiss National Science Foundation (FNS). She is currently writing her doctoral thesis on the history of television directors in French-speaking Switzerland in co- Ein Expertengespräch über den Stellenwert historischer Tondokumente supervision between the University of Lausanne and the UVSQ. E-Mail: [email protected] Karin Pfundstein Stefanie Palm, geb. 1987, studierte Geschichte, Medien- und Kommunikationswissenschaften und Zeit- Robespierre hört Radio und Fetzer flüchtet in den Westen geschichte in Halle-Wittenberg, Potsdam und Madrid. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Medi- en- und Wissenschaftspolitik sowie in der Wirtschafts- und Technikgeschichte der DDR.