SWR2 Oper Gottfried Huppertz: „Metropolis“
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Close-Up on the Robot of Metropolis, Fritz Lang, 1926
Close-up on the robot of Metropolis, Fritz Lang, 1926 The robot of Metropolis The Cinémathèque's robot - Description This sculpture, exhibited in the museum of the Cinémathèque française, is a copy of the famous robot from Fritz Lang's film Metropolis, which has since disappeared. It was commissioned from Walter Schulze-Mittendorff, the sculptor of the original robot, in 1970. Presented in walking position on a wooden pedestal, the robot measures 181 x 58 x 50 cm. The artist used a mannequin as the basic support 1, sculpting the shape by sawing and reworking certain parts with wood putty. He next covered it with 'plates of a relatively flexible material (certainly cardboard) attached by nails or glue. Then, small wooden cubes, balls and strips were applied, as well as metal elements: a plate cut out for the ribcage and small springs.’2 To finish, he covered the whole with silver paint. - The automaton: costume or sculpture? The robot in the film was not an automaton but actress Brigitte Helm, wearing a costume made up of rigid pieces that she put on like parts of a suit of armour. For the reproduction, Walter Schulze-Mittendorff preferred making a rigid sculpture that would be more resistant to the risks of damage. He worked solely from memory and with photos from the film as he had made no sketches or drawings of the robot during its creation in 1926. 3 Not having to take into account the morphology or space necessary for the actress's movements, the sculptor gave the new robot a more slender figure: the head, pelvis, hips and arms are thinner than those of the original. -

Kino in Coburg
- 1 - Inhaltsverzeichnis Vorwort ................................... 3 Kinematografische Treffpunkte in Coburg ... 4 Premieren im Union-Theater ............... 10 Margarethe Birnbaum ...................... 12 Luther - Der Film (2002) ................. 14 Weitere in Coburg gedrehte Filme ......... 16 Karrierestart Coburg ..................... 18 Der Flieger (1986) ...................... 21 Rubinrot / Saphirblau .................... 22 Interview Michael Böhm ................... 25 Gästebuch Goldene Traube ................. 27 Das kleine Hofkonzert .................... 29 Jürgen A. Brückner ....................... 30 Michael Ballhaus ......................... 32 Michael Verhoeven ........................ 33 Premiere „Der blaue Strohhut“ ............ 34 Annette Hopfenmüller ...................... 36 Filmkontor Graf .......................... 37 Himmel ohne Sterne ....................... 38 Der letzte Vorhang ....................... 40 Der Abriss / Der Neubau .................. 42 Drehort Coburg · Filmkulisse Coburg ...... 44 Beruf im Wandel: Filmvorführer ........... 46 Danksagung / Impressum ................... 47 Liebe Leserinnen, liebe Leser, mit meinem Jahrgang 1968 gehöre So sahen wir den ganzen „Krieg der ich zu der Generation, die mit Sterne“-Film, von dem ein Teil mei- einem Schwarz-Weiß-Fernseher mit ner Freunde begeistert erzählt hatte. vier Programmen und ohne Fern- Mich hat dieser Film nicht beson- bedienung aufgewachsen ist. Der ders beeindruckt und ich konnte die Besuch eines Kinos war dagegen Begeisterung meiner Freunde nicht -

Sächsisches Archivblatt Heft 1/2015
SÄCHSISCHES STAATSARCHIV Sächsisches Archivblatt Heft 1 / 2015 Inhalt Seite Jahresbericht Sächsisches Staatsarchiv 2014 1 Andrea Wettmann Aus den Beständen Grundbücher in Sachsen (Teil 2: Seit 1935) 9 Roland Pfirschke Zur audiovisuellen Überlieferung in den Abteilungen des Sächsischen Staatsarchivs (Teil 2: Chemnitz und Freiberg) 12 Stefan Gööck Leipziger Messe – Tor zur „Daten-Welt“. Messebestände elektronisch erschlossen 14 Katrin Heil/Birgit Richter Gießmannsdorf – verlorenes Land. Eine Geschichte zum Braunkohlebergbau 16 Bernd Scheperski Gottfried Huppertz – Werke des „Metropolis“-Filmkomponisten ermittelt 18 Elisabeth Veit Meldungen/Berichte „Akten – Akteure – Erinnerungen“ – Veranstaltung der BStU-Außenstelle Chemnitz zur politischen Wende von 1989 im Staatsarchiv Chemnitz 19 Raymond Plache Lagerorte auf Knopfdruck – Einführung des AUGIAS-Archiv-Magazinmoduls im Staatsarchiv Chemnitz 20 Tobias Crabus/ Yvonne Gerlach/Raymond Plache Wider besseres Wissen – Positionspapier des Umweltbundesamtes zur Archivierbarkeit von Recyclingpapier mit dem „Blauen Engel“ 24 Thomas Sergej Huck Bestandserhaltung im Staatsarchiv Chemnitz – Zusammenarbeit mit der Stadtmission Chemnitz 26 Tobias Crabus/Katja Gehmlich Sächsisches Berg- und Hüttenwesen digital 28 Angela Kugler-Kießling/Oliver Löwe Workshop des Landesverbandes Sachsen im VdA „Auf dem Weg ins Archivportal-D“ 30 Grit Richter-Laugwitz Rezensionen Matthias Donath, Rotgrüne Löwen. Die Familie von Schönberg in Sachsen 31 Jens Kunze Elke Schulze, Erich Ohser alias e. o. plauen 32 Clemens Heitmann Jahresbericht Sächsisches Staatsarchiv 2014 Der umfassende Modernisierungsprozess, 2014 Staatsarchiv Sächsisches Jahresbericht der 2005 mit der Gründung des Sächsischen Staatsarchivs begonnen und mit der Been- digung der Baumaßnahmen an vier von ins- gesamt fünf Standorten 2013 einen vorläu- figen Höhepunkt gefunden hatte, wurde im Berichtsjahr mit dem Kabinettsbericht zum Unterbringungsprogramm und mit der No- vellierung des Archivgesetzes für den Freistaat Sachsen abgeschlossen. -

The Film Music of Edmund Meisel (1894–1930)
The Film Music of Edmund Meisel (1894–1930) FIONA FORD, MA Thesis submitted to The University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy DECEMBER 2011 Abstract This thesis discusses the film scores of Edmund Meisel (1894–1930), composed in Berlin and London during the period 1926–1930. In the main, these scores were written for feature-length films, some for live performance with silent films and some recorded for post-synchronized sound films. The genesis and contemporaneous reception of each score is discussed within a broadly chronological framework. Meisel‘s scores are evaluated largely outside their normal left-wing proletarian and avant-garde backgrounds, drawing comparisons instead with narrative scoring techniques found in mainstream commercial practices in Hollywood during the early sound era. The narrative scoring techniques in Meisel‘s scores are demonstrated through analyses of his extant scores and soundtracks, in conjunction with a review of surviving documentation and modern reconstructions where available. ii Acknowledgements I would like to thank the Arts and Humanities Research Council (AHRC) for funding my research, including a trip to the Deutsches Filminstitut, Frankfurt. The Department of Music at The University of Nottingham also generously agreed to fund a further trip to the Deutsche Kinemathek, Berlin, and purchased several books for the Denis Arnold Music Library on my behalf. The goodwill of librarians and archivists has been crucial to this project and I would like to thank the staff at the following institutions: The University of Nottingham (Hallward and Denis Arnold libraries); the Deutsches Filminstitut, Frankfurt; the Deutsche Kinemathek, Berlin; the BFI Library and Special Collections; and the Music Librarian of the Het Brabants Orkest, Eindhoven. -

Adventures in Film Music Redux Composer Profiles
Adventures in Film Music Redux - Composer Profiles ADVENTURES IN FILM MUSIC REDUX COMPOSER PROFILES A. R. RAHMAN Elizabeth: The Golden Age A.R. Rahman, in full Allah Rakha Rahman, original name A.S. Dileep Kumar, (born January 6, 1966, Madras [now Chennai], India), Indian composer whose extensive body of work for film and stage earned him the nickname “the Mozart of Madras.” Rahman continued his work for the screen, scoring films for Bollywood and, increasingly, Hollywood. He contributed a song to the soundtrack of Spike Lee’s Inside Man (2006) and co- wrote the score for Elizabeth: The Golden Age (2007). However, his true breakthrough to Western audiences came with Danny Boyle’s rags-to-riches saga Slumdog Millionaire (2008). Rahman’s score, which captured the frenzied pace of life in Mumbai’s underclass, dominated the awards circuit in 2009. He collected a British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) Award for best music as well as a Golden Globe and an Academy Award for best score. He also won the Academy Award for best song for “Jai Ho,” a Latin-infused dance track that accompanied the film’s closing Bollywood-style dance number. Rahman’s streak continued at the Grammy Awards in 2010, where he collected the prize for best soundtrack and “Jai Ho” was again honoured as best song appearing on a soundtrack. Rahman’s later notable scores included those for the films 127 Hours (2010)—for which he received another Academy Award nomination—and the Hindi-language movies Rockstar (2011), Raanjhanaa (2013), Highway (2014), and Beyond the Clouds (2017). -

The Music of Relationality in the Cinema of Claire Denis
ORBIT-OnlineRepository ofBirkbeckInstitutionalTheses Enabling Open Access to Birkbeck’s Research Degree output Concert and disconcertion: the music of relationality in the cinema of Claire Denis https://eprints.bbk.ac.uk/id/eprint/40453/ Version: Full Version Citation: Brown, Geoffrey (2019) Concert and disconcertion: the music of relationality in the cinema of Claire Denis. [Thesis] (Unpublished) c 2020 The Author(s) All material available through ORBIT is protected by intellectual property law, including copy- right law. Any use made of the contents should comply with the relevant law. Deposit Guide Contact: email 1 Concert and Disconcertion : the music of relationality in the cinema of Claire Denis Geoffrey Brown Thesis submitted for the degree of PhD in French 2019 Department of European Cultures and Languages Birkbeck, University of London 2 Declaration I declare that the work presented in this thesis is my own, and that this thesis is the one on which I expect to be examined. Geoffrey Brown 3 This thesis is dedicated to Agnès Calatayud, an inspirational teacher, who reconnected me to French cinema after a long carence, and who, crucially, first introduced me to the films of Claire Denis. 4 Abstract This thesis argues that the interest which the films of Claire Denis display in the ever-shifting modes of relations between people is illustrated through analysis of how music is used throughout her corpus of feature films. Denis draws on an extremely eclectic palette of musical styles, and the thesis proposes that these varying musical modalities are central to her treatment of relational issues, as are the ways in which she deploys her chosen musical selections. -

Bibliographie Der Filmmusik: Ergänzungen II (2014–2020)
Repositorium für die Medienwissenschaft Hans Jürgen Wulff; Ludger Kaczmarek Bibliographie der Filmmusik: Ergänzungen II (2014– 2020) 2020 https://doi.org/10.25969/mediarep/14981 Veröffentlichungsversion / published version Buch / book Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Wulff, Hans Jürgen; Kaczmarek, Ludger: Bibliographie der Filmmusik: Ergänzungen II (2014–2020). Westerkappeln: DerWulff.de 2020 (Medienwissenschaft: Berichte und Papiere 197). DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/14981. Erstmalig hier erschienen / Initial publication here: http://berichte.derwulff.de/0197_20.pdf Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Creative Commons - This document is made available under a creative commons - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0/ Attribution - Non Commercial - No Derivatives 4.0/ License. For Lizenz zur Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu dieser Lizenz more information see: finden Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Medienwissenschaft: Berichte und Papiere 197, 2020: Filmmusik: Ergänzungen II (2014–2020). Redaktion und Copyright dieser Ausgabe: Hans J. Wulff u. Ludger Kaczmarek. ISSN 2366-6404. URL: http://berichte.derwulff.de/0197_20.pdf. CC BY-NC-ND 4.0. Letzte Änderung: 19.10.2020. Bibliographie der Filmmusik: Ergänzungen II (2014–2020) Zusammengestell !on "ans #$ %ul& und 'udger (aczmarek Mit der folgenden Bibliographie stellen wir unseren Leser_innen die zweite Fortschrei- bung der „Bibliographie der Filmmusik“ vor die wir !""# in Medienwissenschaft: Berichte und Papiere $#% !""#& 'rgänzung )* +,% !"+-. begr/ndet haben. 1owohl dieser s2noptische 3berblick wie auch diverse Bibliographien und Filmographien zu 1pezialproblemen der Filmmusikforschung zeigen, wie zentral das Feld inzwischen als 4eildisziplin der Musik- wissenscha5 am 6ande der Medienwissenschaft mit 3bergängen in ein eigenes Feld der Sound Studies geworden ist. -

Newsletter 17 Autumn 2009 • • Im! Newsletter JEWISH MUSIC INSTITUTE SOAS Yearbook of 2009 Informing, Teaching, Performing, Inspiring
newsletter 17 Autumn 2009 • • Im! newsletter JEWISH MUSIC INSTITUTE SOAS Yearbook of 2009 informing, teaching, performing, inspiring JMI Forging Ahead Towards 2010 Chairman Jonathan Metliss looks forward to the future Under its immensely committed group of officers and trustees, and with the assistance of my deputy chair, Jennifer Jankel, daughter of the late Joe Loss, I am delighted to say that JMI is striding forward confid ently and with energy and enthusiasm into the next decade. We warmly welcome new trustees, David Mencer, Gordon Hausmann and lan Braidman, Professor Stuart Stanton and Rabbi Norman Solomon, all of whom are in the forefront of communal and business affairs. They all love Jewish music and bring a wealth of experience , creativity and imagination to the Board. Short profiles are set out on page 3. Our August klezmer concert in the heady atmosph ere of Camden Town's Jazz Cafe during KlezFest drew a rich mix of audience members who relished music from the leading lights of European Klezmer - and the classical virtuoso Em ma Johnson. [S ee the article on What makes klezmer so special? on page 6]. This was an id eal exam ple of JMI eng ag ing the interest of a wide audience including the younger generation. 'Klezmer in the Park' was an outstanding afternoon with the Jewish Community out in force enjoying a real feast of great Jewish music in the su nshine of Regent's Park. Many thanks to the Mayor of London and the Royal Parks and our co llea gu es in Jewish Culture UK, for ena bling JMI to organise and prese nt this wonderful Festival. -
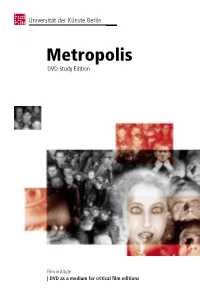
Metropolis DVD Study Edition
Metropolis DVD Study Edition Film institute | DVD as a medium for critical film editions 2 Table of Contents Preface | Heinz Emigholz 3 Preface | Hortensia Völckers 4 Preface | Friedemann Beyer 5 DVD: Old films, new readings | Enno Patalas 6 Edition of a torso | Anna Bohn 8 Le tableau disparu | Björn Speidel 12 Navigare necesse est | Gunter Krüger 15 Navigation-Model 18 New Tower Metropolis | Enno Patalas 20 Making the invisible “visible” | Franziska Latell & Antje Michna 23 Metropolis, 1927 | Gottfried Huppertz 26 Metropolis, 2005 | Mark Pogolski & Aljioscha Zimmermann 27 Metropolis – Synopsis 28 Film Specifications 29 Contributors 30 Imprint 33 Thanks 35 3 Preface Many versions and editions exist of the film Metropolis, dating back to its very first screening in 1927. Commercial distribution practice at the time of the premiere cut films after their initial screening and recompiled them according to real or imaginary demands. Even the technical requirements for production of different language versions of the film raise the question just which “original” is to be protected or reconstructed. In other fields of the arts the stature and authority that even a scratched original exudes is not given in the “history of film”. There may be many of the kind, and gene- rations of copies make only for a cluster of “originals”. Reconstruction work is therefore essentially also the perception of a com- plex and viable happening only to be understood in terms of a timeline – linear and simultaneous at one and the same time. The consumer’s wish for a re-constructible film history following regular channels and self-con- tained units cannot, by its very nature, be satisfied; it is, quite simply, not logically possible. -
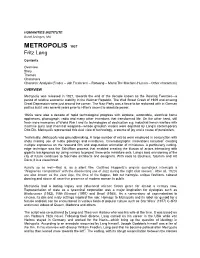
METROPOLIS 1927 Fritz Lang
HUMANITIES INSTITUTE Burak Sevingen, MA METROPOLIS 1927 Fritz Lang Contents Overview Story Themes Characters Character Analysis (Freder – Joh Fredersen – Rotwang – Maria/The Machine-Human – Other characters) OVERVIEW Metropolis was released in 1927, towards the end of the decade known as the Roaring Twenties—a period of relative economic stability in the Weimar Republic. The Wall Street Crash of 1929 and ensuing Great Depression were just around the corner. The Nazi Party was a force to be reckoned with in German politics but it was several years prior to Hitler‘s ascent to absolute power. 1920s were also a decade of rapid technological progress with airplane, automobile, electrical home appliances, phonograph, radio and many other inventions that transformed life. On the other hand, still fresh were memories of World War I and its technologies of destruction e.g. industrial trench warfare with machine guns and chemical weapons—whose ghoulish visions were depicted by Lang‘s contemporary Otto Dix. Metropolis represented this dual view of technology, a source of joy and a cause of pessimism. Technically, Metropolis was groundbreaking. A large number of extras were employed in conjunction with shots making use of matte paintings and miniatures. Cinematographic innovations included1 creating multiple exposures on the rewound film and stop-motion animation of miniatures. A particularly cutting- edge technique was the Schüfftan process that enabled creating the illusion of actors interacting with gigantic backgrounds by using mirrors to project them onto miniature sets. Lang‘s bold envisioning of the city of future continues to fascinate architects and designers. With nods to Bauhaus, futurism and Art Déco, it is a visual treat. -

Frank Strobel's Biography
FRANK STROBEL CONDUCTOR Cine-concert specialist, the German conductor Frank Strobel is a renowned arranger, editor and producer. He spent his childhood in Munich in the cinema run by his parents. In 2004, he reconstituted and edited the score composed by Prokofiev for the film Alexandre Nevski (Sergej Eisenstein). He presented this new version at the Konzerthaus in Berlin with the Berlin Radio Symphony Orchestra and then at the Bolshoi Theatre in Moscow. On the occasion of the projection of Der Rosenkavalier (Robert Wiene) at the Dresden Opera in 2006, he conducted the Dresden Staatskapelle and played Richard Strauss’s reconstituted score. Following the discovery in 2008 of an original copy of Metropolis by Fritz Lang in Buenos Aires, he conducted the Berlin Radio Symphony Orchestra and played the music of Gottfried Huppertz for the first projection of the restored version of the film at the 2010 Bienale. The following year, he conducted the Philharmonic Orchestra of the NDR of Hanover for the projection of Matrix (music by Don Davis) at the Royal Albert Hall in London. In 2014, with the Orchestre philharmonique de Radio France he gave the first performance of the music composed by Philippe Schoeller for the film J’accuse directed by Abel Gance in 1919. In 2016, he reconstituted the score of the music to Ivan the Terrible (Sergej Eisenstein), given for the first time in the complete version and in Prokofiev’s original orchestration at the Berlin Musikfest with the Berlin Radio Symphony Orchestra. On top of cine-concerts, he is a specialist of the late romantic composers such as Schreker, Zemlinsky and Siegfried Wagner, whose works he has taken up again and reproduced. -

02.12.2015 Weimar, Deutsches Nationaltheater
Weimar, Deutsches 02.12.2015 Albrecht, George Alexander - Die Schneekönigin Nationaltheater Albrecht, George Alexander - G. A. Albrechts - Die Weimar, Deutsches 28.11.2015 Schneekönigin - am 28. November 2015 in Weimar Nationaltheater (UA) Hans Rott/ Hrsg. Bert Hagels - Symphonie Nr. 1 E- 28.11.2015 Bonn, Audi-Max Dur Hans Rott/ Hrsg. Bert Hagels - Symphonie Nr. 1 E- 26.11.2015 Bochum, Audi-Max Dur Albrecht, George Alexander - G.A. Albrechts - Der Weimar, Stadtkirche St. 22.11.2015 Himmel über Syrien (UA) - am 22. November 2015 Peter & Paul zu Weimar in Weimar Hans Rott/ Hrsg. Bert Hagels - Symphonie Nr. 1 E- 19.11.2015 Wien, RadioKulturhaus Dur München, Einstein Kultur, Stöß, Thomas - CHRISTOPHORUS für Flöte, Oboe 16.11.2015 Halle 2 (UG) und Harfe (UA) Salzburg, Großes Hans Rott / Bert Hagels (Hrsg.) - Sinfonie Nr. 1 E- 08.11.2015 Festspielhaus Dur für Orchester Schweiz, Malters, Ries, Ferdinand/ Hagels, Bert (Hrsg.) - Sinfonie D- 08.11.2015 Pfarrkirche Dur Wüsthoff, Klaus - Kuscheltierkonzert (für großes 08.11.2015 Magdeburg, Theater Orchester) Magdeburg - Opernhaus, Klaus Wüsthoff - Kuscheltierkonzert (Neufassung 08.11.2015 Bühne 2006) für großes Orchester und Erzähler Edmund Meisel / Helmut Imig (Bearb) - Musik zum 08.11.2015 Rostock Eisenstein-Stummfilm PANZERKREUZER POTEMKIN für großes Orchester Schwerin, 04.11.2015 Mecklenburgisches Albrecht, George Alexander - Der Geistkämpfer Staatstheater Schwerin, 03.11.2015 Mecklenburgisches Albrecht, George Alexander - Der Geistkämpfer Staatstheater Schwerin, Albrecht, George Alexander - Der Geistkämpfer von 02.11.2015 Mecklenburgisches George Alexander Albrecht am 2.(UA), 3. und 4. Staatstheater November in Schwerin 31.10.2015 Küsten, Tolstefanz Rubbert, Rainer - Toccata für Klarinette solo Spanien, Castilla-León, Meisel, Edmund/ Imig, Helmut (Bearb.) - Musik zum 30.10.2015 Auditorio del CCMD de Stummfilm Panzerkreuzer Potemkin am 30.