Im Überblick
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Faktensammlung Zur Geschichte Von Frauenstein 09.11.2019
Faktensammlung zur Geschichte von Frauenstein 09.11.2019 - Eine ungeordnete Sammlung zur individuellen Verwendung - Entstehung des Namens Frauenstein – eine denkbare Version In der Festschrift zur 25-jährigen Städtepartnerschaft mit Zell am Harmersbach deutet Wolf- Dieter Geißler an: Eine arme Wahrsagerin namens Libussa rettet das Volk der Tschechen nach einer furchtbaren Seuche. Sie heiratete einen armen Pflüger namens Premysl und gründet so mit ihm die Herrschaft der Premyslinen. Der Sage nach soll sie Frauenstein am Ende des ersten Jahrtausends n. Chr. gegründet haben. Sie sitzt im Wappen von Frauenstein auf einem Stein und hält einen Dreizweig in der Hand, den ihr Mann gepflanzt hat. Die älteste schriftliche Überlieferung liegt mit der Christianslegende vor, die 992 – 994, möglicherweise im Kloster 5Břevnov, entstand. Nach ihr lebte das heidnische Volk der Tschechen ohne Gesetz und ohne Stadt, wie ein „unverständiges Tier“, bis eine Seuche ausbrach. Auf den Rat einer namenlosen Wahrsagerin gründeten sie die Prager Burg und fanden mit 53Přemysl einen Mann, der mit nichts als dem Pflügen der Felder beschäftigt war. Diesen setzten sie als Herrscher ein und gaben ihm die Wahrsagerin zur Frau. Diese beiden Maßnahmen befreiten das Land von der Seuche, und alle nachfolgenden Herrscher stammten aus dem Geschlecht des Pflügers. Die Přemysliden herrschten seit dem Ende des 9. Jahrhunderts als 36Herzöge von Böhmen. Erster König von Böhmen wurde 1158 Vladislav II., mit 5Ottokar I. wurde das Königtum 1198 erblich. 1212 wurden die 36Länder der böhmischen Krone zum Königreich innerhalb des Heiligen Römischen Reiches erhoben. In der Chronica Boemorum des Cosmas von Prag vom Beginn des 12. Jahrhunderts ist die nun Libuše genannte Wahrsagerin Tochter des Richters Krok (des Nachfolgers vom Urvater 48Čech) und jüngste Schwester der Heilkundigen Kazi und der Priesterin Teta. -

Institute of Mineralogy – Report 2008
Institute of Mineralogy – Report 2008 2008 has been a very special year for us. Following more than four years of intense prepara- tions, terra mineralia opened its gates to the public in October with a week of festivities (see also report 2007). Ever since, the steady stream of visitors from near and afar has already lured more than 50,000 people to the exhibits, and Freiberg is more lively than ever. With the successful filling of the chair of Mineral Resources and Petrology with Dr. Jens Gutzmer (be- fore: University of Johannesburg, RSA), our house is finally complete again and all three groups back to full strength. Shortly before the end of the year, the working group Applied and General Mineralogy received a particular honour: Dr. Kristian Ufer was bestowed with the Hans-Joachim-Martini-Award for his works in the “Development of structural models for the Rietveld quantification of swellable illite/smectite minerals in rocks”. This is the solution of a riddle that has been seen as a non-solvable applied problem for many decades. The addi- tional impetus from these successes is already noticeable. The year was much richer, how- ever, and the following pages report about related events and achievements. We should not neglect the sad sides, though. This mainly includes the death of three reputable professors of our institute who have strongly contributed to shaping our house, its reputation and direc- tion. Institute, University and City Contemporary issues in and around Freiberg. Rector (Vice-chancellor) Georg Unland was nominated the new Finance Minister of our Free-state of Saxony. -

Frauenstein Und 173
172 Frauenstein und 173 Text: Werner Ernst, Kleinbobritzsch (unter Verwendung einer Zuarbeit von Christiane Mellin; Ergänzungen von Jens Weber) Fotos: Nils Kochan, Gerold Pöhler, Jens Weber Gimmlitztal Gneis, Quarzit, Phyllit, Kalk, Porphyr Fließgewässerdynamik, Bachorganismen, Wassernutzung Bergwiesen, Wald-Storchschnabel, Orchideen 174 Frauenstein und Gimmlitztal Karte 175 176 Frauenstein und Gimmlitztal 1 Schickelshöhe 8 Hermsdorf 2 Waltherbruch 9 Kreuzwald 3 Kalkwerk Hermsdorf und 10 Bobritzschquelle und Reichenau Naturschutzgebiet Gimmlitzwiesen 11 Bobritzschtal bei Frauenstein 4 Gimmlitztal 12 Turmberg und Holzbachtal 5 Burg und Stadt Frauenstein 13 Bobritzschtal bei Friedersdorf 6 Schlosspark Frauenstein und Oberbobritzsch 7 Buttertöpfe und Weißer Stein Die Beschreibung der einzelnen Gebiete folgt ab Seite 186 „Soviel ist entschieden: Die Geschichte steht nicht neben, sondern in der Natur“ (Carl Ritter, Geograph, 1779 –1859) Landschaft Mittelpunkt Ziemlich genau im geografischen Mittelpunkt des Ost-Erzgebirges liegt des Ost-Erz- Frauenstein. Die Umgebung der Kleinstadt entspricht in vielerlei Hinsicht – gebirges Geologie, Oberfläche, Gewässer, Böden – dem Durchschnitt der nördlichen Osterzgebirgs-Pultscholle. Weitgehend landwirtschaftlich genutzte Gneisflächen prägen die Umgebung Frauensteins, über die sich einzelne Por phyrkuppen und -rücken erheben. Gegliedert wird die Landschaft von den südost-nordwest-verlaufenden Mulde-Nebenbächen Gimmlitz und Bobritzsch, am Ostrand auch vom hier sehr schmalen Einzugsgebiet der Wilden Weißeritz. Klima Im Klima macht sich der Höhenunterschied von fast 400 m zwischen den Orten Bobritzsch und Hermsdorf deutlich bemerkbar, wie aus den folgen- den Angaben für die unteren und die oberen Lagen (Frauenstein in der Mitte) hervorgeht: Mittlere Lufttemperatur im Jahr: zwischen 7,5 (6,0) und 5,0° ; im Januar zwischen –1,5° (–2,5°) und –4° C ; im Juli zwischen 16,5° (15,5°) und 14,5°. -

14 22 5 Unterwegs Zum Brand
Mit Veranstaltungskalender Mai und Juni 2013 www.SandsteinKurier.dewww.SandsteinKurier.de Zeitung für Freunde der Sächsischen8. Jahrgang Schweiz - Ausgabe 56 6. Jahrgang - Ausgabe 44 - Sept./OktoberMai/Juni 2011 2013 Zeitung für Freunde und Gäste der Sächsischen Schweiz und des Osterzgebirges Unterwegs zum Brand Seite 25 DIE SandsteinKurier THEMEN Vom 15. bis 23. Juni 2013 findet erst- mals die Nationalparkwoche in Hinter- hermsdorf statt. Exkursionen, Wande- rungen, Vorträge. Ein Holzkohle-Meiler 5 spielt eine tragende Rolle. Erstmals waren wir in Maxen oberhalb des Müglitztales unterwegs. Überra- schend, was diese kleine Gemeinde zu bieten hat. Sie entpuppte sich als Ort 10 der Kunst und der Künstler. Unterwegs in der Sächsischen und Böhmischen Schweiz - eine Tour, die mit dem OVPS-Fahrradbus begann und dann zu Fuß bzw. auf dem Fahr- 14 rad fortgesetzt wurde. In Krippen hat die Uhrzeit ein Ren- dezvous mit der Sonne. Wir trafen Gerd Englick, einen der Initiatoren und Macher des Sonnenuhrenweges und 22 erfuhren viel Interessantes. Newspaper for friends of the Saxon1 Switzerland and Erzgebirge Informiert Gasthof & Pension „Weiße Taube“ • Bis 31. Oktober 2013: Dienstag Ruhetag (außer Feiertage) Familienfeiern auch an Ruhetagen • Mitt- woch bis Montag ab 10:59 Uhr geöffnet • Schattiger Biergarten an der Straße zur Bastei • Pfingstsamstag, 18.5.13, letzter Tanzabend vor der Sommer-Tanz-Pause Arthur-Thiemann-Str. 58, 01796 Pirna Wir freuen uns auf Sie! Tel.: 03501 524120 Grenzüberschreitende Mit dem Pirn‘schen Nachtwächter unterwegs Gastronomie-Ausbildung Hört ihr Leute lasst euch sagen Reina Dietze, Kö- chin im Elbhotel Wer ihn nicht kennt, den Jahre 2003 in der Barbiergasse Bad Schandau (r.), Pirn‘schen Nachtwächter Wolf- ansässig und betreibt daselbst zeigt Lehrling gang, alias Wolfgang Bieberstein, die Pirn´sche Nachtwächterei. -

Begründung Zum Flächennutzungsplan Der
Begründung zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf Stand 27.06.2019 Flächennutzungsplan der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf Begründung - Fassung vom 27.06.2019 Inhaltsverzeichnis 1 Rechtliche und planerische Grundlagen ............................................................ 1 1.1 Rechtsgrundlage und Aufgabe der Bauleitplanung ............................................ 1 1.2 Inhalt des Flächennutzungsplans und Rechtswirkung ....................................... 2 1.3 Darstellungen innerhalb des Flächennutzungsplans.......................................... 3 2 Ausgangssituation und vorhandene Planungen ............................................... 3 2.1 Ausgangssituation ............................................................................................. 3 2.2 Bestehende örtliche und überörtliche Planungen .............................................. 3 2.3 Allgemeine Ziele des Flächennutzungsplans ..................................................... 6 3 Allgemeine Angaben ........................................................................................... 6 3.1 Lage und Größe des Planungsgebiets .............................................................. 6 3.2 Großräumige Verkehrslage ............................................................................... 7 4 Landschaft ........................................................................................................... 8 4.1 Naturräumliche Gliederung ............................................................................... -

Erlã¤Uterungen Zur Geologischen Specialkarte Des KöNigreichs
o,9;1;zed by Google SECTION FREIBERG. Section Freiberg gehört dem mittleren bis niederen Theile des Erzgebirges an und liegt im nordöstlichen Abschnitte der grossen Freiberger Gneisskuppel. In Uebereinst.immung mit der allgemeinen topographischen Gestaltung des Erzgebirges dacht sich das Gebiet der Section Freiberg ganz allmählich von SO. nach NW. ab; die höchsten Punkte liegen daher im 80.-Theile und erreichen eine Höhe von 470 m, während der niedrigste Punkt mit 260 m Meeres höhe durch den Austrittspunkt der Bobritzsch am Nordwestrande der Section bezeichnet wird. · Der bedeutendste Niveauunterschied im Sectionsgebiete beläuft sieh sonach auf 2io m; .das allgemeine Abfallen der Oberfläche nach Nordwest bin dagegen nur auf 100 m, die mittlere Höbe in der 80.-Ecke der Section zu 430 m, in der 1'"W.-Ecke zu 330 m angenommen; endlich das Gefälle der die Section von Süd nach Nordwest durchströmenden Bobritzsch auf 160 m. Die Terrainformen sind, wie im Erzgebirge überhaupt, vor wiegend flach wellig bis plateauartig; nur an den Gehängen der Haupt- und grossen Nebenthäler wird die Neigung der Oberfläche steiler und geht z. Th. in völlig senkrechte Abstürze über, so im Muldethale bei Muldener Hütten, gegenüber der Papierfabrik bei Halsbach, und besonders bei Halsbrücke-Sand; im Bobritzsch tbale oberhalb Naundorf, sowie unterhalb der Forstmühle bei Krummhennersdorf, und von da fast. ununterbrochen bis zur Sections grenze bei Biberstein; im Colmnitzgrunde zwischen Naundorf und Niedercolmnitz, endlich im Triebischthale bei Grund. Mit Ausnahme der die Nordostecke der Section entwässernden Triebisch mit dem Hetzbache, welche direct der Elbe zuftiessen, o,9;1;zed by Google 2 SECTION FREIBERG. werden alle kleineren und grösseren W asseradem der Section ent weder direct von der Mulde, welche den südwestlichen Theil durch strömt, oder von ihrem grössten rechtsseitigen Zuflusse, der die Mitte der Section durchschneidenden, bei Siebenlehn einmündenden Bobritzsch aufgenommen. -

Die Gemeinde Begrüßt Ihre Neuen Einwohner
Seite 1 Amts-ERSCHEINUNGSTAG: und Mitteilungsblatt 15.11.2012der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf 11. AUSGABEErscheinungstag: 15.11.2012 Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf mit den Ortsteilen Hilbersdorf, Naundorf, Niederbobritzsch, Oberbobritzsch und Sohra Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 03.12.2012 Die Gemeinde begrüßt ihre neuen Einwohner Am 24. Oktober 2012 fand die Feierstunde des Bürgermeisters für die Neugeborenen der Monate Mai – September und deren Eltern statt. Wir wünschen allen eine glückliche Zukunft. Impressum: Verantwortlich für den amtlichen Teil: Volker Haupt, Bürgermeister der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Katrin Gutwasser Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf · Hauptstraße 80 · 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf · Telefon: 037325 2380 · Fax: 037325 23823 Internetadresse: www.bobritzsch-hilbersdorf.de · E-Mail: [email protected] Druck: Druckerei Gebrüder Schütze GbR, 09429 Wolkenstein Seite 2 Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf Erscheinungstag: 15.11.2012 TOP: 08 Auswertung der Gemeinderatsitzung vom Beratung und Beschlussfassung zum Wappen der 23.Oktober 2012 Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf TOP: 04 Beschluss-Nr.: 87/10/2012 Protokollkontrolle und Bekanntgabe nicht öffentlich Der Gemeinderat nimmt den Entwurf des Wappens zur Kenntnis gefasster Beschlüsse und beauftragt den Bürgermeister, die Bevölkerung in die Gestal- tung des Wappens einzubeziehen. Beschluss-Nr.: 83/10/2012 Die Niederschrift des Gemeinderates Bobritzsch-Hilbersdorf vom Abstimmungsergebnis: 25. September 2012 wird bestätigt. Mitglieder gesamt: 29 Mitglieder anwesend: 22 Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 22 Mitglieder gesamt: 29 Nein-Stimmen: 00 Mitglieder anwesend: 22 Stimmenthaltungen: 00 Ja-Stimmen: 22 Nein-Stimmen: 00 TOP 09 Stimmenthaltungen: 00 Beratung und Beschlussfassung zum Verfahren zur Umbenennung von Straßen in der Gemeinde TOP: 05 Bobritzsch-Hilbersdorf Beratung und Beschlussfassung zur 1. -

Freistaat Sachsen Talsperren, Wasserspeicher Und
. b z Wörblitz n e TS Trossin r G r W e e 45 h i zs c n it s m k m e Do Dommitzsch e ra b n t g s D eu r bi t z o h b a ch Trossin H c n hle B ac a r ü e M ü h b G r e c h m ba a if xb ch m e hl i r a Sc S Elsnig H t e M u l Al d h e c Bad Düben a L h b r Bac S ö e ne h thaus L auc c z a b Au it h n n e h i i c t TS Süptitz en z b g s ra r b d e (Hölzchenteich) e ä Zwethau n R s ch e E Z rn 44 Torgau Schleife Bad Muskau e g l r b aben R G ö e h r h Z g l c r L l Großer Teich Reibitz a a i ab a / u e n L b n e Ka o b c l n n g e - e h ei n r ü h a 1 S n 128 a e i er - L M r tr t b e F lu t/ R u z o r o ga k t a L e B F a u r Krauschwitz c t K Trebendorf h o o r TS Schadebach II (Badrina) ß d f er S Großer Teich Torgau L Sagar c M h a E n ü 127 TS Schadebach I (Krippehna) w e n ller d S a b grab 43 g r hl a e a L p R G r S n ben g r r r a a ö 126 r a o e z z u b u d r b F h l Weißwasser/O.L. -

Umweltbericht Gemäß § 2A Baugb Zum Flächennutzungsplan Der
Umweltbericht gemäß § 2a BauGB zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf Träger der Bauleitplanung: Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf Hauptstraße 80 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf Planung: Envipro Project GmbH & Co. KG Blasewitzer Straße 41 01307 Dresden Bearbeitung: Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur Christiane Rindt Bearbeitungsstand: 27. Juni 2019 Flächennutzungsplan der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf Umweltbericht - Stand 27.06.2019 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ............................................................................................................. 1 1.1 Anlass und Rechtsgrundlage ............................................................................. 1 1.2 Inhalt und Ziele des Flächennutzungsplans ....................................................... 2 1.3 Darstellung der Ziele des Umweltschutzes ........................................................ 4 2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen ................................ 6 2.1 Naturräumliche Einordnung ............................................................................... 6 2.2 Schutzgut Boden ............................................................................................... 7 2.3 Schutzgut Wasser ........................................................................................... 14 2.4 Schutzgut Klima .............................................................................................. 19 2.5 Schutzgut Arten und Biotope .......................................................................... -

Muldental Bei Freiberg Karte 113 114 Muldental Bei Freiberg
112 Muldental bei Freiberg Karte 113 114 Muldental bei Freiberg 1 Altväterbrücke 6 „Grabentour“ zwischen Krummen- hennersdorf und Reinsberg 2 Siebentes und Achtes Lichtloch des Rothschönberger Stollns 7 Schlösser Reinsberg und Bieberstein 3 Muldental von Halsbrücke bis 8 Viertes Lichtloch des Halsbach Rothschönberger Stollns 4 Alte Hüttengebäude in Mulden- 9 Klosterruine Altzella hütten 5 Ehemaliges Bergbaugebiet um Muldenhütten und Weißenborn Die Beschreibung der einzelnen Gebiete folgt ab Seite 124 Landschaft Bei Muldenhütten und im gesamten Norden des Gebietes durchströmt die Mulde vorwiegend enge Kerbsohlentäler, örtlich – wie bei Weißenborn und wechselnde von Halsbach bis Rothenfurth – auch breitere Sohlentäler. Dadurch zeich Talformen net sich dieser Flussabschnitt durch einen reizvollen Wechsel von Weitun gen und Verengungen aus. Markant sind an den Flussschleifen einerseits steile Prallhänge und andererseits flache Gleithänge ausgebildet. Jedoch wurden auch große Bereiche des Muldentales durch eine über Jahrhunderte andauernde Ablagerung von taubem Gestein, Hüttenschla cke, Schlämmsanden (zum Zweck der Erzabscheidung gemahlenes Ge stein) und anderen Abfallstoffen künstlich verengt. Das betrifft in besonde rem Maße die Abschnitte in der Nähe von Muldenhütten und Halsbrücke. Bergwerks- Größere Bergwerkshalden gibt es aber auch im Norden des Gebietes, vor halden allem bei Großschirma und Kleinvoigtsberg. Das natürlich anstehende Gestein ist fast überall Gneis, der in Flussnähe stellenwei se in Form offener Felsen sichtbar wird. Lediglich bei Obergruna stellt Glimmer schiefer das Oberflächengestein dar. Das gegenwärtige Vegetationsbild zeichnet sich durch einen relativ hohen Waldanteil an den Hängen beiderseits der Freiberger Mulde aus. Ferner nimmt Grünland einen Teil der Hänge ein. Das angrenzende, höher gelegene Hügelland wird vorrangig als Ackerland genutzt. Der nördlichste Teil Abb.: Gneisfelsen bei Halsbrücke mit Rau- des Gebietes gehört zum Landschafts haariger Nabelflechte (Umbilicaria hirsuta) schutzgebiet „Grabentour“. -

Sattelberg Und Gottleubatal Karte 597 598 Sattelberg Und Gottleubatal
596 Sattelberg und Gottleubatal Karte 597 598 Sattelberg und Gottleubatal 1 Špičák / Sattelberg 13 Tannenbusch 2 Wiesen zwischen Oelsener Höhe 14 Gesundheitspark Bad Gottleuba und Sattelberg 15 Poetengang 3 Oelsener Höhe 16 Panoramahöhe 4 Mordgrund und Bienhof 17 Hochstein und Karlsleite 5 Stockwiese 18 Seismologisches Observatorium 6 Strompelgrund und Bocksberg Berggießhübel 7 Rundteil 19 Schaubergwerk Marie-Louise-Stolln 8 Oelsengrund 20 Bergbauzeugnisse im Fuchsbachtal (Martinszeche) 9 Talsperre Gottleuba 21 Gottleubatal unterhalb Zwiesel 10 Bahretal, Eisengrund und Heidenholz 22 Zeisigstein 11 Hohler Stein 23 Tiské stěny / Tyssaer Wände 12 Raabsteine Die Beschreibung der einzelnen Gebiete folgt ab Seite 609 Landschaft Ostflanke Landschaftlich außerordentlich abwechslungsreich ist die Ostflanke des des Erzge- Erzgebirges. Unter den Tiské stěny/Tyssaer Wänden und dem Zeisigstein birges verschluckt die Sächsisch-Böhmische Schweiz die Gneisscholle des Ost- Erzgebirges unter sich. Doch haben sich auch weiter westlich noch Reste Sandstein der Sandsteindecke erhalten, die am Ende der Kreidezeit einst ebenfalls über Gneis das Ost-Erzgebirge überlagert hatte (z. B. Raabstein, Wachstein, Fuß des Sattelberges). Im Nordosten findet das Erzgebirge an den vielfältigen Gesteinen des Elb- talschiefergebirges seinen Abschluss. Besonders der Turmalingranit, ein hartes, fast 500 Millionen Jahre altes Gestein, überragt mit einigen mar- kanten Erhebungen – Schärfling, Herbstberg, Helleberg, Tannenbusch – die Landschaft. Dieser Härtlingszug, der sich im Nordwesten mit der Quarz- porphyrkuppe des Roten Berges bei Borna fortsetzt, markiert als Ausläufer der Mittelsächsischen Störung die Grenze des Naturraumes Ost-Erzgebirge. Jenseits dominieren verschiedene Ton-Schiefer (Phyllite) sowie der Mar- Elbtal- kersbacher Granit. Als während der Entstehung des Elbtalschiefergebirges schiefer- dieses granitische Magma aufdrang, führten die damit einhergehenden gebirge enormen Hitze- und Druckbedingungen zur Umwandlung (Kontaktmeta- morphose) des umliegenden Gesteins. -
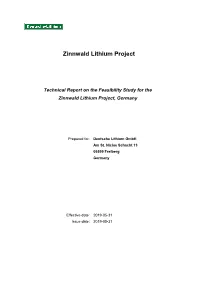
Zinnwald Lithium Project
Zinnwald Lithium Project Technical Report on the Feasibility Study for the Zinnwald Lithium Project, Germany Prepared for: Deutsche Lithium GmbH Am St. Niclas Schacht 13 09599 Freiberg Germany Effective date: 2019-05-31 Issue date: 2019-05-31 Zinnwald Lithium Project Technical Report on the Feasibility Study TABLE OF CONTENTS Page Date and Signature Page ............................................................................................................. 2 1 Summary ........................................................................................................................ 22 1.1 Property Description and Ownership ........................................................................ 22 1.2 Geology and Mineralization ...................................................................................... 22 1.3 Exploration Status .................................................................................................... 23 1.4 Resource Estimates ................................................................................................. 23 1.5 Reserve Estimates ................................................................................................... 25 1.6 Mining ...................................................................................................................... 26 1.7 Processing and Metallurgical Test Work .................................................................. 27 1.8 Recovery Methods ..................................................................................................