Frauenstein Und 173
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Faktensammlung Zur Geschichte Von Frauenstein 09.11.2019
Faktensammlung zur Geschichte von Frauenstein 09.11.2019 - Eine ungeordnete Sammlung zur individuellen Verwendung - Entstehung des Namens Frauenstein – eine denkbare Version In der Festschrift zur 25-jährigen Städtepartnerschaft mit Zell am Harmersbach deutet Wolf- Dieter Geißler an: Eine arme Wahrsagerin namens Libussa rettet das Volk der Tschechen nach einer furchtbaren Seuche. Sie heiratete einen armen Pflüger namens Premysl und gründet so mit ihm die Herrschaft der Premyslinen. Der Sage nach soll sie Frauenstein am Ende des ersten Jahrtausends n. Chr. gegründet haben. Sie sitzt im Wappen von Frauenstein auf einem Stein und hält einen Dreizweig in der Hand, den ihr Mann gepflanzt hat. Die älteste schriftliche Überlieferung liegt mit der Christianslegende vor, die 992 – 994, möglicherweise im Kloster 5Břevnov, entstand. Nach ihr lebte das heidnische Volk der Tschechen ohne Gesetz und ohne Stadt, wie ein „unverständiges Tier“, bis eine Seuche ausbrach. Auf den Rat einer namenlosen Wahrsagerin gründeten sie die Prager Burg und fanden mit 53Přemysl einen Mann, der mit nichts als dem Pflügen der Felder beschäftigt war. Diesen setzten sie als Herrscher ein und gaben ihm die Wahrsagerin zur Frau. Diese beiden Maßnahmen befreiten das Land von der Seuche, und alle nachfolgenden Herrscher stammten aus dem Geschlecht des Pflügers. Die Přemysliden herrschten seit dem Ende des 9. Jahrhunderts als 36Herzöge von Böhmen. Erster König von Böhmen wurde 1158 Vladislav II., mit 5Ottokar I. wurde das Königtum 1198 erblich. 1212 wurden die 36Länder der böhmischen Krone zum Königreich innerhalb des Heiligen Römischen Reiches erhoben. In der Chronica Boemorum des Cosmas von Prag vom Beginn des 12. Jahrhunderts ist die nun Libuše genannte Wahrsagerin Tochter des Richters Krok (des Nachfolgers vom Urvater 48Čech) und jüngste Schwester der Heilkundigen Kazi und der Priesterin Teta. -

Institute of Mineralogy – Report 2008
Institute of Mineralogy – Report 2008 2008 has been a very special year for us. Following more than four years of intense prepara- tions, terra mineralia opened its gates to the public in October with a week of festivities (see also report 2007). Ever since, the steady stream of visitors from near and afar has already lured more than 50,000 people to the exhibits, and Freiberg is more lively than ever. With the successful filling of the chair of Mineral Resources and Petrology with Dr. Jens Gutzmer (be- fore: University of Johannesburg, RSA), our house is finally complete again and all three groups back to full strength. Shortly before the end of the year, the working group Applied and General Mineralogy received a particular honour: Dr. Kristian Ufer was bestowed with the Hans-Joachim-Martini-Award for his works in the “Development of structural models for the Rietveld quantification of swellable illite/smectite minerals in rocks”. This is the solution of a riddle that has been seen as a non-solvable applied problem for many decades. The addi- tional impetus from these successes is already noticeable. The year was much richer, how- ever, and the following pages report about related events and achievements. We should not neglect the sad sides, though. This mainly includes the death of three reputable professors of our institute who have strongly contributed to shaping our house, its reputation and direc- tion. Institute, University and City Contemporary issues in and around Freiberg. Rector (Vice-chancellor) Georg Unland was nominated the new Finance Minister of our Free-state of Saxony. -

Begründung Zum Flächennutzungsplan Der
Begründung zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf Stand 27.06.2019 Flächennutzungsplan der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf Begründung - Fassung vom 27.06.2019 Inhaltsverzeichnis 1 Rechtliche und planerische Grundlagen ............................................................ 1 1.1 Rechtsgrundlage und Aufgabe der Bauleitplanung ............................................ 1 1.2 Inhalt des Flächennutzungsplans und Rechtswirkung ....................................... 2 1.3 Darstellungen innerhalb des Flächennutzungsplans.......................................... 3 2 Ausgangssituation und vorhandene Planungen ............................................... 3 2.1 Ausgangssituation ............................................................................................. 3 2.2 Bestehende örtliche und überörtliche Planungen .............................................. 3 2.3 Allgemeine Ziele des Flächennutzungsplans ..................................................... 6 3 Allgemeine Angaben ........................................................................................... 6 3.1 Lage und Größe des Planungsgebiets .............................................................. 6 3.2 Großräumige Verkehrslage ............................................................................... 7 4 Landschaft ........................................................................................................... 8 4.1 Naturräumliche Gliederung ............................................................................... -

Erlã¤Uterungen Zur Geologischen Specialkarte Des KöNigreichs
o,9;1;zed by Google SECTION FREIBERG. Section Freiberg gehört dem mittleren bis niederen Theile des Erzgebirges an und liegt im nordöstlichen Abschnitte der grossen Freiberger Gneisskuppel. In Uebereinst.immung mit der allgemeinen topographischen Gestaltung des Erzgebirges dacht sich das Gebiet der Section Freiberg ganz allmählich von SO. nach NW. ab; die höchsten Punkte liegen daher im 80.-Theile und erreichen eine Höhe von 470 m, während der niedrigste Punkt mit 260 m Meeres höhe durch den Austrittspunkt der Bobritzsch am Nordwestrande der Section bezeichnet wird. · Der bedeutendste Niveauunterschied im Sectionsgebiete beläuft sieh sonach auf 2io m; .das allgemeine Abfallen der Oberfläche nach Nordwest bin dagegen nur auf 100 m, die mittlere Höbe in der 80.-Ecke der Section zu 430 m, in der 1'"W.-Ecke zu 330 m angenommen; endlich das Gefälle der die Section von Süd nach Nordwest durchströmenden Bobritzsch auf 160 m. Die Terrainformen sind, wie im Erzgebirge überhaupt, vor wiegend flach wellig bis plateauartig; nur an den Gehängen der Haupt- und grossen Nebenthäler wird die Neigung der Oberfläche steiler und geht z. Th. in völlig senkrechte Abstürze über, so im Muldethale bei Muldener Hütten, gegenüber der Papierfabrik bei Halsbach, und besonders bei Halsbrücke-Sand; im Bobritzsch tbale oberhalb Naundorf, sowie unterhalb der Forstmühle bei Krummhennersdorf, und von da fast. ununterbrochen bis zur Sections grenze bei Biberstein; im Colmnitzgrunde zwischen Naundorf und Niedercolmnitz, endlich im Triebischthale bei Grund. Mit Ausnahme der die Nordostecke der Section entwässernden Triebisch mit dem Hetzbache, welche direct der Elbe zuftiessen, o,9;1;zed by Google 2 SECTION FREIBERG. werden alle kleineren und grösseren W asseradem der Section ent weder direct von der Mulde, welche den südwestlichen Theil durch strömt, oder von ihrem grössten rechtsseitigen Zuflusse, der die Mitte der Section durchschneidenden, bei Siebenlehn einmündenden Bobritzsch aufgenommen. -

Die Gemeinde Begrüßt Ihre Neuen Einwohner
Seite 1 Amts-ERSCHEINUNGSTAG: und Mitteilungsblatt 15.11.2012der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf 11. AUSGABEErscheinungstag: 15.11.2012 Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf mit den Ortsteilen Hilbersdorf, Naundorf, Niederbobritzsch, Oberbobritzsch und Sohra Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 03.12.2012 Die Gemeinde begrüßt ihre neuen Einwohner Am 24. Oktober 2012 fand die Feierstunde des Bürgermeisters für die Neugeborenen der Monate Mai – September und deren Eltern statt. Wir wünschen allen eine glückliche Zukunft. Impressum: Verantwortlich für den amtlichen Teil: Volker Haupt, Bürgermeister der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Katrin Gutwasser Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf · Hauptstraße 80 · 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf · Telefon: 037325 2380 · Fax: 037325 23823 Internetadresse: www.bobritzsch-hilbersdorf.de · E-Mail: [email protected] Druck: Druckerei Gebrüder Schütze GbR, 09429 Wolkenstein Seite 2 Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf Erscheinungstag: 15.11.2012 TOP: 08 Auswertung der Gemeinderatsitzung vom Beratung und Beschlussfassung zum Wappen der 23.Oktober 2012 Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf TOP: 04 Beschluss-Nr.: 87/10/2012 Protokollkontrolle und Bekanntgabe nicht öffentlich Der Gemeinderat nimmt den Entwurf des Wappens zur Kenntnis gefasster Beschlüsse und beauftragt den Bürgermeister, die Bevölkerung in die Gestal- tung des Wappens einzubeziehen. Beschluss-Nr.: 83/10/2012 Die Niederschrift des Gemeinderates Bobritzsch-Hilbersdorf vom Abstimmungsergebnis: 25. September 2012 wird bestätigt. Mitglieder gesamt: 29 Mitglieder anwesend: 22 Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 22 Mitglieder gesamt: 29 Nein-Stimmen: 00 Mitglieder anwesend: 22 Stimmenthaltungen: 00 Ja-Stimmen: 22 Nein-Stimmen: 00 TOP 09 Stimmenthaltungen: 00 Beratung und Beschlussfassung zum Verfahren zur Umbenennung von Straßen in der Gemeinde TOP: 05 Bobritzsch-Hilbersdorf Beratung und Beschlussfassung zur 1. -

Umweltbericht Gemäß § 2A Baugb Zum Flächennutzungsplan Der
Umweltbericht gemäß § 2a BauGB zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf Träger der Bauleitplanung: Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf Hauptstraße 80 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf Planung: Envipro Project GmbH & Co. KG Blasewitzer Straße 41 01307 Dresden Bearbeitung: Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur Christiane Rindt Bearbeitungsstand: 27. Juni 2019 Flächennutzungsplan der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf Umweltbericht - Stand 27.06.2019 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ............................................................................................................. 1 1.1 Anlass und Rechtsgrundlage ............................................................................. 1 1.2 Inhalt und Ziele des Flächennutzungsplans ....................................................... 2 1.3 Darstellung der Ziele des Umweltschutzes ........................................................ 4 2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen ................................ 6 2.1 Naturräumliche Einordnung ............................................................................... 6 2.2 Schutzgut Boden ............................................................................................... 7 2.3 Schutzgut Wasser ........................................................................................... 14 2.4 Schutzgut Klima .............................................................................................. 19 2.5 Schutzgut Arten und Biotope .......................................................................... -

Muldental Bei Freiberg Karte 113 114 Muldental Bei Freiberg
112 Muldental bei Freiberg Karte 113 114 Muldental bei Freiberg 1 Altväterbrücke 6 „Grabentour“ zwischen Krummen- hennersdorf und Reinsberg 2 Siebentes und Achtes Lichtloch des Rothschönberger Stollns 7 Schlösser Reinsberg und Bieberstein 3 Muldental von Halsbrücke bis 8 Viertes Lichtloch des Halsbach Rothschönberger Stollns 4 Alte Hüttengebäude in Mulden- 9 Klosterruine Altzella hütten 5 Ehemaliges Bergbaugebiet um Muldenhütten und Weißenborn Die Beschreibung der einzelnen Gebiete folgt ab Seite 124 Landschaft Bei Muldenhütten und im gesamten Norden des Gebietes durchströmt die Mulde vorwiegend enge Kerbsohlentäler, örtlich – wie bei Weißenborn und wechselnde von Halsbach bis Rothenfurth – auch breitere Sohlentäler. Dadurch zeich Talformen net sich dieser Flussabschnitt durch einen reizvollen Wechsel von Weitun gen und Verengungen aus. Markant sind an den Flussschleifen einerseits steile Prallhänge und andererseits flache Gleithänge ausgebildet. Jedoch wurden auch große Bereiche des Muldentales durch eine über Jahrhunderte andauernde Ablagerung von taubem Gestein, Hüttenschla cke, Schlämmsanden (zum Zweck der Erzabscheidung gemahlenes Ge stein) und anderen Abfallstoffen künstlich verengt. Das betrifft in besonde rem Maße die Abschnitte in der Nähe von Muldenhütten und Halsbrücke. Bergwerks- Größere Bergwerkshalden gibt es aber auch im Norden des Gebietes, vor halden allem bei Großschirma und Kleinvoigtsberg. Das natürlich anstehende Gestein ist fast überall Gneis, der in Flussnähe stellenwei se in Form offener Felsen sichtbar wird. Lediglich bei Obergruna stellt Glimmer schiefer das Oberflächengestein dar. Das gegenwärtige Vegetationsbild zeichnet sich durch einen relativ hohen Waldanteil an den Hängen beiderseits der Freiberger Mulde aus. Ferner nimmt Grünland einen Teil der Hänge ein. Das angrenzende, höher gelegene Hügelland wird vorrangig als Ackerland genutzt. Der nördlichste Teil Abb.: Gneisfelsen bei Halsbrücke mit Rau- des Gebietes gehört zum Landschafts haariger Nabelflechte (Umbilicaria hirsuta) schutzgebiet „Grabentour“. -
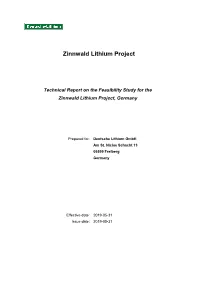
Zinnwald Lithium Project
Zinnwald Lithium Project Technical Report on the Feasibility Study for the Zinnwald Lithium Project, Germany Prepared for: Deutsche Lithium GmbH Am St. Niclas Schacht 13 09599 Freiberg Germany Effective date: 2019-05-31 Issue date: 2019-05-31 Zinnwald Lithium Project Technical Report on the Feasibility Study TABLE OF CONTENTS Page Date and Signature Page ............................................................................................................. 2 1 Summary ........................................................................................................................ 22 1.1 Property Description and Ownership ........................................................................ 22 1.2 Geology and Mineralization ...................................................................................... 22 1.3 Exploration Status .................................................................................................... 23 1.4 Resource Estimates ................................................................................................. 23 1.5 Reserve Estimates ................................................................................................... 25 1.6 Mining ...................................................................................................................... 26 1.7 Processing and Metallurgical Test Work .................................................................. 27 1.8 Recovery Methods .................................................................................................. -

Fischotterschutz Im Sächsisch-Tschechischen Grenzgebiet
Fischotterschutz im sächsisch-tschechischen Grenzgebiet Heike Bretfeld, Berit Künzelmann & Lukáš Poledník 1 Einleitung Der Fischotter (Lutra lutra), unsere größte heimische Marderart, besiedelt Land- und Wasserhabitate und gilt als Symbol einer naturnahen, lebendigen Flusslandschaft. Lange Zeit waren seine Bestände stark rückläufig, was auf die Bejagung als Pelzlieferant und Nahrungskonkurrent des Menschen sowie Eingriffe in seinen Lebensraum, z. B. durch Flussregulierungen und Verschmutzungen von Gewässern, zurückzuführen ist. In weiten Teilen Sachsens galt er zur Jahrtausendwende als vom Aussterben bedroht (Kategorie 1 der Roten Liste). Dank strenger Schutzbemühungen konnten in den letzten Jahrzehnten wieder positive Bestandsentwicklungen festgestellt werden. Heute wird der Fischotter als in seinem Bestand gefährdet eingestuft (Kategorie 3 der Roten Liste). Der Alttierbestand in Sachsen wird aktuell auf 400 bis 600 Tiere geschätzt (LFULG 2020). Das Hauptverbreitungsgebiet in Sachsen befindet sich in der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Abbildung 1: Fischotter (c) Jiri Bohdal 1 2 Das sächsisch–tschechische Kooperationsprojekt „Lutra lutra“ Da der Fischotter beidseits der deutsch-tschechischen Grenzregion an Fließgewässern vorkommt und von den Lebensbedingungen beider Länder abhängig ist, wurde im Oktober 2017 das sächsisch-tschechische Kooperationsprojekt "Lutra lutra" initiiert, bei dem das NABU-Naturschutzinstitut Region Dresden e. V. mit dem Verein ALKA Wildlife in Lidéřovice und dem Museum der Stadt Ústí nad Labem eng zusammenarbeitet. Das Projekt wird von der europäischen Union mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert. Übergeordnetes Ziel des Projektes ist die Analyse und Bewertung der Erkenntnisse zum Fischottervorkommen und zu seinen Lebensräumen im deutschen und tschechischen Projektgebiet, in Folge die Umsetzung geeigneter Maßnahmen zum Schutz des Otters und die damit einhergehende Stärkung grenzübergreifender Fischotterpopulationen. -

Amts- Und Mitteilungsblatt Der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf Mit Den Ortsteilen Hilbersdorf, Naundorf, Niederbobritzsch, Oberbobritzsch Und Sohra
Seite 1 Amts-ERSCHEINUNGSTAG: und Mitteilungsblatt 15.08.2013der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf 20. AUSGABEErscheinungstag: 15.08.2013 Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf mit den Ortsteilen Hilbersdorf, Naundorf, Niederbobritzsch, Oberbobritzsch und Sohra Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 05.09.2013 Besuch der Partnergemeinde Pilchowice 2013 Anlässlich des 130-jährigen Bestehens der Freiwil- ligen Feuerwehr Pilchowice und des 110-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Zernica wurden der Bürgermeister sowie Vertreter des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung in unsere Partnergemeinde eingeladen. Unsere Reisgruppe wurde von 15 Mitgliedern der Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Nieder- bobritzsch und dem stellvertretenden Gemeinde- wehrleiter, Gerd Kaufmann, begleitet. Bei unserer Ankunft in Pilchowice wurden wir auf traditionelle Weise von Kindern mit Brot und Salz begrüßt. Während unseres Aufenthaltes gab es Treffen mit den Wehrleitungen der Jubiläumswehren sowie eine Konferenz der Gemeinderatsmitglieder und der Verwaltungsmitarbeiter unserer Gemeinden. Dabei wurden Punkte über die weitere Zusammen- arbeit besprochen. Eine besonders große Freude bereitete unseren Gastgebern die Feuerwehrkapelle mit ihrem musikalischen Repertoire und ihren spontanen Auftritten. Einen großen Eindruck hinterließ der gemeinsame Auftritt des „Gemischten Chores der deutschen Minderheit aus Pilchowice“ und unserer Feuerwehrkapelle. Seite 2 Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf Erscheinungstag: -

Im Überblick
Naturführer Wissenswertes aus der Landschaft zwischen Wilisch und Ost-Erzgebirge Wieselstein, spannende Einblicke in die Erdgeschichte des Erzgebirges, Begeisterung für Biotopvielfalt – dies will die Band Grüne Liga Osterzgebirge Naturinteressierten vermitteln. 2 Das Buch beinhaltet: • Klima • Geologie • Gebietsüberblick Böden • Landschaftsgeschichte • Wälder • Moore • Steinrücken • Wiesen und Weiden • Mit Sensen umgehen und Moorpfl anzen kennen lernen, Tierwelt • Übersichten kleine Weißtannen schützen und im Botanischen Garten mithelfen – beim alljährlichen Schellerhauer Naturschutzpraktikum im Überblick versucht die Grüne Liga Osterzgebirge, einen Eindruck von der Vielfalt praktischen Naturschutzes zu vermitteln. Natur Natur Auf Exkursionen werden außerdem die Landschaft, ihre interessante Naturgeschichte und aktuelle ökologische Probleme erklärt. Das einwöchige Praktikum fi ndet immer im Spätsommer statt. Informationen und Anmeldungen: www.grueneliga-osterzgebirge.de, Tel. 0 35 04 - 61 85 85 Als Ergänzung zu diesem Buch sind erhältlich: Band 1 Pfl anzen und Tiere des Ost-Erzgebirges Natur des Ost-Erzgebirges ISBN 978-3-940319-16-6 Band 3 Naturkundliche Wanderziele im Ost-Erzgebirge Sandstein Verlag • Band 2 Natur des Ost-Erzgebirges im Überblick ISBN 978-3-940319-18-0 im Überblick ISBN 978-3-940319-17-3 Naturführer Ost-Erzgebirge – Naturführer Ost-Erzgebirge Band 2 Natur des Ost-Erzgebirges im Überblick Sandstein Verlag • Dresden 3 Inhalt Vorwort 4 Vorstellung Umweltvereine 6 Region der Kontraste – Ein Gebietsüberblick 10 Wetter, Witterung -
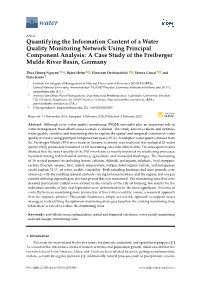
Quantifying the Information Content of a Water Quality Monitoring Network
water Article Quantifying the Information Content of a Water Quality Monitoring Network Using Principal Component Analysis: A Case Study of the Freiberger Mulde River Basin, Germany Thuy Hoang Nguyen 1,2,*, Björn Helm 2 , Hiroshan Hettiarachchi 1 , Serena Caucci 1 and Peter Krebs 2 1 Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources (UNU-FLORES), United Nations University, Ammonstrasse 74, 01067 Dresden, Germany; [email protected] (H.H.); [email protected] (S.C.) 2 Institute for Urban Water Management, Department of Hydrosciences, Technische Universität Dresden (TU Dresden), Bergstrasse 66, 01069 Dresden, Germany; [email protected] (B.H.); [email protected] (P.K.) * Correspondence: [email protected]; Tel.: +49-35189219370 Received: 11 November 2019; Accepted: 3 February 2020; Published: 5 February 2020 Abstract: Although river water quality monitoring (WQM) networks play an important role in water management, their effectiveness is rarely evaluated. This study aims to evaluate and optimize water quality variables and monitoring sites to explain the spatial and temporal variation of water quality in rivers, using principal component analysis (PCA). A complex water quality dataset from the Freiberger Mulde (FM) river basin in Saxony, Germany was analyzed that included 23 water quality (WQ) parameters monitored at 151 monitoring sites from 2006 to 2016. The subsequent results showed that the water quality of the FM river basin is mainly impacted by weathering processes, historical mining and industrial activities, agriculture, and municipal discharges. The monitoring of 14 critical parameters including boron, calcium, chloride, potassium, sulphate, total inorganic carbon, fluoride, arsenic, zinc, nickel, temperature, oxygen, total organic carbon, and manganese could explain 75.1% of water quality variability.