Blickpunkt Libanon
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Changing Security:Theoretical and Practical Discussions
Durham E-Theses Changing Security:Theoretical and Practical Discussions. The Case of Lebanon. SMAIRA, DIMA How to cite: SMAIRA, DIMA (2014) Changing Security:Theoretical and Practical Discussions. The Case of Lebanon. , Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/10810/ Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in Durham E-Theses • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full Durham E-Theses policy for further details. Academic Support Oce, Durham University, University Oce, Old Elvet, Durham DH1 3HP e-mail: [email protected] Tel: +44 0191 334 6107 http://etheses.dur.ac.uk 2 Changing Security: Theoretical and Practical Discussions. The Case of Lebanon. Dima Smaira Thesis submitted in fulfilment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy in International Relations. School of Government and International Affairs Durham University 2014 i Abstract This study is concerned with security; particularly security in Lebanon. It is also equally concerned with various means to improve security. Building on debates at the heart of world politics and Security Studies, this study first discusses trends in global governance, in the study of security, and in security assistance to post-conflict or developing countries. -

The Effect of Syrian Crisis on Lebanon Foreign Policy
T.R. ULUDAĞ UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES COURSE OF INTERNATIONAL RELATIONS POST-ARAB SPRING IN MIDDLE EAST REGION: THE EFFECT OF SYRIAN CRISIS ON LEBANON FOREIGN POLICY (MASTER DEGREE THESIS) Maria Helena MOTA ESTEVES Supervisor: Prof. Dr. Tayyar ARI BURSA 2018 T.R. ULUDAĞ UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES COURSE OF INTERNATIONAL RELATIONS POST-ARAB SPRING IN MIDDLE EAST REGION: THE EFFECT OF SYRIAN CRISIS ON LEBANON FOREIGN POLICY (MASTER DEGREE THESIS) Maria Helena MOTA ESTEVES Supervisor: Prof. Dr. Tayyar ARI BURSA-2018 ABSTRACT Name and Surname : Maria Helena Mota Esteves University : Uludağ University Institution : Institute of Social Sciences Field : International Relations Branch : International Relations Degree Awarded : Master Thesis Page Number : xviii+152 Degree Date : …. /…. /2018 Supervisor : Prof. Dr. Tayyar ARI POST-ARAB SPRING IN MIDDLE EAST REGION: THE EFFECT OF SYRIAN CRISIS ON LEBANON FOREIGN POLICY This study focuses on the Lebanon position in the aftermath of Syrian conflict, including the main aspects of Lebanese Foreign Policy. It includes regional and foreign interference in Lebanese affairs that intentionally led to the instable situation in the country. Briefly includes Domestic/foreign factors longstanding by geopolitical aspects that determine Lebanon political vacuum and current sectarian division. Moreover, Refugee crisis and sectarian challenges aggravated the Lebanese crisis, since they are a consequence of Syrian conflict, our case of study. The thesis is divided in three main chapters. Firstly, the analysis of both Realism and Liberalism under the Security concept in the main theories of I.R,. From defining the security studies framework that impacted the definition of security in World politics, the conceptualization of security and securitization theory is analysed. -

Jerusalem: Facts and Trends 2005/2006
The Jerusalem Institute for Israel Studies Founded by the Charles H. Revson Foundation Jerusalem: Facts and Trends 2005/2006 Maya Choshen, Michal Korach 2008 Jerusalem: Facts and Trends 2005/2006 Maya Choshen Michal Korach This publication has been produced with the support of the Charles H. Revson Foundation of New York and the Pratt Foundation. The statements made and the views expressed in this document reflect solely the opinions of its authors. Translation from Hebrew: Laura Wharton © 2008, The Jerusalem Institute for Israel Studies The Hay Elyachar House 20 Radak St., 92186 Jerusalem http://www.jiis.org.il - Table of Contents - About the Authors .............................................................................................. 7 Preface ................................................................................................................. 9 Area ....................................................................................................................11 Population ..........................................................................................................11 Population Size ...................................................................................................11 The Legal Status of the Arab Population ........................................................... 12 The Geographical Distribution of the Population .............................................. 13 Population Growth ............................................................................................. 14 Sources -

Jewish Communal Affairs
Jewish Communal Affairs American Jews and the Middle East ISRAEL, IRAN, IRAQ In December 2006, AJC issued a pamphlet, 'Progressive' Jewish Thought and the New Anti-Semitism, by Prof. Alvin Rosenfeld of Indi- ana University, which pointed to specific examples of left-of-center Jew- ish critics of Israel who went so far as to question the right of the Jewish state to exist, a position that Rosenfeld considered anti-Semitic. Few knew of the publication until an article about it appeared in the New York Times on January 31, 2007, and then it became a focus of public dispute. A number of discrete issues were debated back and forth, such as in- accuracies in the Times characterization of AJC and of Rosenfeld's the- sis, whether Rosenfeld had erred in lumping together friendly critics of Israel with virulent foes, and whether, as some critics alleged, his real agenda was to push an alleged Jewish neoconservative alliance with the Bush administration and Christian conservatives in support of the Iraq war. The most serious charge was that 'Progressive' Jewish Thought was meant to censor all liberal criticism of Israel by tarnishing it with the label of anti-Semitism. Rosenfeld countered that he could not see how point- ing out the anti-Semitic implications of those who wanted Israel dis- mantled amounted to censorship, and suggested that those making the charge were themselves engaging in censorship by seeking to silence Is- rael's defenders. As 2007 began American Jewish groups were focused on a potentially nuclear Iran whose president made no secret of his intention to destroy Israel. -

Russia in Syria and the Implications for Israel Israel's Imagined
Volume 19 | No. 2 | July 2016 Russia in Syria and the Implications for Israel Amos Yadlin Israel’s Imagined Role in the Syrian Civil War Tha‘er al-Nashef and Ofir Winter Will Russia and Iran Walk Hand in Hand? Ephraim Kam Changes in Hezbollah’s Identity and Fundamental Worldview Roman Levi No Magic Solution: The Effectiveness of Deporting Terrorists as a Counterterrorism Policy Measure Adam Hoffman A Troubling Correlation: The Ongoing Economic Deterioration in East Jerusalem and the Current Wave of Terror Amit Efrati Troubles in Paradise: The New Arab Leadership in Israel and the Challenges of the Hour Doron Matza, Meir Elran, and Mohammed Abo Nasra Selective Engagement: China’s Middle East Policy after the Arab Spring Wang Jin China and Turkey: Closer Relations Mixed with Suspicion Galia Lavi and Gallia Lindenstrauss Israel and the International Criminal Court: A Legal Battlefield Bar Levy and Shir Rozenzweig Israel’s Second War Doctrine Ron Tira Strategic ASSESSMENT Volume 19 | No. 2 | July 2016 CONTENTS Abstracts | 3 Russia in Syria and the Implications for Israel | 9 Amos Yadlin Israel’s Imagined Role in the Syrian Civil War | 27 Tha‘er al-Nashef and Ofir Winter Will Russia and Iran Walk Hand in Hand? | 41 Ephraim Kam Changes in Hezbollah’s Identity and Fundamental Worldview | 53 Roman Levi No Magic Solution: The Effectiveness of Deporting Terrorists as a Counterterrorism Policy Measure | 67 Adam Hoffman A Troubling Correlation: The Ongoing Economic Deterioration in East Jerusalem and the Current Wave of Terror | 81 Amit Efrati Troubles -

War and Pride: “Out Against the Occupation” and Queer Responses to the 2006 Lebanon War
War and Pride: “Out Against the Occupation” and Queer Responses to the 2006 Lebanon War Natalie Kouri-Towe Department of Art History and Communication Studies McGill University, Montreal August 2008 A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of Master of Arts in Communication Studies © Natalie Kouri-Towe 2008 ABSTRACT In this thesis, I examine the role of queerness, solidarity and movement in anti-war activism relating to the 2006 Lebanon War. I investigate two events called “Out Against the Occupation” that were organized during the summer of 2006 in response to the war. These events emerged as a queer response to the context of various gay pride events held throughout the war that failed to develop an anti-war response to the war in Lebanon. These gay pride events include the Divers/Cité festival held annually in Montreal, the first World OutGames held in Montreal, the World Pride events held in Jerusalem and the Queeruption gathering held in Tel Aviv. I argue that we must rethink the role of movement, queerness and solidarity in order to understand how movements of resistance emerge. I do so by examining the role of subjectivity in how we come to move and orient ourselves towards others. RESUME Dans ce mémoire, j'examine le role de la sexualité queer, la solidarité et le movement dans les mobilisations contre le conflit israélo-libanais de 2006. J'examine deux événements appelés “Out Against the Occupation,” organisés durant l'été de 2006 en reaction à la guerre. Ces événements émergaient d'une réaction allosexuelle au contexte de plusieurs événements se rapportant à la fierté gaie qui ont été organisés durant la guerre au Liban. -
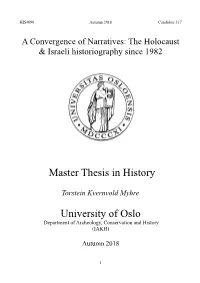
Master Thesis in History University of Oslo
HIS4090 Autumn 2018 Candidate 317 A Convergence of Narratives: The Holocaust & Israeli historiography since 1982 Master Thesis in History Torstein Kvernvold Myhre University of Oslo Department of Archeology, Conservation and History (IAKH) Autumn 2018 1 HIS4090 Autumn 2018 Candidate 317 Acknowledgements I would like to thank the faculty at IAKH at the University of Oslo, and in particular my supervisor Douglas Rossinow for giving me invaluable feedback at critical stages during the writing of this thesis from January 2017 to November 2018. His guidance has been crucial in helping me do research that made this paper possible. My fellow students at UiO have contributed greatly to stirring some of the journey this writing process has taken me through. My dear father has also continued to give me crucial guidance in the art of argumentation. I would also like to thank mr. Norman Finkelstein for indulding in a personal correspondence with me, both in person and in writing. His answers to questions have greatly contributed to helping me place this thesis in a political-ideological context. I would lastly give a dearest thank you to my dearest Kristine, for her unrelenting patience on my behalf. 2 HIS4090 Autumn 2018 Candidate 317 Abstract This master thesis is a historiographic analysis of how the Holocaust has been utilized to strengthen and legitimize Israel as a Jewish state, and how this push has shaped academic, cultural and political discourse on the Israeli/Palestinian conflict since 1983. By analysis of secondary literature on Israel's relationship to the Holocaust, this thesis will explore how perceived links between the two play a key role in the shaping of academic and political discourse on the Israeli/Palestinian conflict. -

15-8 the Situation in the Middle East 11 February 2009 Advance
Advance version 11 February 2009 The situation in the Middle East Table of Contents A. United Nations Disengagement Observer Force B. United Nations Interim Force in Lebanon and developments in the Israel- Lebanon sector C. Security Council resolution 1559 (2004) D. Security Council resolution 1595 (2005) E. The report of the Secretary-General on the Middle East A. United Nations Disengagement Observer Force Decisions of June 2004 – December 2007: eight resolutions and eight statements by the President At each of its 4998th, 5101st , 5205th, 5339th, 5456th, 5596th, 5698th, and 5802nd meetings,1 the Security Council adopted unanimously without a debate a resolution extending the mandate of the United Nations Disengagement Observations Force (UNDOF) for periods of six months on the basis of the reports of the Secretary-General.2 In his reports, the Secretary-General observed that the situation in the Israel-Syria sector had remained generally quiet. He noted that between 12 July and 14 August 2006, rockets originating from the area of the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) had hit close to UNDOF positions in the Shab’a area.3 In general, UNDOF continued to perform its role as supervisor of the ceasefire between the Syrian and Israeli 1 Held on 29 June 2004, 15 December 2004, 17 June 2005, 21 December 2005, 13 June 2006, 15 December 2006, 20 June 2007, and 14 December 2007, respectively. During this period in addition to these meetings, the Council also held a number of meetings with the troop-contributing countries to the United Nations Disengagement Observer Force in private, pursuant to annex II, sections A and B of resolution 1353 (2001). -

The Hariri Assassination and the Making of a Usable Past for Lebanon
LOCKED IN TIME ?: THE HARIRI ASSASSINATION AND THE MAKING OF A USABLE PAST FOR LEBANON Jonathan Herny van Melle A Thesis Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS May 2009 Committee: Dr. Sridevi Menon, Advisor Dr. Neil A. Englehart ii ABSTRACT Dr. Sridevi Menon, Advisor Why is it that on one hand Lebanon is represented as the “Switzerland of the Middle East,” a progressive and prosperous country, and its capital Beirut as the “Paris of the Middle East,” while on the other hand, Lebanon and Beirut are represented as sites of violence, danger, and state failure? Furthermore, why is it that the latter representation is currently the pervasive image of Lebanon? This thesis examines these competing images of Lebanon by focusing on Lebanon’s past and the ways in which various “pasts” have been used to explain the realities confronting Lebanon. To understand the contexts that frame the two different representations of Lebanon I analyze several key periods and events in Lebanon’s history that have contributed to these representations. I examine the ways in which the representation of Lebanon and Beirut as sites of violence have been shaped by the long period of civil war (1975-1990) whereas an alternate image of a cosmopolitan Lebanon emerges during the period of reconstruction and economic revival as well as relative peace between 1990 and 2005. In juxtaposing the civil war and the assassination of former Lebanese Prime Minister Rafic Hariri in Beirut on February 14, 2005, I point to the resilience of Lebanon’s civil war past in shaping both Lebanese and Western memories and understandings of the Lebanese state. -

Gone with the Wind
WWW.TEHRANTIMES.COM I N T E R N A T I O N A L D A I L Y 8 Pages Price 50,000 Rials 1.00 EURO 4.00 AED 43rd year No.13949 Sunday MAY 23, 2021 Khordad 2, 1400 Shawwal 11, 1442 IRGC chief: Palestinian Iran’s Nahid Kiani Jask terminal ready to Operation al-Quds Sword a resistance leads to secures taekwondo receive crude oil from blow to those normalizing heroic epic Page 2 berth at Olympics Page 3 Gulf of Oman Page 4 ties with Israel Page 5 Leader says malicious Zionist regime will become even weaker TEHRAN— In a message to the Palestinian against occupation and injustice, fi- nation on Friday evening, Leader of the nally the Zionist regime agreed to an Islamic Revolution Ayatollah Ali Khamenei unconditional ceasefire. The ceasefire Gone with the wind congratulated the “powerful, oppressed brought a wave of joy and happiness to Palestine” for their victory against the the Palestinians, who poured into the Zionist regime in the 12-day war. streets showing V signs and waved flags. How Netanyahu botched the normalization hype In the 12-day war the Palestinian The following is the full text of the resistance groups succeeded to fire message posted on the khamenei.ir: missiles all across the lands occupied “In the Name of God, the Beneficent, by Israel. Failing to make resistance the Merciful groups to give in in their missile war Continued on page 2 Over 1,600km of freeways, highways to be inaugurated by Mar. 2022 TEHRAN – Iranian Deputy Transport and Ur- “Two of the mentioned projects were ban Development Minister Kheirollah Khademi put into operation in the previous year has said 440 kilometers (km) of freeways and and 221 kilometers of freeways were com- 1,200 km of highways will be added to the coun- pleted across the country,” he told IRIB. -

A Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University in Partial Fulfil
THE DAHIYEH DOCTRINE: THE CONDITIONS UNDER WHICH STATES CAN ESTABLISH ASYMMETRIC DETERRENCE A Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Government By Rafael D. Frankel, M.S. Washington, DC July 3, 2013 Copyright 2013 by Rafael D. Frankel All Rights Reserved ii THE DAHIYEH DOCTRINE: THE CONDITIONS UNDER WHICH STATES CAN ESTABLISH ASYMMETRIC DETERRENCE Rafael D. Frankel, M.S. Thesis Advisor: Daniel L. Byman, Ph.D. ABSTRACT For the last decade, a growing body of research has sough to understand how classical deterrence methods could be adapted by states to establish asymmetric deterrence against non-state militant groups. Various strategies were suggested, but the research undertaken to date focused nearly exclusively on the actions of the defending state. This research project is the first formal effort to discover under what conditions deterrence against such groups can be established by focusing on important attributes of the non-state groups themselves. The result is the development of the Asymmetric Deterrence Matrix (ADM), which in eight temporally-bound case studies involving Hamas and Hezbollah successfully predicts the level of deterrence Israel should have been able to achieve against those groups at given periods of time. This research demonstrates that there are four main causal factors related to a non-state group’s characteristics that constrain and encourage the success of asymmetric deterrence strategies by states: elements of statehood (territorial control, political authority, and responsibility for a dependent population), organizational structure, ideology, and inter- factional rivalries. -

The Spatial Model of Politics
The Spatial Model of Politics Norman Schoeld November 21, 2007 Contents 1 Introduction 1 1.1 Representative Democracy . 1 1.2 The Theory of Social Choice . 8 1.2.1 Restrictions on the Set of Alternatives . 13 1.2.2 Structural Stability of the Core . 18 2 Social Choice 21 2.1 Preference Relations. 21 2.2 Social Preference Functions. 24 2.3 Arrowian Impossibility Theorems . 29 2.4 Power and Rationality . 34 2.5 Choice Functions . 38 3 Voting Rules 45 3.1 Simple Binary Preference Functions . 45 3.2 Acyclic Voting Rules on Restricted Sets of Alternatives . 51 3.3 Manipulation of Choice Functions. 62 3.4 Restrictions on the Preferences of Society . 65 4 The Core 69 4.1 Existence of a Choice. 69 4.2 Existence of the Core in Low Dimension . 73 4.3 Smooth Preference . 79 4.3.1 Non-Convex Preference . 84 4.4 Local Cycles . 87 4.4.1 Necessary and Sufcient Conditions . 89 4.5 Appendix to Chapter 4. 94 5 The Heart 97 5.1 Symmetry Conditions at the Core . 97 5.2 Examples of the Heart and Uncovered Set . .112 iii iv Contents 5.3 Experimental Results . .115 6 A Spatial Model of Coalition 119 6.1 Empirical Analyses of Coalition Formation . .119 6.2 A Spatial Model of Legislative Bargaining . .126 6.3 The Core and the Heart of the Legislature. .132 6.3.1 Examples from Israel . .132 6.3.2 Examples from the Netherlands . .135 6.4 Typologies of Coalition Government . .141 6.4.1 Bipolar Systems .