Die Übergänge Am Untern Hauenstein
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Einzelrangliste Gewehr Sonntag, 26
Feldschiessen 2019 Olten-Gösgen Bezirksschützenverein Einzelrangliste Gewehr Sonntag, 26. Mai 2019 RangName JGVereinsnameAusz Kat AS Punkte 1 Bärtschi Johannes 1967 Dulliken Engelbergschützen AK KA E 70 2 Lenz René 1959 Boningen Militärschützen AK KA V 70 69 3 Borner Markus 1961 Boningen Militärschützen AK KA E 69 69 4 Wyss Edgar 1963 Boningen Militärschützen AK KA E 67 69 4 Wyss Matthias 1988 Boningen Militärschützen AK KA E 67 69 6 Borner Marco 1986 Boningen Militärschützen AK KA E 62 69 7 Bourquin Joël 1988 Obererlinsbach Schützengesellschaft AK KA E 69 7 Gmür Andreas 1997 Obergösgen Schützengesellschaft AK KA E 69 9 Schenker Edwin 1951 Walterswil SO Feldschützen AK KA V 68 9 Hodel Werner 1956 Hägendorf-Rickenbach Schützengesellschaft AK KA V 68 9 Wyss Markus 1957 Boningen Militärschützen AK KA V 68 9 Strobel Markus 1958 Schützengesellschaft Fulenbach-Kappel AK KA V 68 13 Munzinger Viktor 1963 Dulliken Engelbergschützen AK KA E 68 13 Müller Daniel 1964 Obergösgen Schützengesellschaft AK KA E 68 13 Egger Karin 1974 Wisen Schützengesellschaft AK KA E 68 13 Schmid André 1979 Niedererlinsbach Schützenbund AK KA E 68 13 Graber Matthias 1980 Wisen Schützengesellschaft AK KA E 68 13 Bader Thomas 1985 Hauenstein-Ifenthal Schützengesellschaft AK KA E 68 13 Zimmermann Patrick 1989 Hauenstein-Ifenthal Schützengesellschaft AK KA E 68 13 Lachmuth Lorenz 1993 Gunzgen Militärschützen AK KA E 68 21 Käser Bruno 1942 Niedererlinsbach Schützenbund AK KA SV 67 21 Mollet René 1948 Dulliken Engelbergschützen AK KA SV 67 23 Hodel Hans 1952 Hägendorf-Rickenbach -

Feldschiessen 2009 12
B C M Y Seite 12 OT 12 MZ Montag, 8. Juni 2009 FELDSCHIESSEN 2009 BEZIRKSSCHÜTZENVEREIN OLTEN-GÖSGEN SEKTIONSRANGLISTE Kurt Schaad (Lostorf). René Mollet (Dulliken). Fritz Bütiko- 61: Kevin Knechtli (Wangen b.Olten). Joel Wyss (Aar- gen). Alfred Studer (Fulenbach). Rudolf Keller (Fulen- Peier (Schönenwerd). Samuel Kropf (Aarau). Daniel Boningen Militärschützen 3/64.724/51 fer (Aarburg). Richard von Arx (Rothrist). Vreni Bürge burg). Sascha Bucher (Erlinsbach). Ruedi Wipfli (Olten). bach). Dominik Eng (Erlinsbach). Stefan Roth (Erlinsbach). Stucki (Erlinsbach). Rolf Messerli (Wangen b. O. ). Florian Olten Freier Schiessverein 4/64.250/28 (Obergösgen). Marcel Bürgi (Hauenstein). Erich Zaugg Ueli Gmür (Hauenstein). Peter Biedermann (Olten). Nico- Michel Lötscher (Boningen). Daniel Hagmann (Starr- Bürge (Erlinsbach). Roy Gallantry (Lenzburg). Matthias Olten Stadtschützen 3/64.211/78 (Winznau). Albert Illi (Erlinsbach). Alfred Plüss (Bonin- le Büttiker (Kappel). Lukas Ackermann (Wolfwil). Patrik kirch-Wil). Rafael Pfister (Erlinsbach). Benjamin Berger Gäumann (Wangen b. Olten). Michael Baumann (Obe- Wisen SG 2/63.800/69 gen). Werner Lenz (Fulenbach). Markus Wyss (Bonin- Zimmermann (Hauenstein). Thomas von Büren (Trimach). (Olten). Armin Looser (Wisen). Patrick Mugglin (Hägen- rentfelden). Daniela Teknik (Rietheim). Matthias von Arx Wangen b.Olten SG 2/62.854/79 gen). Markus Waltenspühl (Schossrued). Edgar Wildi Hans Buser (Erlinsbach). Edgar Wyss (Riehen). Ernst dorf). Christian Berger (Dulliken). Ramon Kämpfer (Däni- (Erlinsbach). Christian Wenger (Hauenstein). Stefan Bu- Hägendorf-Rickenbach SG 1/62.163/95 (Wangen b.O.). Daniel Wyss (Aarburg). Kurt Egger (Wisen Gubler (Kienberg). Josef Brügger (Wisen SO). Hansrudolf ken). Andeas Duringer (Winznau). Andreas Düringer ser (Erlinsbach). Christian Bättig (Olten). Rolf Reinmann Fulenbach SG 2/62.156/96 SO). -
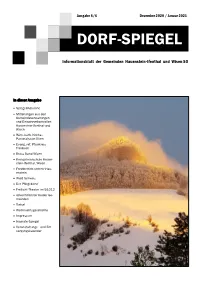
2020 Dezember
Ausgabe 6/6 Dezember 2020 / Januar 2021 DORF-SPIEGEL Informationsblatt der Gemeinden Hauenstein-Ifenthal und Wisen SO In dieser Ausgabe Spiegel-Kolumne Mitteilungen aus den Gemeindeverwaltungen und Einwohnerkontrollen Hauenstein-Ifenthal und Wisen Röm.-kath. Kirche - Pastoralraum Olten Evang. ref. Pfarrkreis Trimbach Brass Band Wisen Kreisprimarschule Hauen- stein-Ifenthal, Wisen Forstbetrieb unterer Hau- enstein Wald Schweiz Der Pflegeberuf Freilicht-Theater im SiLO12 Adventsfenster beider Ge- meinden Rätsel Weihnachtsgeschichte Impressum Inserate-Spiegel Veranstaltungs– und Ent- sorgungskalender Seite 2 DORF-SPIEGEL [email protected] Spiegel KOLUMNE unserer Söhne kennt wahnsinnig viele Leute. Und erinnert sich natürlich nicht an alle Namen. Dann geht er hin und fragt: “Du, ich habe deinen Namen vergessen, sorry, gäu.“ Der andere sagt zum Beispiel „Markus“. Unser Sohn: „Ja, das weiss ich schon, aber zum Geschlechtsnamen, meine ich.“ Wenn nun der Angesprochene Lisbeth Müller, Wisen „Huber“ sagt, bekommt er genau dieselbe Ant- wort, nur umgekehrt. Und somit weiss unser Sohn den ganzen Namen. Namen Bei unserer Heirat hat man automatisch den Na- Ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. Vor- men des Ehemannes angenommen. Annehmen namen gehen noch so durch, Familiennamen müssen. Da gab’s nichts zu diskutieren. Das (weshalb heissen die eigentlich würde ein Gnusch im Zuchtbuch geben, meinten „Geschlechtsnamen?“ Wegen allfälliger Adels- die Gegner der Beibehaltung des geschlechtern?) sind heikel. Ich kann sie mir ein- „Mädchennamens“ der Frauen. Schon Mädchen- fach nicht gut merken. Ich bin aber nicht allein name finde ich absurd. Ich war beileibe bei mei- auf weiter Flur, nein, ganz im Gegenteil, das ner Heirat kein Mädchen mehr. Von Gesetzes geht vielen von uns so. Bei den Gesichtern ist es wegen war ich ein „Fräulein“. -

Aktuelle Ausgabe
AZA 5012 Schönenwerd NUMMER 40 Donnerstag, 7. Oktober 2021 Däniken Dulliken Eppenberg-Wöschnau Erlinsbach AG Erlinsbach SO Gretzenbach Hauenstein-Ifenthal Kienberg Lostorf Niedergösgen Obergösgen Schönenwerd Starrkirch-Wil Stüsslingen Trimbach Walterswil Winznau Wisen Auflage 23 205 Exemplare • Niederämter Anzeiger • Bäckerstrasse 4 • 5012 Schönenwerd • Telefon 062 849 60 60 • Fax 062 849 37 84 • [email protected] • www.niederaemter-anzeiger.ch Bugmann, Müller & Partner AG Aarauerstrasse 102 Kia e-Niro 5015 Erlinsbach Elektrisierend und vollelektrisch Telefon 062 844 02 02 www.bmp-ag.ch pellets ab CHF 31’950.— * Abgebildetes Modell: Kia e-Niro Style (Elektromotor 64 kWh/Reichweite 455 km), CHF 45‘400.-**, Metallic- ITALIA-KERAMIK GmbH Lackierung CHF 600.- (inkl MwSt), 15,9 kWh/100 km, 0 g CO2/km***, Küchenkultur Energieeffizienzkategorie A. Verkauf von Wand- Kia Niro Hybrid 1.6 GDi Power, CHF 31‘950.-* 5,2 l/100 km, 119 g CO2/km***, mit Energieeffizienzkategorie A. und Bodenplatten * Electric-Prämie CHF 2‘500.- sowie Zusatzprämie für Hybridmodelle und Baumaterial Charakter. MY21 CHF 1‘000.- bereits abgezogen. ** Electric-Prämie CHF 2‘500.- sowie Äussere Kanalstrasse 41 Zusatzprämie für Plug-in Hybrid und Elektrofahrzeuge MY21 CHF 2‘000.- 5013 Niedergösgen bereits abgezogen. Angebot gültig bis 31.10.2021 oder solange Vorrat. Tel. 062 849 58 14 *** Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Neuwagen: 169 g CO2/km. E-Mail: [email protected] Zielwert 118 g CO2/km nach neuem Prüfzyklus WLTP. www.italia-keramik.ch Öffnungszeiten: Herzlich willkommen in unserer Ausstellung: Mo–Fr 07.15–12.00 Uhr Gösgerstrasse 29 Fax 062 844 48 23 Tel. 062 844 48 20 Mo bis Do 08.30–11.45 und 13.30–18.00 Uhr 13.15–17.30 Uhr www.dorf-garage.ch [email protected] Sa 08.00–12.00 Uhr Freitag 08.30–11.45 und 13.30–17.00 Uhr oder nach Vereinbarung IHR KIA-PARTNER IN DER REGION LMF Ingenieurbüro GmbH Bei uns fi ndet jede Figur Hauptstrasse 16 | 5013 Niedergösgen Hochbau - Zustandsaufnahmen - Erschütterungsmessungen die passende Hose. -

2019 Oktober-November
Ausgabe 5/6 Oktober / November 2019 DORF-SPIEGEL Informationsblatt der Gemeinden Hauenstein-Ifenthal und Wisen SO In dieser Ausgabe: · SpiegelKOLUMNE · Mitteilungen aus den Gemeindeverwaltungen und Einwohnerkontrollen Hauenstein-Ifenthal und Wisen · Mitteilungen beider Gemeinden · Evang. ref. Pfarrkreis Trimbach · Röm.-kath. Kirche - Pastoralraum Olten · Spielgruppe Wisen · Kreisprimarschule · Brass Band Wisen · Futurband Lagerkonzerte · Seniorenreise Wisen · Schützengesellschaft Hauenstein-Ifenthal · Erlös aus Kinderkleider- börse · Olgemar Zurita Vargas - Über Hotelgäste im Lift · 50 Jahre Skiriege Zeglingen · SpiegelINSERATE · Veranstaltungskalender Titelfoto: Fliegenpilz am Wisenberg Seite 2 DORF-SPIEGEL [email protected] SpiegelKOLUMNE Natürlich wurde Jakob für den vermeintlichen Frevel hart bestraft. Man sperrte ihn in die Toi- lette. Nur, Jakob sah den Grund der Strafe nicht ein. Er hatte ja nur visualisiert, was da gespro- chen worden war. Bildlich gezeigt, wie herrlich das tägliche Brötchen sein kann. Dazu kam, dass er ganz genau zugehört hatte. Sonst wäre es ihm Lisbeth Müller, ja mitnichten in den Sinn gekommen, dass er Wisen doch grad so ein tägliches Brot dabei hatte. Dem Jakob wurde fad in der Toilette. (Ich lese Zu wörtlich genommen gerade ein Buch von Otto Schenk, dem grossar- tigen Wiener Schauspieler und Regisseur, der Ich kenne Peter B., ein warmherziger, mir sym- mich mit seiner Bühnenpräsenz schon aus den pathischer Mann so zwischen 50 und 60, in Socken gehauen hat. Schenk schreibt „mir wur- Deutschland aufgewachsen, er lebt mit seiner de fad“, wenn etwas langweilig und uninteres- Freundin und zwei Katzen im Ruhrgebiet. Als sant war.) Jakob machte eine Feldstudie. Er ver- Kind sei Peter ein lieber Bub gewesen, habe sich stopfte alle Abflüsse mit Clopapier und Handtü- fürsorglich um seine kleine Schwester geküm- chern und öffnete im Gegenzug sämtliche Was- mert, sie bewacht, beschützt, geliebt. -

Nr. 21 Vom 21. Mai 2020
AZA 5012 Schönenwerd NUMMER 21 Donnerstag, 21. Mai 2020 Däniken Dulliken Eppenberg-Wöschnau Erlinsbach AG Erlinsbach SO Gretzenbach Hauenstein-Ifenthal Kienberg Lostorf Niedergösgen Obergösgen Rohr Schönenwerd Starrkirch-Wil Stüsslingen Trimbach Walterswil Winznau Wisen Auflage 22 917 Exemplare • Niederämter Anzeiger • Bäckerstrasse 4 • 5012 Schönenwerd • Telefon 062 849 60 60 • Fax 062 849 37 84 • [email protected] • www.niederaemter-anzeiger.ch Mehr Auto fürs Geld kia.ch Wir sind für Sie da und Ihren WOHNT AUM Auch in diesen Zeiten Ihr verlässlicher «Dank unserer Erfahrung sorgen wir für eine optimale Finanzierungs- Kia-Partner lösung und begleiten Sie mit Begeisterung zu Ihrem Wohntraum.» Unsere Werkstatt ist für Sie geöffnet. Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie gesund! Unsere Werk- statt ist für Sie geöffnet. BERATUNG SERVICE Wir freuen uns Wir beantworten Unsere Werkstatt gerne Ihre Fragen. ist weiter für Sie auf Sie. Bleiben Rufen Sie uns an oder geöffnet. Vereinbaren Sie gesund! mailen Sie uns. Sie jetzt Ihren Termin. Christian Hug Rosella Spielmann Alexandra Steiner Doris Steiner Verena Stamm Martin Fiechter REIFENWECHSEL HOL-/BRING-SERVICE PROBEFAHRTEN Zeit für Reifenwechsel, Wir holen Ihr Fahrzeug Vereinbaren Sie mit Felgenmontage auch zu Hause ab und uns eine kontaktlose oder Winterräder bringen es wieder zu Probefahrt mit den IHRE ANSPRECHPARTNER IN LOSTORF UND OBERGÖSGEN einlagern. Ihnen zurück. neuen Kia-Modellen. Raiffeisenbank Mittelgösgen-Staffelegg Gösgerstrasse 29 Fax 062 844 48 23 Tel. 062 844 48 20 raiffeisen.ch/mittelgoesgen-staffelegg | Tel. 062 285 88 88 www.dorf-garage.ch [email protected] IHR KIA-PARTNER IN DER REGION lic. iur. K. Stauffer Unsere Dienstleistungen für Ihre Zukunft: Rechtsanwalt und Notar Patientenverfügung, 5015 Erlinsbach SO Vorsorgeauftrag, Wülser Lostorf AG Telefon 062 844 09 10 Anordnungen für den www.wuelser-haustechnik.ch www.aarekanzlei.ch Todesfall, Nachlass regeln, Testament erstellen, Adressen aufbereiten, IT-Probleme? Willensvollstreckung, Hilfe bei Ihrer Büroarbeit. -

7 Protokoll SV 04.11.2020.Pdf
PROTOKOLL SYNODALVERSAMMLUNG Mittwoch, 4. November 2020 in der Rythalle in Solothurn Teilnehmer 59 Anwesende 53 Stimmberechtigte 6 ohne Stimmrecht Synodalrat Kurt von Arx, Präsident Vorsitz Urs Umbricht, Vizepräsident Theres Mathys-Manz Gaetano Serrago Susan von Sury Klaus Fischer entschuldigt Bischofsvikariat Georges Schwickerath mit beratender Stimme St. Verena Edith Rey Kühntopf mit beratender Stimme Kirchgemeinden (36) Solothurn Lebern: Bellach, Flumenthal-Hubersdorf, St. Niklaus Wasseramt: Aeschi, Biberist-Lohn-Ammannsegg-Bucheggberg, Derendingen, Kriegstetten-Gerlafingen, Luterbach Thal: Aedermannsdorf, Herbetswil, Holderbank, Laupersdorf, Matzendorf, Mümliswil, Ramiswil Gäu: Egerkingen, Härkingen, Kestenholz, Neuendorf, Niederbuchsiten, Oensingen, Wolfwil, Olten: Gretzenbach-Däniken, Gunzgen, Hägendorf-Rickenbach, Kappel-Boningen, Olten/Starrkirch-Wil, Walterswil, Wangen b. Olten Gösgen: Erlinsbach, Trimbach-Wisen Dorneck: Hochwald, Metzerlen-Mariastein Thierstein: Beinwil, Büsserach Entschuldigte KG (26) Bettlach, Grenchen, Oberdorf, Selzach, Deitingen, Subingen, Zuchwil, Balstahl, Welschenrohr-Gänsbrunnen, Oberbuchsiten, Dulliken, Fulenbach, Hauenstein-Ifenthal, Kienberg, Lostorf, Niedergösgen, Obergösgen, Winznau, Dornach, Hofstetten-Flüh, Nuglar-St. Pantaleon, Seewen, Bärschwil, Breitenbach, Grindel, Kleinlützel Abwesende KG (11) Günsberg, Schönenwerd, Stüsslingen-Rohr, Büren, Gempen, Rodersdorf, Witterswil-Bättwil, Erschwil, Himmelried, Meltingen, Oberkirch-Nunningen- Zullwil Protokoll Karin Burckhardt Dauer 19.00 bis 20.40 -

Verzeichnis Der Solothurnischen Gemeinden
131.3 Verzeichnis der solothurnischen Gemeinden Vom 28. Oktober 1997 (Stand 1. Januar 2018) Der Kantonsrat von Solothurn gestützt auf Artikel 47, 49, 51, 54 und 55 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986 nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 12. August 1997 beschliesst: 1. Einheitsgemeinden § 1 1 Im Kanton Solothurn bestehen folgende Einheitsgemeinden (vereinigte Einwohner- und Bürgergemeinden): a) Bezirk Lebern 1. Balm bei Günsberg 2. Kammersrohr 3.* Feldbrunnen-St. Niklaus 4.* Hubersdorf b) Bezirk Bucheggberg 1.* … 2.* Buchegg (inkl. Bürgergemeinde Kyburg-Buchegg) 3.* Messen (ohne Bürgergemeinde Alt Messen, Brunnenthal, Balm) c) Bezirk Thal 1. Gänsbrunnen 2.* Matzendorf 3.* Holderbank 4.* Herbetswil 5.* Aedermannsdorf d) Bezirk Thierstein 1. Meltingen 2.* Beinwil e) Bezirk Gösgen 1.* Stüsslingen 2.* Rohr 3.* Erlinsbach SO (ohne Bürgergemeinde Obererlinsbach) 4.* Kienberg GS 94, 269 1 131.3 f) Bezirk Dorneck 1.* Büren 2.* Seewen 3.* Metzerlen-Mariastein 4.* Bättwil 5.* Nuglar-St.Pantaleon 6.* Hofstetten-Flüh g)* Bezirk Wasseramt 1.* Drei Höfe (ohne Bürgergemeinde Winistorf) 2.* … 3.* … h)* Bezirk Gäu 1.* Oberbuchsiten i)* Bezirk Olten 1.* Rickenbach 2.* Fulenbach 2. Einwohnergemeinden § 2 1 Im Kanton Solothurn bestehen folgende Einwohnergemeinden: a) Bezirk Solothurn 1. Solothurn b) Bezirk Lebern 1. Bellach 2. Bettlach 3.* … 4. Flumenthal 5. Grenchen 6. Günsberg 7.* … 8. Langendorf 9. Lommiswil 10.* … 11. Oberdorf 12. Riedholz 13. Rüttenen 14. Selzach c) Bezirk Bucheggberg 1.* … 2.* … 3.* … 4.* … 5. Biezwil 2 131.3 6.* … 7.* … 8.* … 9.* … 10.* … 11.* … 12.* Lüsslingen-Nennigkofen 13 Lüterkofen-Ichertswil 14. Lüterswil-Gächliwil 15.* … 16.* … 17.* … 18. Schnottwil 19.* … 20. Unterramsern d) Bezirk Wasseramt 1. Aeschi 2. -
März 2020 DORF-SPIEGEL
Ausgabe 1/6 Februar/März 2020 DORF-SPIEGEL Informationsblatt der Gemeinden Hauenstein-Ifenthal und Wisen SO In dieser Ausgabe Spiegel-Kolumne Impressum Mitteilungen aus den Gemeindeverwaltungen und Einwohnerkontrollen Hauenstein-Ifenthal und Wisen Evang. ref. Pfarrkreis Trimbach Röm.-kath. Kirche - Pastoralraum Olten Kirchengemeinde Ifenthal- Hauenstein Wasserproben Schützengesellachaft Hauenstein-Ifenthal Jungschützenkurs 2020 Brass Band Wisen Futur Band Jodlerchörli Stärne 5! Kreisprimarschule Hauen- stein-Ifenthal, Wisen Frauenturnen Wisen s Hauesteiner-Lied Ifenthaler Weihnachtsidylle Jassturnier Hauenstein- Ifenthal Inserate-Spiegel Veranstaltungskalender Seite 2 DORF-SPIEGEL [email protected] Spiegel KOLUMNE anhin der Meinung, bei einem Jubiläum würden Erfolge gefeiert und nicht Schwachstellen her- vorgehoben. Ich bin wohl ein einfaches Gemüt, das sich hin und wieder ohne Wenn und Aber schlicht freuen Lisbeth Müller, Wisen kann. Allerdings hätte ich ein paar Ideen zur Weiterentwicklung des Fernsehapparats. Der Fernseh Apparat, 1) Man könnte die Taste zum Ausschalten gross und knallrot machen, damit die Unzufriedenen so heisst das Ding. Der Fernseher sind nämlich die Ausschaltvorrichtung auch gäbig finden. Sie. Oder die Fernseherin. „Habt ihr einen so alten Fernseher?“ wurde ich 2) Eine Kamera, auf den Zuschauer gerichtet, kürzlich gefragt. Stimmt. Mein Mann, der gele- wäre nicht ohne. Diese Kamera könnte beim gentliche Fernseher ist alt. Und der Fernsehappa- dritten Gähnen oder Gopf . .den Apparat aus- rat auch. Ich habe jedoch keinen Grund, weder schalten. den einen noch den andern umzutauschen oder zu ersetzen. 3) Bei allfälligem Einschlafen des Zuschauers müsste automatisch Vorschlag Nr. 2 in Kraft Bei Google kommt unter „Fernseher“ treten. Fernseher ansehen Fernseher kaufen 4) Der Apparat sollte beim automatischen Aus- Preisvergleich Fernseher schalten ein Beschwerde Formular ausspucken. -
Target Areas, Products and Prices 2018 Effective Advertising – Analog, Digital, Interactive Main News at a Glance
Edition: August 2017 Update (prices, location, etc.): see website Pocket Planner Target areas, products and prices 2018 Effective advertising – analog, digital, interactive Main news at a glance National digital networks Allstar ePanel CH High-impact package with over 420 ePanel sites in Switzerland and footfall of over 16 million passers-by per week. (Pages 134–135) City & Rail ePanel CH Coverage of the 6 largest cities and 14 key railway stations with all Rail, City and Escalator ePanel. Plus footfall of over 15 million passers-by per week (Pages 134–135) City & Rail eBoard / Beamer CH National network for moving image communication in conventional 16:9 TV format and footfall of over 10 million passers-by per week. (Page 139) Local digital networks City ePanel Basel Two new City ePanel networks in Basel with a total of 28 advertising boards in the city center. (Pages 134–135) Rail ePanel Lugano Expansion of the digital offering in Ticino. Now in portrait format too. (Pages 136–137) Rail eBoard St. Gallen New 9m2 GA eBoard in St. Gallen´s completely refurbished station. (Page 139) Shopping ePanel 2 new shopping centers in the portfolio: Mall of Switzerland in Ebikon and Sonnenhof in Rapperswil. (Pages 134–135) 2 Segments APG|SGA Traffic TrafficMediaScreen new part of the offering for BERNMOBIL. (Pages 163–164) APG|SGA Interaction The intelligent connection between Out of Home and Mobile Media with new booking options. (Page 153) APG|SGA Mountain Swiss-wide expansion of the popular PylonPoster for the winter season 2017/2018. (Page 156) APG|SGA Mega Poster Gradual expansion of BrandingWall in Zürich and Genève. -

Bericht Und Antrag Des Stadtrates an Das Gemeindeparlament
BERICHT UND ANTRAG DES STADTRATES AN DAS GEMEINDEPARLAMENT Fusionsvorvertrag mit Trimbach, Hauenstein-Ifenthal und Wisen/Genehmigung Nachdem die Gemeinden Trimbach, Hauenstein-Ifenthal und Wisen dem vorlie- genden Fusionsvorvertrag bereits zugestimmt haben, hat nun das Gemeindepar- lament der Stadt Olten darüber zu befinden, ob den vier Gemeindeexekutiven der Auftrag erteilt wird, einen detaillierten Fusionsvertrag auszuarbeiten. Der Fusi- ons-Vorvertrag enthält keinerlei Verpflichtungen für eine Fusion; das letzte Wort werden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der beteiligten Gemeinden vor- aussichtlich im Herbst 2011 an der Urne haben. Sehr geehrter Herr Präsident Sehr geehrte Damen und Herren Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Bericht und Antrag: 1. Ausgangslage 1.1 Bisherige Situation Die Thematik überkommunale Zusammenarbeit ist nicht neu für die Stadt Olten: Schon seit Jahren setzt die Stadt Olten auf die Kooperation auf verschiedenen Gebieten mit ihren Nachbargemeinden und weiteren Kommunen der Region. Diese betrifft u.a. folgende Gebiete: Regionale Zivilschutzorganisation (mit Starrkirch-Wil seit ca. 35 Jahren, zusätz- lich mit Wangen seit 2001, mit insgesamt neun Regionsgemeinden seit 2003) Regionaler Führungsstab (mit Starrkirch-Wil seit 1982, mit Wangen seit 2001, mit insgesamt neun Regionsgemeinden seit 2004) Stützpunkt-Feuerwehr Vereinbarung über die Zusammenarbeit und Kompetenzabgrenzung zwischen Polizei Kanton Solothurn und den Stadtpolizeien Pensionskasse (20 Anschlusskörperschaften, u.a. Trimbach, Niedergösgen, -

Ausgabe 2 /2015 39. Jahrgang
Ausgabe 2 / 2015 39. Jahrgang ÖFFENTLICHE STELLEN UND KOMMISSIONEN NICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ANGESCHLOSSEN: Gemeindeverwaltung, Oltnerstrasse 9, Postfach, 4652 Winznau Tel.-Nr.: 062 295 44 88 Fax-Nr.: 062 295 09 70 AHV-Zweigstelle Sozialregion Stadthaus Olten 062 206 12 25 E-Mail: [email protected] Arbeitsamt RAV Olten 062 311 29 60 Baukommission Dietschi Gabriella 079 725 13 86 - Gemeindepräsidium - Einwohnerkontrolle bfu-Sicherheitsdelegierter Reist Harry 079 402 05 52 - Finanzverwaltung - Bestattungswesen Brunnenmeister von Felten Christoph 062 295 07 13 - Gemeindesteuerbezugsamt - Stimmregisterführung Bürgergemeindepräsident Tscharland Iwan 062 295 48 15 - Kriegswirtschaftliche Zentralstelle Dorfchronist Brunner Hans 062 295 48 21 Erhebungsverantw. Landwirtsch. von Felten Peter 062 295 30 35 Schalterstunden der Verwaltung: Feuerwehrkommandant Baltermi Markus 079 445 02 55 Montag bis Mittwoch und Freitag 10.00 - 12.00 Uhr / 14.00 - 16.00 Uhr Friedensrichter Fischer Marcel 076 568 05 04 Donnerstag: 17.00 - 20.00 Uhr Gemeindepräsident Gubler Daniel 062 295 43 74 Gemeinde-Vize-Präsidentin Rutschi Herren Verena 062 295 33 66 Weitere wichtige Telefonnummern: Gemeindearbeiter Stähli Philipp 079 483 70 21 Gemeindeschreiberin Näf Anja 062 295 44 88 Arztpraxis Kehrichtabfuhr Grob Hans 062 295 31 18 Dres. med. F. und J. Husi, Dorfzentrum Chärne 062 295 53 33 Planungskommission Viehweg Reto 079 364 47 14 Privat 062 295 53 35 Pilzkontrolle, Dulliken Kammer Uschi 062 293 37 18 Räbeblatt Redaktion: Stoll Gisela 062 295 01 18 Pfarrämter Gestaltung: Näf Anja 062 295 44 88 - Röm.-kath. Pfarramt, Winznau 062 295 39 28 Rechnungsprüfungskommission Lanni Costantino 062 295 24 04 - Evang.-ref. Pfarramt, Trimbach 062 293 32 42 Schulhauswart Düringer Christian 079 752 33 23 - Christkath.