Regionalplan Für Den Regierungsbezirk Arnsberg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
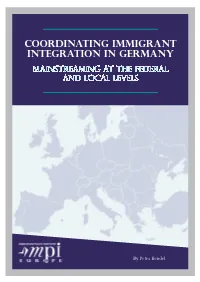
Coordinating Immigrant Integration in Germany Mainstreaming at the Federal and Local Levels
coordinating immigrant integration in germany mainstreaming at the federal and local levels By Petra Bendel MIGRATION POLICY INSTITUTE EUROPE Coordinating immigrant integration in Germany Mainstreaming at the federal and local levels By Petra Bendel August 2014 ACKNOWLEDGMENTS The author is particularly grateful for the assistance of Sabine Klotz and Christine Scharf in research and useful critiques. She would also like to thank all her interview partners in the different ministeries and agencies at the federal and state levels as well as local administrations for their frankness and for providing useful material on ‘best practices’. This report, part of a research project supported by the Kingdom of the Netherlands, is one of four country reports on mainstreaming: Denmark, France, Germany, and the United Kingdom. MPI Europe thanks key partners in this research project, Peter Scholten from Erasmus University and Ben Gidley from Compas, Oxford University. © 2014 Migration Policy Institute Europe. All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopy, or any information storage and retrieval system, without permission from MPI Europe. A full-text PDF of this document is available for free download from www.mpieurope.org. Information for reproducing excerpts from this report can be found at www.migrationpolicy.org/about/copyright-policy. Inquiries can also be directed to [email protected]. Suggested citation: Bendel, Petra. 2014. Coordinating immigrant integration in Germany: Mainstreaming at the federal and local levels. Brussels: Migration Policy Institute Europe. TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY ........................................................1 I. INTRODUCTION: THE CONTEXT OF IMMIGRATION AND INTEGRATION IN GERMANY ...........................................2 II. -

Stieglitz Vogel Des Jahres 2016
+ NABU-Kindergruppe + Streuobstwiesen + NSG ElberndorfNSG + Streuobstwiesen + NABU-Kindergruppe + + Bergfinken + Naturschutz den für Ziegen Bachtal + Zinser Oberes u. Natur Einladung zur NABU-MITGLIEDERVERSAMMLUNG auf Seite 9 ein unterschätztes Umweltproblem unterschätztes ein – Stickstoffdüngung in Siegen-Wittgenstein Vogel des Jahres 2016 Jahres des Vogel und Für MenschundNatur Für Stieglitz Umwelt Jahrgang 24·Heft2016 2 INHALT Natur und Umwelt in Siegen-Wittgenstein Der Stieglitz (Distelfink) 3 Liebe Leserinnen und Leser, – Vogel des Jahres 2016 „Im Märzen der Bauer…“ - das alte Volkslied erzählt vom mühseligen herrichten des Ackers Stickstoffdüngung 5 am Jahresanfang. Auch düngen gehört dazu. Den scharfen Geruch, der heute von frisch – ein unterschätztes Umweltproblem gedüngten Wiesen und Äckern aufsteigt, kennen wir wohl alle - und der hat nichts mehr mit Bauernromantik zu tun. Im Gegenteil: in den vergangenen Jahrzehnten hat sich hier Nabu intern 7 ein neues, großes Umweltproblem aufgebaut: die Überdüngung - nicht nur der Äcker und Wiesen, sondern aller Böden in Deutschland. Wir gehen in dieser Ausgabe näher darauf ein. Die NABU-Kindergruppe in Siegen 7 Erneut ist es ein besonders farbenfroher Vertreter, der zum Vogel des Jahres 2016 gekürt NABU-Buchprojekt „Die Vögel des Siegerlandes“ 8 wurde: der Stieglitz, auch als Distelfink bekannt. Wir stellen euch den bunten Gefiederten in dieser Ausgabe näher vor und erklären, warum er immer weniger Lebensraum findet. Einladung zur MV 2016 9 Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung Stieglitze sind gesellig - aber die Bergfinken, die von NABU-Mitgliedern im vergangenen des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) Winter auf der Kalteiche an der Grenze zu Hessen beobachtet wurden treten nicht in ge- Kreisverband Siegen-Wittgenstein e.V. wöhnlichen Schwärmen auf - Millionen von Bergfinken überwinterten dort oben. -

Geschäftsverteilungsplan Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
bürgerorientiert • professionell • rechtsstaatlich Geschäftsverteilungsplan Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis 1 Inhaltsverzeichnis Behördenleitung ..................................................................................... 3 Personalvertretungen ............................................................................. 3 Beauftragte ............................................................................................. 4 Leitungsstab ........................................................................................... 5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ............................................................ 5 Direktion Zentrale Aufgaben ................................................................... 6 Dezernat ZA 1 ........................................................................................ 6 Dezernat ZA 2 ........................................................................................ 7 Dezernat ZA 3 ........................................................................................ 8 Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz ......................................................... 9 Führungs- und Lagedienst .................................................................... 10 Polizeiwachen ...................................................................................... 11 Direktion Kriminalität............................................................................. 13 Kriminalkommissariat 1 ........................................................................ 14 -

Chapter 2. Block 1. Multi-Level Governance: Institutional and Financial Settings
2. BLOCK 1. MULTI-LEVEL GOVERNANCE: INSTITUTIONAL AND FINANCIAL SETTINGS 37 │ Chapter 2. Block 1. Multi-level governance: Institutional and financial settings 2.1. Enhance the effectiveness of migrant integration policy through improved co-ordination across government levels and implementation at the relevant scale (Objective 1) 2.1.1. Division of competences across levels of government In the Federal Republic of Germany, tasks, responsibilities and jurisdictive schemes are divided in general between the federal, Länder (state) and municipal levels. Three schemes exist: areas which fall under full federal jurisdiction; full Länder jurisdiction; and areas of concurrent regulations. The federal level has full jurisdiction in all areas regarding citizenship, foreign relations, defence, social security measures, and federation-wide measures for economic prosperity, traffic and for the most part in taxes (for instance in the areas of administration, customs, energy, tobacco and traffic). The Länder level’s responsibility lies in the areas of education, with full jurisdiction, as well as in research, regional economy and culture. Länder supervise municipalities and delegate financial means. They oversee the police, public transportation and are in charge of regional economic prosperity measures. Länder also regulate own tax revenues in the areas of, for instance, sales tax. Nonetheless, municipalities are important actors in the integration of migrants in Germany, especially when it comes to the implementation of federal and Länder legislation. They are by law autonomous entities in the Federal Republic’s administrative scheme and have considerable leeway, when federal legislation leaves room to manoeuvre in its interpretation (OECD, 2017a: 27). The municipal level maintains the local infrastructure and implements regulations in schools, museums, sports facilities and theatres. -

German Climate Governance Perspectives on North Rhine-Westphalia
German Climate Governance Perspectives on North Rhine-Westphalia Implemented by Imprint ‘German Climate Governance – Perspectives on North Rhine-Westphalia’ was compiled in the framework of the Sino- German Climate Partnership and Cooperation on Renewable Energies Project which is implemented by GIZ on behalf of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB). Additional support for the publication has come from the Sino-German Climate Change Programme, which is implemented by GIZ on behalf of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). 29 May, 2014 Contact Information Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Sunflower Tower 860 Maizidian Street 37, Chaoyang District, 100125 Beijing, PR China Ursula Becker Project Director Sino-German Climate Partnership E: [email protected] T: + 86 (0) 10 8527 5589 ext.101 Till Kötter Programme Manager Sino-German Climate Change Programme E: [email protected] T: + 86 (0) 10 8527 5589 ext.112 Andrew Park Programme Officer Sino-German Climate Change Programme E: [email protected] T: + 86 (0) 10 8527 5589 ext.121 Photo Credits Profile photos for the individual interviews have been provided by the interviewees themselves. Cover photos are copyright EnergieAgentur.NRW (under CC BY 2.0 License) Disclaimer The content of the individual interviews herein are provided for reference only, and are the views of the authors only, and are not necessarily endorsed by GIZ or other attributed entities. German Climate Governance Perspectives on North Rhine-Westphalia German Climate Governance German Climate Governance Preface Success stories from the provincial and city levels increasingly play a role in shaping the national mitigation strategies of China and Germany. -

Wandern Auf Bergmannspfaden
WANDERTIPP ® Wandern auf Bergmannspfaden Wilnsdorf – Siegerland-Wittgenstein Flyer zum Pocketguide Siegerland- Wittgenstein im Wandermagazin Ausgabe 134 Herausgeber: W&A Marketing & Verlag GmbH, Redaktion Wandermagazin, Rudolf-Diesel-Str. 14, 53859 Niederkassel, Tel. 0228/45 95-10, Fax 0228/45 95-199, [email protected], www.wandermagazin.de 5 Flyer-SiWi-Wilnsdorf-1341 19.04.2007, 13:58 Uhr Naturfreunde kommen in Wilnsdorf voll auf ihre Kosten: Die waldreiche Umgebung an den südöstlichen Ausläufern des Rothaargebirges bietet ausgesprochen gute Erholungsmöglichkeiten. Ein dicht ausgebautes Netz an Wanderwegen lädt zur aktiven Freizeitgestaltung und zur Erholung ein. 200 km Wanderwege ziehen sich durch die 11 Ortsteile. Seit dem 16. Jahrhundert erzählt die Legende, dass in der Nähe von Wilnsdorf der sagenumwobene Schmied „Wieland“ gelebt haben soll. Deshalb trug Wilnsdorf in alter Zeit auch den Namen „Wielandisdorf“. Zu den Sehenswürdigkeiten der Gemeinde Wilnsdorf zählen historische und teilweise denkmalgeschützte Gebäude wie der Förderturm im Ortsteil Niederdielfen, die Wassermühle in Niederdielfen, der eisenzeitliche Schmelzofen in Obersdorf, die in der Kapellenschule in Rinsdorf eingerichtete Heimatstube, eine alte Dorfschmiede im Ortsteil Wilden, das ehemalige Arrestgebäude in Wilnsdorf, die Doppelschiffkirche in Obersdorf und die Wallfahrts- stätte Eremitage am Klarissenkloster. In Wilnsdorf lädt das Volkskundliche Museum mit einer großen Bergbauausstellung zu einem Besuch ein. Außerdem findet zweimal im Jahr eine international anerkannte Grubenlampenausstellung in der Wilnsdorfer Festhalle statt. Eine durchgängige und sichere Markierung ist durch den Sauerländischen Gebirgs- verein (SGV) garantiert. Anreise: Mit der Deutschen Bahn nach Siegen und mit dem Bus weiter bis Wilnsdorf. Mit dem PKW erreicht man Wilnsdorf von der Autobahn A45 Dortmund-Frankfurt (Sauerlandlinie) Abfahrt Wilnsdorf. Informationen und Wanderpauschalen: Touristikverband Siegerland Wittgenstein e.V., Koblenzer Straße 73, 57072 Siegen, Tel. -

05 Application EGC 2017 Air Quality ESSEN
Section 05: Air quality 5 A. Current situation The City of Essen is located at the centre of the Ruhr Metropolis, whose history as a steel and coal-mining region is characterised by a high degree of industrialisation, high population density, and substantial traffic volumes. The advantages resulting from the high density of infrastructure must be paid for, however, with higher levels of environmental pollution. This applies in particular to the northern district areas, which belong to the densely populated and topographically disadvantaged Emscher lowlands, whose topography often gives rise to frequent low inversion layers. Heavy industry has been progressively leaving the municipal area since the 1960s. The last coking plant, today's "Zollverein" World Heritage Site, was shut down in 1993. The location's structural change from an industrial to a service-based economy has been ongoing for over five decades, and has lastingly changed the face of the city. While in the 1950s two thirds of the working population of Essen worked in manufacturing, today over 80% of all jobs are in the tertiary sector. As such, Essen is amongst the top cities in the German services industry. The structures of the city that grew up during industrialisation are still clearly visible today. The urban development orientated very strongly upon the needs of industry. No integrated or strategic residential plan was developed before 1945. Mines and steel mills were built outside the gates of the "old town", and developed increasing space requirements. Massive migration of labour workforce led to increasingly dense urbanisation around the industrial plants. The waterways running in an east-west direction, the Ruhr, Emscher, Lippe and Rhine-Herne Canal, together with the Hellweg, are the historic main arteries of the region. -

Prof. Gui Bonsiepe
Nancy Birkhölzer :: 29.07.76 | Germany | [email protected] > education 1996-2001 University of Applied Sciences Cologne >, Cologne, Germany Design Department diploma 2001 main topic Interface/Hypermedia (Prof. Gui Bonsiepe) > »Personalized library information environment« :: research + concept work on the use of adaptive methods in information systems, information architecture + interface scematics, grade 1,0 secondary topics Corporate Identity (Prof. Heiner Jacob) > »Mapping the vertical« :: analysis of information design and visualization techniques for the 3rd dimension, grade 1,7 Gender Design (Prof. Uta Brandes) > »Human effects in usability assessment« :: analysis of usability testing methods and their potencial for the design profession, grade 1,7 prediploma 1998 main topic Corporate Identity (Prof. Heiner Jacob) > »Information architecture for an art museum network« :: concept, interface/interaction design + development for the Lenbachhaus > , Munich, Germany grade 1,0 secondary topics Interface/Hypermedia (Prof. Gui Bonsiepe) > »To reality by simulation - metaphors in the virtual world« :: design theory work, grade 1,0 Service Design (Prof. Birgit Mager) > »Analysis of the customer service of german travel agencies« :: market analysis and research on profiling strategies, grade 1,0 1999-2000 Rhode Island School of Design (RISD) >, Providence, RI/USA 1 year of Graduate Studies >, Graphic Design Department (Fulbright grant) 1999-2000 Brown University >, Providence, RI/USA RISD Cross Registration, Computer Science Department, -

Schulamt Für Den Hochsauerlandkreis Als Untere Schulaufsichtsbehörde
SCHULAMT FÜR DEN HOCHSAUERLANDKREIS ALS UNTERE SCHULAUFSICHTSBEHÖRDE Ausschuss für den Schulsport Schulamt für den Hochsauerlandkreis Eichholzstr. 9, 59821 Arnsberg Verwaltungsgebäude Eichholzstr. 9, 59821 Arnsberg AfS Kreis Olpe Organisationseinheit 23 AfS Kreis Siegen Wittgenstein Sachbearbeiter/in Frau Bornemann St. Ursula Gymnasium Arnsberg Telefon-Durchwahl (02931) 94- 4109 Geschwister-Scholl-Gymnasium Winterberg- Telefax (02931) 94-4111 Medebach christiane.bornemann E-mail @hochsauerlandkreis.de Herrn Kastien, Bez. Regierung Arnsberg Zimmer-Nr. 159 Aktenzeichen 23/40- Datum 31.03.2016 Landessportfest der Schulen 2015/2016 hier: Vorrunde Regierungsbezirksmeisterschaften im Fußball WK II + III Mädchen Sehr geehrte Damen und Herren, die Vorrunde der Regierungsbezirksmeisterschaften im Fußball WK II+III Mädchen findet statt am Dienstag, den 19.04.2016 Spielort : Sportzentrum Große Wiese Klosfuhr 5, 59759 Arnsberg Anreise : bis 09:30 Uhr Beginn : 10.00 Uhr voraus. Ende : 13.00 Uhr Rückfahrt : ca. 13.30 Uhr Spielzeit : WK II 2x15 Min. – WK III 2x15 Min. Schiedsrichter : werden vom FLVW gestellt Teilnehmende Mannschaften WK II (Jahrgang 2000-2002) Realschule Wilnsdorf (SI) St. Ursula-Realschule, Attendorn (OE) Geschwister-Scholl-Gymnasium, Winterberg-Medebach (HSK) Teilnehmende Mannschaften WK III (Jahrgang 2002-2004) Berta-von-Suttner-GeS Siegen (SI) Städt. Gymnasium Olpe (OE) St. Ursula Gymnasium, Arnsberg (HSK) Kreissitz: Steinstr. 27, Meschede Im Rahmen der Gleitzeitregelung erreichen Sie die Mitarbeiter/innen der Kreis- Bankverbindung: Telefon (0291) 94 - 0 verwaltung telefonisch in den folgenden Kernzeiten (hiervon abweichende Sparkasse Hochsauerland 190 BLZ 416 517 70 Telefax (0291) 94 – 1140 Besuchszeiten sind oben vermerkt). Sparkasse Meschede 18 BLZ 464 510 12 Videokonferenz (0291) 94 - 2804 Mo.-Do. 8.30 – 12.00 Uhr Mo., Mi., Do. -

Vorlage 45/2021
KREISTAG des Kreises Siegen-Wittgenstein Dezernat / Referat / Amt Telefon-Nummer Dez./Ref./AL Datum Bauamt 0271/333-1914 18.02.2021 Aktenzeichen Drucksache ö / nö 61.13.04 45/2021 öffentlich Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz, Land- und Forstwirtschaft am 04.03.2021 Ausschuss für Kultur, Tourismus und Ehrenamt am 08.03.2021 Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur am 10.03.2021 Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg - Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe und Kreis Siegen-Wittgenstein (MK-OE-SI) Sachdarstellung: Seit 29.01.2021 liegt der Entwurf des neuen Räumlichen Teilplans Märkischer Kreis, Kreis Olpe und Kreis Siegen-Wittgenstein des Regionalplans Arnsberg vor. Die Öffentliche Bekanntma- chung zur Neuaufstellung dieses Teilplans über die öffentliche Auslegung erfolgte entsprechend der maßgeblichen Bestimmungen es Raumordnungsgesetzes (ROG) und des Landesplanungs- gesetzes NRW (LPlG) im Dezember im Amtsblatt für den Regierungsbezirk. Die Planunterlagen (textliche und zeichnerische Festlegungen und Erläuterungen, Begründung, Umweltbericht) lie- gen noch bis einschließlich 30.06.2021 bei der Bezirksregierung sowie den betroffenen Kreisen öffentlich aus. Der Öffentlichkeit sowie den in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wird während der Auslegungsfrist die Gelegenheit gegeben, sich über die Regionalplanneuaufstellung zu informie- ren und Stellungnahmen abzugeben. Von den Planinhalten wird der Kreis Siegen-Wittgenstein sowohl als kommunale Gebietskörper- schaft als auch als Untere staatliche -

Basic Genealogical Sources in Westphalia – an Introduction Online Westphalia Connection Session, Dec
Basic Genealogical Sources in Westphalia – An Introduction Online Westphalia Connection Session, Dec. 5th, 2020, Roland Linde Dear genealogists, I would like to give you some advice how you can obtain further information about your ancestors in Westphalia. But I can only give you a very few initial clues because its a fairly broad topic. Perhaps I can tell you more about the history of Westphalia in another conference; it is a diverse landscape with strong cultural, economic and religious differences. Around 1800 Westphalia still consisted of various clerical and secular principalities, larger and smaller, some of which were Catholic and some were Protestant. Then the French came under Emperor Napoleon and turned Westphalia pretty much on its head. With the Congress of Vienna in 1815, Westphalia first emerged as a state unit, as a province of the Kingdom of Prussia. Münster became the provincial capital. In 1816, Prussia set up three administrative districts (Regierungsbezirke) within this province: Münster (western Westphalia), Arnsberg (southern Westphalia) and Minden (eastern Westphalia). The administrative districts were again divided into districts (Kreise) and these into rural and urban communities (Gemeinden und Städte). That doesn't sound terribly exciting, but as a genealogist you have to know that in order to find the sources. The Prussians founded a state archive in Münster, in which the historical tradition for the whole of Westphalia was brought together. It still exists today under a different name. Exactly 150 years later, in 1946, the Allied occupying powers smashed the Free State of Prussia, which had dominated Germany since 1815. From the two western provinces of Prussia, the Rhineland and Westphalia, today's state of North Rhine-Westphalia (Nordrhein-Westfalen) emerged under the British military government at that time. -

North Rhine-Westphalia for H1 2019
MARKET REPORT ON THE LETTING OF LOGISTICS PROPERTIES AND INDUSTRIAL SPACES North Rhine-Westphalia for H1 2019 Market report on the letting of logistics properties and industrial sites in North Rhine-Westphalia* for first half of 2019 n Take-up in NRW sees impressive year-on-year >> Take-up of logistics properties and industrial spaces in North Rhine-Westphalia H1 2019 growth of 22% to around 517,000 sqm n Ruhr region delivers the highest take-up at +88% year-on-year n Logistics, retail and industrial companies in the Cologne and Düsseldorf sub-markets wait in line n New construction activity stalls n Rents relatively stable n Average rent in Cologne climbs by 10% >> Take-up of logistic property and industrial space by regions in North Rhine-Westphalia H1 2019 n Forecast for full-year 2019: solid take-up of between 850,000 and 930,000 sqm The logistics market in North Rhine-Westphalia (NRW) has enjoyed excellent performance once again. With a letting volume of around 517,000 sqm for industrial and logistics space and business parks, one of Germany’s most im- portant logistics markets recorded impressive year-on-year growth of 22% compared with the prior-year figure of 422,200 sqm and achieved its third-best result in the last five years, coming in at 3% above the five-year average (501,600 sqm). >> Lessors with the highest take-up in H1 2019 in the metropolitan region Düsseldorf The Ruhr region rescued the overall picture for 1. Amazon, Kempen, 3. ABC, Düsseldorf NRW, recording the highest level of demand as 22,370 sqm, new building 13,500 sqm, built-to-suit well as the most leases concluded thanks to quick follow-up letting in functional existing buildings.