Spitzensport Und Migration
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
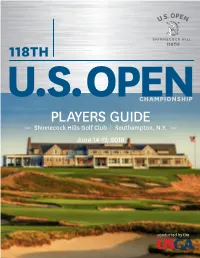
PLAYERS GUIDE — Shinnecock Hills Golf Club | Southampton, N.Y
. OP U.S EN SHINNECOCK HILLS TH 118TH U.S. OPEN PLAYERS GUIDE — Shinnecock Hills Golf Club | Southampton, N.Y. — June 14-17, 2018 conducted by the 2018 U.S. OPEN PLAYERS' GUIDE — 1 Exemption List SHOTA AKIYOSHI Here are the golfers who are currently exempt from qualifying for the 118th U.S. Open Championship, with their exemption categories Shota Akiyoshi is 183 in this week’s Official World Golf Ranking listed. Birth Date: July 22, 1990 Player Exemption Category Player Exemption Category Birthplace: Kumamoto, Japan Kiradech Aphibarnrat 13 Marc Leishman 12, 13 Age: 27 Ht.: 5’7 Wt.: 190 Daniel Berger 12, 13 Alexander Levy 13 Home: Kumamoto, Japan Rafael Cabrera Bello 13 Hao Tong Li 13 Patrick Cantlay 12, 13 Luke List 13 Turned Professional: 2009 Paul Casey 12, 13 Hideki Matsuyama 11, 12, 13 Japan Tour Victories: 1 -2018 Gateway to The Open Mizuno Kevin Chappell 12, 13 Graeme McDowell 1 Open. Jason Day 7, 8, 12, 13 Rory McIlroy 1, 6, 7, 13 Bryson DeChambeau 13 Phil Mickelson 6, 13 Player Notes: ELIGIBILITY: He shot 134 at Japan Memorial Golf Jason Dufner 7, 12, 13 Francesco Molinari 9, 13 Harry Ellis (a) 3 Trey Mullinax 11 Club in Hyogo Prefecture, Japan, to earn one of three spots. Ernie Els 15 Alex Noren 13 Shota Akiyoshi started playing golf at the age of 10 years old. Tony Finau 12, 13 Louis Oosthuizen 13 Turned professional in January, 2009. Ross Fisher 13 Matt Parziale (a) 2 Matthew Fitzpatrick 13 Pat Perez 12, 13 Just secured his first Japan Golf Tour win with a one-shot victory Tommy Fleetwood 11, 13 Kenny Perry 10 at the 2018 Gateway to The Open Mizuno Open. -

XXXVII Copa De Europa 1991/92: FC BARCELONA (España)
Cuadernos de Fútbol Revista de CIHEFE https://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol XXXVII Copa de Europa 1991/92: FC BARCELONA (España) Autor: José del Olmo Cuadernos de fútbol, nº 93, diciembre 2017. ISSN: 1989-6379 Fecha de recepción: 04-11-2017, Fecha de aceptación: 16-11-2017. URL: https://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2017/12/xxxvii-copa-de-europa-199192-fc- barcelona-espana/ Resumen Dentro de nuestra serie histórica sobre la Copa de Europa llegamos a la edición correspondiente a la temporada 1991-1992 ganada por el F.C. Barcelona. Palabras clave: Copa de Europa, estadísticas, F.C. Barcelona, futbol, historiaUEFA Abstract Keywords:European Cup, Statistics, Football, History, F.C. Barcelona, UEFA Within our historical series on the European Champion Clubs’ Cup we reach the 1991-92 season, won by F.C. Barcelona. Date : 1 diciembre 2017 Participantes: 1 / 44 Cuadernos de Fútbol Revista de CIHEFE https://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol Fueron treinta y dos campeones los que tomaron parte en esta edición. La presencia del Hansa Rostock como último equipo que defendió el pabellón de Alemania Oriental era la confirmación de la unión de los dos estados a lo largo del 1991. Era el reflejo más inmediato de los trascendentes cambios políticos que sacudieron a Europa. También el Dinamo de Kiev fue el último campeón soviético porque como consecuencia de la desintegración de la Unión Soviética se dio paso a un ente deportivo internacional fantasma, la Comunidad de Estados Independientes, para dar espacio legal de manera circunstancial a la nueva conformación de Europa. Yugoslavia también empezaba a desmoronarse como república federal y se registraban los primeros movimientos separatistas. -
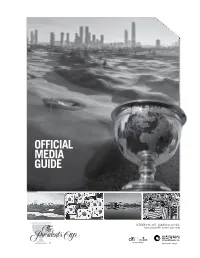
Official Media Guide
OFFICIAL MEDIA GUIDE OCTOBER 6-11, 2015 &$ " & "#"!" !"! %'"# Table of Contents The Presidents Cup Summary ................................................................. 2 Chris Kirk ...............................................................................52 Media Facts ..........................................................................................3-8 Matt Kuchar ..........................................................................53 Schedule of Events .............................................................................9-10 Phil Mickelson .......................................................................54 Acknowledgements ...............................................................................11 Patrick Reed ..........................................................................55 Glossary of Match-Play Terminology ..............................................12-13 Jordan Spieth ........................................................................56 1994 Teams and Results/Player Records........................................14-15 Jimmy Walker .......................................................................57 1996 Teams and Results/Player Records........................................16-17 Bubba Watson.......................................................................58 1998 Teams and Results/Player Records ......................................18-19 International Team Members ..................................................59-74 2000 Teams and Results/Player Records -

Pgasrs2.Chp:Corel VENTURA
Senior PGA Championship RecordBernhard Langer BERNHARD LANGER Year Place Score To Par 1st 2nd 3rd 4th Money 2008 2 288 +8 71 71 70 76 $216,000.00 ELIGIBILITY CODE: 3, 8, 10, 20 2009 T-17 284 +4 68 70 73 73 $24,000.00 Totals: Strokes Avg To Par 1st 2nd 3rd 4th Money ê Birth Date: Aug. 27, 1957 572 71.50 +12 69.5 70.5 71.5 74.5 $240,000.00 ê Birthplace: Anhausen, Germany êLanger has participated in two championships, playing eight rounds of golf. He has finished in the Top-3 one time, the Top-5 one time, the ê Age: 52 Ht.: 5’ 9" Wt.: 155 Top-10 one time, and the Top-25 two times, making two cuts. Rounds ê Home: Boca Raton, Fla. in 60s: one; Rounds under par: one; Rounds at par: two; Rounds over par: five. ê Turned Professional: 1972 êLowest Championship Score: 68 Highest Championship Score: 76 ê Joined PGA Tour: 1984 ê PGA Tour Playoff Record: 1-2 ê Joined Champions Tour: 2007 2010 Champions Tour RecordBernhard Langer ê Champions Tour Playoff Record: 2-0 Tournament Place To Par Score 1st 2nd 3rd Money ê Mitsubishi Elec. T-9 -12 204 68 68 68 $58,500.00 Joined PGA European Tour: 1976 ACE Group Classic T-4 -8 208 73 66 69 $86,400.00 PGA European Tour Playoff Record:8-6-2 Allianz Champ. Win -17 199 67 65 67 $255,000.00 Playoff: Beat John Cook with a eagle on first extra hole PGA Tour Victories: 3 - 1985 Sea Pines Heritage Classic, Masters, Toshiba Classic T-17 -6 207 70 72 65 $22,057.50 1993 Masters Cap Cana Champ. -

The Tales of the Grimm Brothers in Colombia: Introduction, Dissemination, and Reception
Wayne State University Wayne State University Dissertations 1-1-2012 The alest of the grimm brothers in colombia: introduction, dissemination, and reception Alexandra Michaelis-Vultorius Wayne State University, Follow this and additional works at: http://digitalcommons.wayne.edu/oa_dissertations Part of the German Literature Commons, and the Modern Languages Commons Recommended Citation Michaelis-Vultorius, Alexandra, "The alet s of the grimm brothers in colombia: introduction, dissemination, and reception" (2012). Wayne State University Dissertations. Paper 386. This Open Access Dissertation is brought to you for free and open access by DigitalCommons@WayneState. It has been accepted for inclusion in Wayne State University Dissertations by an authorized administrator of DigitalCommons@WayneState. THE TALES OF THE GRIMM BROTHERS IN COLOMBIA: INTRODUCTION, DISSEMINATION, AND RECEPTION by ALEXANDRA MICHAELIS-VULTORIUS DISSERTATION Submitted to the Graduate School of Wayne State University, Detroit, Michigan in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY 2011 MAJOR: MODERN LANGUAGES (German Studies) Approved by: __________________________________ Advisor Date __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ © COPYRIGHT BY ALEXANDRA MICHAELIS-VULTORIUS 2011 All Rights Reserved DEDICATION To my parents, Lucio and Clemencia, for your unconditional love and support, for instilling in me the joy of learning, and for believing in happy endings. ii ACKNOWLEDGEMENTS This journey with the Brothers Grimm was made possible through the valuable help, expertise, and kindness of a great number of people. First and foremost I want to thank my advisor and mentor, Professor Don Haase. You have been a wonderful teacher and a great inspiration for me over the past years. I am deeply grateful for your insight, guidance, dedication, and infinite patience throughout the writing of this dissertation. -

Societe Generale Private Banking Renews Its Partnerships with Golfers Jeev Milkha Singh and Christian Cevear
NEWS FLASH Paris, 16 April 2012 SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING RENEWS ITS PARTNERSHIPS WITH GOLFERS JEEV MILKHA SINGH AND CHRISTIAN CEVEAR Societe Generale Private Banking has renewed its support for the Indian player Jeev Milkha Singh, the first ever Indian golfer qualified for the European Tour and the Augusta Masters, and for the French golfer, Christian Cevaër, winner of the European Tour in 2009. The sponsorship contracts will each last for two years. The private bank today sponsors four international golfers including the Argentinian golf player, Angel Cabrera, winner of the US Open in 2007 and the Augusta Masters in 2009, and Thomas Levet, winner of the French Open in 2011 and the Andalucian Open in 2008. Renewing these partnerships enables Societe Generale Private Banking to offer its private clients the opportunity to play with top- level golfers through an exclusive events programme organised around this sport throughout the world. These partnerships are part of an approach by Societe Generale Group which began in 2001. That year, the bank became a major partner of the French Golf Federation, then, in 2008, of the Evian Masters, a major international womens’ tournament. *** Jeev Milkha Singh is the first Indian golfer to qualify for The European Tour continued to compete at the very highest level in 2009, finishing fourth in the WGC-CA Championship – one of three top ten finishes which helped him to 34th position in the inaugural Race to Dubai. His third European Tour career victory came in 2008 in Austria. A consistently strong season saw him finish in the top ten eight times, worth 12th place on the money list. -

Exploring Ethics As a Meta-Regulatory Framework for Evolving Governance Discourse By
Principles, Process and Responsibility: Exploring Ethics as a Meta-Regulatory Framework for Evolving Governance Discourse by Alison Louise Dempsey A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY in The Faculty of Graduate Studies (Law) THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA (Vancouver) April 2012 © Alison Louise Dempsey, 2012 Abstract This thesis proposes a new paradigm for understanding, developing and maintaining standards of corporate governance and conduct based on ethics as a meta-regulatory framework for governance discourse. It explores the possibility that, within such a framework, the explicit recognition of fundamental norms of ethical conduct and decision making such as honesty, fairness, consideration of others, responsibility and trustworthiness would precede and inform policy decisions relating to the objectives, structure and regulatory approaches of particular governance systems and practical considerations of how to implement and operationalize governance practices. It suggests that, despite the complex legal, institutional, normative and social dimensions of corporate governance standards and practice, these ethical norms are already implicit, and more recently explicit, in the formal systems of laws, rules and standards that seek to regulate corporate conduct. Alongside these traditional governance regulatory mechanisms, informal and soft law governance standards − codes, guidelines, international and multi-partite commitments − have emerged as an influential source of explicitly ethical, values based beliefs and expectations of what constitutes responsible business. There is an opportunity to use these ethical norms as a common point of departure for future governance discourse that is broad enough to support multiple approaches to governance yet flexible enough to accommodate complexity, diversity and change. -

The DFB-Ligapokal 1997 (GER)
The DFB Super Cup 1987 - 1996 (FRG - GER) - The DFB-Ligapokal 1997 - 2004 (GER) - The Premiere-Ligapokal 2005 - 2007 (GER) - The DFL Super Cup 2010 - 2021 (GER) - The Match Details: The DFB Super Cup 1987 (FRG): 28.7.1987, Frankfurt am Main (FRG) - Waldstadion. FC Bayern München (FRG) - Hamburger SV (FRG) 2:1 (0:1). FC Bayern: Raimond Aumann - Norbert Nachtweih - Helmut Winklhofer, Norbert Eder, Johannes Christian 'Hansi' Pflügler - Andreas Brehme (46. Hans-Dieter Flick), Lothar Herbert Matthäus, Hans Dorfner, Michael Rummenigge - Roland Wohlfarth, Jürgen Wegmann - Coach: Josef 'Jupp' Heynckes. Hamburg: Ulrich 'Uli' Stein (Red Card - 87.) - Ditmar Jakobs - Manfred Kaltz, Dietmar Beiersdorfer, Thomas Hinz (90. Frank Schmöller) - Sascha Jusufi, Thomas von Heesen, Carsten Kober (88. Richard Golz), Thomas Kroth - Mirosław Okoński, Manfred Kastl - Coach: Josip Skoblar. Goals: 0:1 Mirosław Okoński (39.), 1:1 Jürgen Wegmann (60.) and 2:1 Jürgen Wegmann (87.). Referee: Dieter Pauly (FRG). Attendance: 18.000. The DFB Super Cup 1988 (FRG): 20.7.1988, Frankfurt am Main (FRG) - Waldstadion. SG Eintracht Frankfurt (FRG) - SV Werder Bremen (FRG) 0:2 (0:1). SG Eintracht: Ulrich 'Uli' Stein - Manfred Binz - Ralf Sievers, Karl-Heinz Körbel, Stefan Studer - Frank Schulz - Peter Hobday (46. Dietmar Roth), Dieter Schlindwein, Maximilian Heidenreich (57. Ralf Balzis) - Jørn Andersen, Heinz Gründel - Coach: Karl-Heinz Feldkamp. SV Werder: Oliver Reck - Gunnar Sauer - Ulrich 'Uli' Borowka, Michael Kutzop, Johnny Otten (46. Norbert Meier) - Thomas Schaaf, Miroslav 'Mirko' Votava, Günter Hermann, Frank Neubarth - Karlheinz Riedle, Frank Ordenewitz (46. Manfred Burgsmüller) - Coach: Otto Rehhagel. Goals: 0:1 Karlheinz Riedle (24.) and 0:2 Manfred Burgsmüller (90.). -

DERTOUR Kombinieren Sie Sich Zum Perfekten Urlaub
Willkommen bei DERTOUR Kombinieren Sie sich zum perfekten Urlaub Ihre Anreise Ihre Erlebnisse vor Ort Wie möchten Sie am liebsten an Ihr Was möchten Sie im Urlaub unter- Urlaubsziel reisen? Bei DERTOUR nehmen? Tickets, Events, Ausflüge, können Sie aus den vielen Möglich- Aktivitäten – ergänzen Sie Ihren keiten diejenige auswählen, die Ihnen Reiseplan mit allem, was Ihren Urlaub am besten gefällt. perfekt macht. Ihre Unterkunft Was soll Ihr Urlaubsdomizil bieten? Wählen Sie einfach Ihr Wunsch- Hotel. Wo Sie wie lange bleiben wollen, können Sie bei DERTOUR selbst bestimmen. DERTOUR. FÜR MICH. PERFEKT. 3 Der perfekte Urlaub. So leicht gesagt wie geplant. Denn dank des Prinzips der beliebig kombinierbaren Reisebausteine, das DERTOUR zum führenden Reiseveranstalter für Individual- reisen in Deutschland gemacht hat, haben Sie alle Freiheiten: Sie können Ihren Urlaub ganz nach Wunsch aus dem umfang- reichen DERTOUR Programm zusammenstellen. Oder einfach eine der spannenden vorgeplanten Reisekombinationen auswählen. Schließlich wissen Sie selbst am besten, was Ihren Urlaub perfekt macht. © FC Barcelona © FC Motorsport 14 Informationen Event-Kalender 36 Anreise zum Flughafen 10 DERTOUR-Flüge 10 Fußball 38 Bahnanreise 12 Darts 50 Reiseversicherung 71 Wissenswertes von A-Z 72 Tennis 51 Reisebedingungen 74 Marathon 56 Leichtathletik 57 Trainingscamps 68 SPORT LIVE ERLEBEN © Andreas Kretschel © Andreas Gute Gründe, mit DERTOUR zu reisen Mehr Service, mehr Extras, mehr Freiheiten DERTOUR Sicherheit 100 Jahre Erfahrung Mit unserem großen Know-how im Reisegeschäft und in der Kundenbetreuung sorgen wir für Ihre Sicherheit. Vor der Reise. Auf der Reise. Überall auf der Welt. Persönliche Beratung Die Beratung durch einen Reisespezialisten ist das A und O für eine perfekte individuelle Reiseplanung. -

Information Is Taken from the Book "50 Jahre Bundesliga" by Werner Welsch
Information is taken from the book "50 Jahre Bundesliga" by Werner Welsch. Covered are seasons 1963-64 up to season 2011-12. Most consecutive games without receiving a yellow card Outfield players Games Player time span 299 Bum Kun Cha (11.08.1979 - 15.04.1989) 136 Werner Dressel (17.05.1980 - 25.02.1986) 123 Bernd Dürnberger (11.08.1979 - 13.08.1983) 117 Marco Bode (05.08.1989 – 23.09.1995) 109 Klaus Fischer (22.09.1979 – 01.10.1983) 109 Frank Hartmann (19.05.1984 – 17.10.1987) 103 Bernard Dietz (22.05.1982 – 08.11.1986) 103 Hans-Jörg Criens (17.04.1986 – 13.10.1989) 101 Thomas Kroth (31.08.1983 – 30.05.1987) Goalkeepers 212 Andreas Köpke (31.10.1987 – 27.04.1996) [one red card] 183 Ulrich Stein (27.09.1986 – 05.11.1995) [two red cards] 157 Ralf Zumdick (05.09.1981 – 29.05.1987) 152 Oliver Reck (01.08.1987 – 05.03.1994) [one red card] 145 Wolfgang Kleff (11.08.1979 – 03.09.1985) 133 Claus Reitmaier (12.10.1996 – 05.11.2000) 132 Rüdiger Vollborn (19.05.1984 – 22.07.1988) 120 Uwe Kamps (12.03.1983 – 26.08.1989) Most penalty saves absolute 23 of 76 Rudolf Kargus (1974 – 1987) 18 of 88 Harald Schumacher (1974 – 1988) 17 of 64 Norbert Nigbur (1966 – 1981) 14 of 44 Andreas Köpke (1986 – 1996) 14 of 73 Dieter Burdenski (1971 – 1986) 13 of 44 Claus Reitmaier (1991 – 2003) 13 of 57 Richard Golz (1989 – 2005) 12 of 53 Ronnie Hellström (1975 – 1984) 11 of 28 Robert Enke (1998 – 2009) 11 of 36 Petar Radenkovic (1964 to 1970) relative % 39.29 Robert Enke 31.82 Andreas Köpke 31.82 Tim Wiese 30.56 Petar Radenkovic 30.26 Rudolf Kargus 29.55 Claus Reitmaier 26.56 Norbert Nigbur 24.39 Uwe Kamps 24.39 Dr. -

Ucla's Pga Tour Legacy
TAABLEBLE OOFF COONTENTSNTENTS UCLA QUICK FACTS 2011-12 BRUINS 7 Alphabetical Roster ................................................2 Address ............ J.D. Morgan Center, PO Box 24044 Portrait Roster .........................................................3 Los Angeles, CA 90024-0044 2011-12 Schedule ..................................................43 Athletics Phone ...................................(310) 825-8699 THE COACHING STAFF Ticket Offi ce.................................. (310) UCLA-WIN Chancellor ...........................................Dr. Gene Block Head Coach Derek Freeman ................................4 Director of Athletics ..................Daniel G. Guerrero Assistant Coach Jason Sigler ................................6 Faculty Athletic Rep. ......................Donald Morrison Key Support Staff .................................................42 Enrollment .......................................................... 40,675 THE PLAYERS Founded ................................................................. 1919 Colors ....................................................Blue and Gold Player Biographies ...................................................7 Nickname ............................................................ Bruins THE 2010-11 SEASON Conference.....................................................Pacifi c-12 Conference Phone .................................925-932-4411 2010-11 Tournament Summary ..........................18 Conference Fax ......................................925-932-4601 2010-11 -

Österreichs Deutschland-Komplex. Paradoxien in Der Österreichisch- Deutschen Fußballmythologie
1 Österreichs Deutschland-Komplex. Paradoxien in der österreichisch- deutschen Fußballmythologie. Abbildung 1. Das so genannte „Anschluss“-Spiel zwischen der „Deutschen Nationalmannschaft“ und der „Deutschösterreichischen Mannschaft“ am 12. März 1938 im Wiener Praterstadion: Mathias Sindelar (rechts) und der deutsche Mannschaftskapitän Reinhold Münzenberg beim Shakehands vor dem Spiel – in der Mitte der Berliner Unparteiische Alfred Birlem, der damals prominenteste deutsche Schiedsrichter. 2 Prolog Als Struktur und Inhalte der vorliegenden Arbeit sich erstmals – im Zuge der Recherchen und nach Fertigstellung meiner Diplomarbeit1 – abzuzeichnen begannen, war von einer „EURO 2008“ noch keine Rede. Das Thema meiner Dissertation wurde mehr als ein Jahr, bevor das Los wieder einmal Österreich und Deutschland zu Gegnern gemacht hatte, eingereicht. Angesichts des Medien-Hype, zahlreicher Neuerscheinungen der Fußball-Literatur und des Veranstaltungs-Booms im Soge der Fußball-Europameisterschaft während der Fertigstellung dieser Dissertation scheint mir diese Anmerkung besonders wichtig. Der bundesdeutsche Boulevard ließ angesichts der Neuauflage des österreichisch-deutschen Duells Ende 2007 die Gelegenheit nicht aus, sofort wieder zu sticheln und die Stimmung rechtzeitig aufzuheizen. „Wir leihen euch unsere B-Elf“, lautete der „Bild“-Vorschlag gegen den „Ösi-Jammer“. Prompt begab sich die Tageszeitung „Österreich“ auf dieselbe Stufe und titelte, auf die aktuelle Krise im deutschen Skispringerlager anspielend, höhnisch: „Wir leihen euch unsere