Katholische Couleurstudenten Im Widerstand VORWORT
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Buchanan on Bischof and Petschar, 'The Marshall Plan: Saving Europe, Rebuilding Austria'
H-Diplo Buchanan on Bischof and Petschar, 'The Marshall Plan: Saving Europe, Rebuilding Austria' Review published on Saturday, April 21, 2018 Günter Bischof, Hans Petschar. The Marshall Plan: Saving Europe, Rebuilding Austria. New Orleans: University of New Orleans Publishing, 2017. 336 pp. $49.95 (cloth), ISBN 978-1-60801-147-6. Reviewed by Andrew N. Buchanan (University of Vermont)Published on H-Diplo (April, 2018) Commissioned by Seth Offenbach (Bronx Community College, The City University of New York) Printable Version: http://www.h-net.org/reviews/showpdf.php?id=50939 The bibliographic details of this book should probably include its size (9.5” by 12”) and its weight (five pounds). This is a physically impressive book, and its sheer size, beautiful design, and lavish illustration suggest a work intended for display on coffee tables rather than use in academic studies. Yet the authors are both senior scholars of Austrian history and of the Marshall Plan in particular. Günter Bischof is the Marshall Plan Professor of History at the University of New Orleans and Hans Petschar is a historian and librarian at the Austrian National Library and the holder of the 2016-17 visiting Marshall Plan Chair at the University of New Orleans. Their credentials suggest that the authors have something more than a coffee table book in mind, and as it weaves its way through the pages of photographs their text offers a serious scholarly appreciation of the working of the Marshall Plan in Austria. Austria found itself in an ambiguous—not to say dangerous—position at the end of World War II. -

Renate Welsh | 2020 RENATE WELSH
Page 1 2020Renate Welsh | 2020 RENATE WELSH The Hans Christian Andersen Award 2020 Austrian Section of IBBY Author Page 2 Renate Welsh | 2020 Renate Welsh was born in Vienna on December 22nd, 1937. More than once the author has described her childhood as having been an unhappy one, a fact she attributes to the early death of loved ones (her mother and her grandfather), the resulting vague feelings of guilt and living through the Second World War. Early in her life Welsh started to process her experiences by writing and inventing stories. At the age of fifteen she was awarded a scholarship and went to Portland, Oregon, as an exchange student for one year. In 1955 she started to study English, Spanish and political sciences; however, after her wedding in 1956 she broke off her university studies in order to work for the British Council in Vienna. Initially she worked there part-time and as of 1962 she started to work as a freelance translator. She began to write after she had had to stay at a hospital for an extended period in the Year of 1968. This long phase of being bedridden and contemplating triggered her first book, Der Enkel des Löwenjägers (The Lion Hunter’s Grandson), which was on the Roll of Honour on the occasion of the 1970 Austrian State Award. Since 1975 Renate Welsh has worked as a freelance writer. In her comprehensive and versatile overall work she has written about the current tendencies of change in a modern childhood and youth in an exemplary and socially committed way. -

AV Austria Innsbruck
AV Austria Innsbruck Home Die Austria Die Geschichte der AV Austria Innsbruck Austrier Blätter Folgend geben wir lediglich einen kurzen Überblick und Auszüge von unserer Verbindungsgeschichte: Programm Interesse? Die ersten Jahre Intern Unsere Verbindung wurde am 9. Juni 1864 von zwei Kontakt Philosophiestudenten, Franz Schedle und Johann Wolf, gegründet. Sie ist damit die älteste katholische Verbindung Österreichs und die "vierte" Verbindung, die dem damals noch Deutschland, Österreich und Tschechien umfassenden Cartellverband (CV) beitrat. Die Anfangsjahre waren von der liberalen und kirchenfeindlichen Denkweise vieler Professoren und Studenten an der Universität, speziell der schlagenden Corps, und daraus resultierenden Anfeindungen bis hin zu tätlichen Übergriffen geprägt. Ein gewaltiger Dorn im Auge war den bestehenden Corps vor allem die Ablehnung der Mensur, was zu vielen Provokationen und Ehrbeleidigungen führte. Ein in Couleurkreisen relativ bekannter Austrier beispielsweise, Josef Hinter, späterer Gründer der Carolina Graz, wurde wegen der Ablehnung eines Duells mit einem Schlagenden unehrenhaft aus der kaiserlichen Armee entlassen, und dies war kein Einzelfall. Dennoch gelang es der Austria, binnen sechs Jahren zur größten Verbindung Innsbrucks zu werden. Die Austria bildete 1866 etwa den dritten Zug der Akademischen Legion (Studentenkompanie) im Krieg gegen Italien. Zugsführer war der Gründer der Austria, Franz Xaver Schedle! Die Fahne der Studentenkompanie hängt heute in einem Schaukasten bei der Aula der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. In dieser Aula prangert übrigens auch an der Strinseite des Saales unser Wahlspruch! Damals wie heute lauteten die Prinzipien: RELIGIO, das Bekenntnis zur Römisch-Katholischen Kirche PATRIA, Heimatliebe und Bekenntnis zum Vaterland Österreich SCIENTIA, akademische und persönliche Weiterbildung AMICITIA, Brüderlichkeit und Freundschaft Mehr über unsere 4 Prinzipien erfährst Du unter "Prinzipien". -

Bundesregierung Gorbach 1 Von 2
Index IX. GP - Anhang - Bundesregierung Gorbach 1 von 2 7 Bundesregierung Gorbach vom 11. April 1961 bis 27. März 1963 Amtsdauer Bundesministerien Mitglieder der Bundesregierung und Staatssekretäre Ernannt am I Enthoben am **) Bundeskanzler Dr. Alfons Gorbach 27. März 1963 Bundes- 1110 April 1961 kanzleramt Vizekanzler Dr. Bruno **) Pittermann *) 27. März 1963 ) -- - ----- ------- **) Bundes- Bundesminister Dr. Bruno Kreisky 11. April 1961 27. März 1963 ministerium für Auswärtige Staatssekretär **) Angelegenheiten Dr. Ludwig Steiner 11. April 1961 27. März 1963 **) Bundesminister Josef Afritsch 11. April 1961 Bundes- 27. März 1963 ministerium für Inneres Staatssekretär Dr: Otto **) Kranzlmayr 11. April 1961 27. März 1963 . ~~~--~-----_._- Bundes- **) ministerium für Bundesminister Dr. Christian Broda 11. April 1961 27. März 1963 Justiz -- ---- Bundes- Dr. Heinrich 11. April 1961 **) ministerium für Bundesminister 27. März 1963 Unterricht Drimmel Bundes- **) ministerium für Bundesminister Anton Proksch 11. April 1961 27. März 1963 soziale Verwaltung - ---- ---.--- --------- .- Bundes- **) ministerium für Bundesminister Dr. Josef Klaus 11. April 1961 27. März 1963 Finanzen ---- - -- ------ Bundes- **) ministerium für Bundesminister Dipl.-Ing. Eduard 11. April 1961 Land- und Forst- Hartmann 27. März 1963 wirtschaft ---- --- -~-- - -_. *) Mit Entschließung des Bundespräsidenten vom 11. April 1961, BGBl. Nr. 96, wurde Vizekanzler Dr. Pittermann mit der sachlichen Leitung bestimmter zum Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes gehören• der Angelegenheiten gemäß Art. 77 Abs. 3 B.-VG. betraut. **) Die Bundesregierung wurde auf Grund ihrer Demission nach der Nationalratswahl (18. 11. 1962) vom Bundespräsidenten am 20. 11. 1962 vom Amte enthoben; gleichzeitig wurden die Mitglieder der Bundes regierung mit der Fortführung der von ihnen bisher innegehabten Ämter und der bisherige Bundeskanzler mit dem Vorsitz in der einstweiligen Bundesregierung betraut sowie die biSherigen Staatssekretäre wiederernannt ("Wiener Zeitung" Nr. -

Building an Unwanted Nation: the Anglo-American Partnership and Austrian Proponents of a Separate Nationhood, 1918-1934
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Carolina Digital Repository BUILDING AN UNWANTED NATION: THE ANGLO-AMERICAN PARTNERSHIP AND AUSTRIAN PROPONENTS OF A SEPARATE NATIONHOOD, 1918-1934 Kevin Mason A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of PhD in the Department of History. Chapel Hill 2007 Approved by: Advisor: Dr. Christopher Browning Reader: Dr. Konrad Jarausch Reader: Dr. Lloyd Kramer Reader: Dr. Michael Hunt Reader: Dr. Terence McIntosh ©2007 Kevin Mason ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Kevin Mason: Building an Unwanted Nation: The Anglo-American Partnership and Austrian Proponents of a Separate Nationhood, 1918-1934 (Under the direction of Dr. Christopher Browning) This project focuses on American and British economic, diplomatic, and cultural ties with Austria, and particularly with internal proponents of Austrian independence. Primarily through loans to build up the economy and diplomatic pressure, the United States and Great Britain helped to maintain an independent Austrian state and prevent an Anschluss or union with Germany from 1918 to 1934. In addition, this study examines the minority of Austrians who opposed an Anschluss . The three main groups of Austrians that supported independence were the Christian Social Party, monarchists, and some industries and industrialists. These Austrian nationalists cooperated with the Americans and British in sustaining an unwilling Austrian nation. Ultimately, the global depression weakened American and British capacity to practice dollar and pound diplomacy, and the popular appeal of Hitler combined with Nazi Germany’s aggression led to the realization of the Anschluss . -

Wolfgang Schüssel – Bundeskanzler Regierungsstil Und Führungsverhalten“
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit: „Wolfgang Schüssel – Bundeskanzler Regierungsstil und Führungsverhalten“ Wahrnehmungen, Sichtweisen und Attributionen des inneren Führungszirkels der Österreichischen Volkspartei Verfasser: Mag. Martin Prikoszovich angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 300 Studienrichtung lt. Studienblatt: Politikwissenschaft Betreuer: Univ.-Doz. Dr. Johann Wimmer Persönliche Erklärung Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende schriftliche Arbeit selbstständig verfertigt habe und dass die verwendete Literatur bzw. die verwendeten Quellen von mir korrekt und in nachprüfbarer Weise zitiert worden sind. Mir ist bewusst, dass ich bei einem Verstoß gegen diese Regeln mit Konsequenzen zu rechnen habe. Mag. Martin Prikoszovich Wien, am __________ ______________________________ Datum Unterschrift 2 Inhaltsverzeichnis 1 Danksagung 5 2 Einleitung 6 2.1 Gegenstand der Arbeit 6 2.2. Wissenschaftliches Erkenntnisinteresse und zentrale Forschungsfrage 7 3 Politische Führung im geschichtlichen Kontext 8 3.1 Antike (Platon, Aristoteles, Demosthenes) 9 3.2 Niccolò Machiavelli 10 4 Strukturmerkmale des Regierens 10 4.1 Verhandlungs- und Wettbewerbsdemokratie 12 4.2 Konsensdemokratie/Konkordanzdemokratie/Proporzdemokratie 15 4.3 Konfliktdemokratie/Konkurrenzdemokratie 16 4.4 Kanzlerdemokratie 18 4.4.1 Bundeskanzler Deutschland vs. Bundeskanzler Österreich 18 4.4.1.1 Der österreichische Bundeskanzler 18 4.4.1.2. Der Bundeskanzler in Deutschland 19 4.5 Parteiendemokratie 21 4.6 Koalitionsdemokratie 23 4.7 Mediendemokratie 23 5 Politische Führung und Regierungsstil 26 5.1 Zusammenfassung und Ausblick 35 6 Die Österreichische Volkspartei 35 6.1 Die Struktur der ÖVP 36 6.1.1. Der Wirtschaftsbund 37 6.1.2. -

Global Austria Austria’S Place in Europe and the World
Global Austria Austria’s Place in Europe and the World Günter Bischof, Fritz Plasser (Eds.) Anton Pelinka, Alexander Smith, Guest Editors CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | Volume 20 innsbruck university press Copyright ©2011 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, ED 210, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Book design: Lindsay Maples Cover cartoon by Ironimus (1992) provided by the archives of Die Presse in Vienna and permission to publish granted by Gustav Peichl. Published in North America by Published in Europe by University of New Orleans Press Innsbruck University Press ISBN 978-1-60801-062-2 ISBN 978-3-9028112-0-2 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Bill Lavender Lindsay Maples University of New Orleans University of New Orleans Executive Editors Klaus Frantz, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Helmut Konrad Universität Graz Universität -

„Österreich Ist Frei !“
„Österreich ist frei !“ Der österreichische Staatsvertrag 1955 Ein Unterrichtsleitfaden Die Schlacht um Österreich Am 29. März 1945, Gründonnerstag, überschreiten alliierte Verbände erstmals die heutige österreichische Grenze im mittleren Burgenland. Es sind Verbände der Roten Armee (3. Ukrainische Front) unter Marschall Fjodor I. Tolbuchin. In ihrem Gepäck: Flugblätter, in denen sie sich zu „Befreiern“ vom NS-Regime erklären und Bezüge zur Moskauer Deklaration von 1943 herstellen. Die militärische Zangenbewegung der Roten Armee geht in Richtung Wien (Schlacht um Wien 6.–13. April 1945). Zu Ostern stehen sowjetische Truppen schon 30 Kilometer vor Graz. Schwere Kämpfe in der Oststeiermark, im „Jogl- land“ und in Niederösterreich bis Kriegsende. DER EHEMALIGE STAATS- KANZLER KARL RENNER WIRD VON DEN SOWJETS IM AUFTRAG STALINS GESUCHT. ER NIMMT ZUGLEICH VON SICH AUS MIT IHNEN KONTAKT AUF; RENNER Kämpfe in Wien, WIRD ZUR SCHLÜSSELFIGUR DER an der Badner- WIEDERERRICHTUNG DER Bahn, April 1945 ZWEITEN REPUBLIK. © Votava Die Moskauer Deklaration vom 31. Oktober 1943: „Die Regierungen des Vereinigten Königreiches, der Sowjetunion und der Ver- einigten Staaten von Amerika sind darin einer Meinung, daß Österreich, das erste freie Land, das der typischen Angriffspolitik Hitlers zum Opfer fallen sollte, von deutscher Herrschaft befreit werden soll. Sie betrachten die Besetzung Österreichs durch Deutschland am 15. März 1938 als null und nichtig. Sie betrachten sich durch keinerlei Änderungen, die in Österreich seit diesem Zeitpunkt durchgeführt wurden, als irgendwie ge- bunden. Sie erklären, daß sie wünschen, ein freies unabhängiges Österreich wiederhergestellt zu sehen und dadurch ebensosehr den Österreichern selbst wie den Nachbarstaaten, die sich ähnlichen Problemen gegenübergestellt sehen werden, die Bahn zu ebnen, auf der sie die politische und wirtschaft- liche Sicherheit finden können, die die einzige Grundlage für einen dauernden Frieden ist. -

Postwar Austria and the Jewish Refugees. the Role of the Exile Studies in Coming to Terms with the Past
Demokratiezentrum Wien Onlinequelle: www.demokratiezentrum.org source: Unpublished manuscript, Vienna/Lubbock, TX 2004. Sonja Niederacher Postwar Austria and the Jewish Refugees. The Role of the Exile Studies in coming to Terms with the Past In this paper I am going to give an outline of the development of Austrian politics and society. I am focusing on how Austria has dealt with its National Socialist past from the postwar era until today and I am comparing this to the history of Exile Studies. Exile Studies is the discipline that explores the forced emigration of people, mostly Jews, who were persecuted by the Nazis. Unlike Germany where Nazi oppression rose gradually from 1933 onwards, the ‘Anschluss’ Austria’s to the German Reich in March 1938 came all of a sudden over the Jewish community. Approximately 120,000 out of 180,000 people were lucky enough to be able to escape the Nazi persecution in Vienna. The persecution was so brutal that Vienna gathered the status of a Model-city within the German Reich.1 And it affected not only Jews but also political activists, Communists and Social Democrats as well as members and supporters of the Dollfuss and Schuschnigg governments. Some were both, Jewish and political opponents, which put them into even greater danger.2 Most of them fled first to other European countries, to Great Britain, France or the Scandinavia. As the Germans succeeded to occupy big parts of Europe, the refugees had to get overseas, above all to the United States, Latin America, and Palestine. In most countries of Exile, intellectuals, artists and politicians among the refugees built up organizations in order to support their compatriots and also to set a political signal of opposition against Nazi-oppression. -

Curriculum Vitae of Mr. Franz KARASEK
COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS Strasbourg, 17 January 1984 Restricted CM(83)181 CMD001964 Addendum ELECTION OF THE SECRETARY GENERAL Letter from the Permanent Representative of Austria Addendum: Curriculum Vitae of Mr. Franz KARASEK 83.235 02.2 CM(83)181 - 2 - Addendum CURRICULUM VITAE of Mr. Franz KARASEK Born on 22 April 1924 in Vienna; married to Gertrud (n§e Hnolik); 2 children Languages: French, English, Russian Law studies at the University of Vienna (Doctor of Law); International law studies in Paris 1950 Appointment to the Ministry for Foreign Affairs 1952-53 Secretary to Federal Chancellor Leopold Figl 1953-56 Secretary to Federal Chancellor Julius Raab 1956-60 Counsellor at the Austrian Embassy in Paris 1960-64 Counsellor at the Austrian Embassy in Moscow 1964-66 Head of the Private Office of Federal Chancellor Josef Klaus 12OO-/U Director General £01. Fuifeigii Cultural Relations at tuc Federal Ministry of Education 1970-79 Member of Parliament 1970 Member of the Steering Committee of the House of Europe, Vienna 1972 Joint editor of the quarterly journal of economic affairs and contemporary history "Europaische Rundschau", Vienna International duties 1970-72 : Substitute member of the Austrian delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe 1972-79 : Member of the Austrian delegation 1973-74 : Vice-President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe 1974-76 : General Rapporteur of the Political Affairs Committee of the Parliamentary Assembly 1974-79 : Chairman of the Committee on Culture and Education of the Parliamentary Assembly 1970-79 : Member of the Austrian delegation to the United Nations General Assembly 1972-79 : Member of the Austrian delegation to the Inter-Parliamentary Union (1976-79, Chairman of the Committee on Legal, Parliamentary and Human Rights Questions) 1979 : 8 May - was elected Secretary General of the Council of Europe Took up duties on 1 October 1982 : 16 October - was awarded the Robert Schuman Gold Medal. -

Die Haltung Der Berliner Universität Im Nationalsozialismus
Bei seiner Berufung an die Universität Stockholm 1948 hielt der Slavist Max Vasmer (1886 - 1962) einen Vortrag über „Die Haltung der Berliner Universi- tät“ im Nationalsozialismus. Das politische Porträt von Universität und Preu- ßischer Akademie der Wissenschaften aus der Sicht eines Mitbeteiligten, aber keines Nationalsozialisten, ist – neben dem Bericht des emigrierten Bonner Orientalisten Paul Kahle 1940 – das bislang einzige bekannte Dokument sei- ner Art von einem Ordinarius jener Zeit. Die hier erstmals veröffentlichte Rede führt das Verhalten der Berliner Professorenschaft im Nationalsozialis- Marie-Luise Bott mus zurück auf deren politisches Profil vor 1933 und mündet zuletzt in eine Die Haltung der Berliner Universität im ethische Kategorisierung, womit sie Möglichkeiten des Widerstandes in den Blick nimmt. Neues aus der Geschichte der HU Nationalsozialismus. Max Vasmers Rückschau 1948 Bott: Max Vasmers Rückschau 1948 Bild Rückseite: Reichsführer der Deutschen Studentenschaft Andreas Feickert auf Neues aus der Geschichte der dem Balkon der Berliner Universität 1935 Humboldt-Universität zu Berlin Vorderseite: Schlafender Benutzer in der Preußischen Staatsbibliothek Berlin 1936 Band 1 Berlin 2009 | ISBN 978-3-9813135-6-7 Band 1 Marie-Luise Bott Die Haltung der Berliner Universität im Nationalsozialismus. Max Vasmers Rückschau 1948 Neues aus der Geschichte der Humboldt-Universität zu Berlin 1 Neues aus der Geschichte der Humboldt-Universität zu Berlin Band 1 Marie-Luise Bott: Die Haltung der Berliner Universität im Nationalsozialismus. -
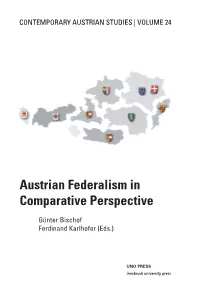
Austrian Federalism in Comparative Perspective
CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | VOLUME 24 Bischof, Karlhofer (Eds.), Williamson (Guest Ed.) • 1914: Aus tria-Hungary, the Origins, and the First Year of World War I War of World the Origins, and First Year tria-Hungary, Austrian Federalism in Comparative Perspective Günter Bischof AustrianFerdinand Federalism Karlhofer (Eds.) in Comparative Perspective Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer (Eds.) UNO UNO PRESS innsbruck university press UNO PRESS innsbruck university press Austrian Federalism in ŽŵƉĂƌĂƟǀĞWĞƌƐƉĞĐƟǀĞ Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | VOLUME 24 UNO PRESS innsbruck university press Copyright © 2015 by University of New Orleans Press All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage nd retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive. New Orleans, LA, 70148, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America Book design by Allison Reu and Alex Dimeff Cover photo © Parlamentsdirektion Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press by Innsbruck University Press ISBN: 9781608011124 ISBN: 9783902936691 UNO PRESS Publication of this volume has been made possible through generous grants from the the Federal Ministry for Europe, Integration, and Foreign Affairs in Vienna through the Austrian Cultural Forum in New York, as well as the Federal Ministry of Economics, Science, and Research through the Austrian Academic Exchange Service (ÖAAD). The Austrian Marshall Plan Anniversary Foundation in Vienna has been very generous in supporting Center Austria: The Austrian Marshall Plan Center for European Studies at the University of New Orleans and its publications series.