Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Operetta After the Habsburg Empire by Ulrike Petersen a Dissertation
Operetta after the Habsburg Empire by Ulrike Petersen A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Music in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in Charge: Professor Richard Taruskin, Chair Professor Mary Ann Smart Professor Elaine Tennant Spring 2013 © 2013 Ulrike Petersen All Rights Reserved Abstract Operetta after the Habsburg Empire by Ulrike Petersen Doctor of Philosophy in Music University of California, Berkeley Professor Richard Taruskin, Chair This thesis discusses the political, social, and cultural impact of operetta in Vienna after the collapse of the Habsburg Empire. As an alternative to the prevailing literature, which has approached this form of musical theater mostly through broad surveys and detailed studies of a handful of well‐known masterpieces, my dissertation presents a montage of loosely connected, previously unconsidered case studies. Each chapter examines one or two highly significant, but radically unfamiliar, moments in the history of operetta during Austria’s five successive political eras in the first half of the twentieth century. Exploring operetta’s importance for the image of Vienna, these vignettes aim to supply new glimpses not only of a seemingly obsolete art form but also of the urban and cultural life of which it was a part. My stories evolve around the following works: Der Millionenonkel (1913), Austria’s first feature‐length motion picture, a collage of the most successful stage roles of a celebrated -

Diplomarbeit
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Der Topos „Musikstadt Wien“ in den Filmen von Willi Forst Analyse der Filme „Wiener Blut“ und „Wiener Mädeln“ Verfasserin: Daniela Burgstaller angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2009 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 316 Studienrichtung lt. Studienblatt: Musikwissenschaft Betreuerin / Betreuer: ao.Univ.Prof. Dr. Margareta Saary Inhaltsverzeichnis Vorwort ............................................................................................................................ 3 1. Musikstadt Wien ......................................................................................................... 5 2. Wiener Film ................................................................................................................. 9 2.1 Definition ................................................................................................................ 9 2.2 Entwicklung .......................................................................................................... 10 2.3 Themen und wichtige Persönlichkeiten ................................................................ 11 3. Willi Forst .................................................................................................................. 13 3.1 Von der Theaterbühne zum Film – Leben und Werk ........................................... 13 3.2 Im Aufsichtsrat der Wien-Film GmbH ................................................................. 16 3.3 Die Filme über Wien ............................................................................................ -

Zur Geschichte Des Kinos in Der NS-Zeit Unter Besonderer Berücksichtigung Des Apollo-Kinos1
Zur Geschichte des Kinos in der NS-Zeit unter besonderer Berücksichtigung des Apollo-Kinos1 Goebbels ging davon aus, dass ein unterhaltsames Medium wie das des Films ein wirkungsvolles Werbemittel wäre, das dem nationalsozialistischen Regime Glamour verleihen sollte. Eine Filmlandschaft, in der die NSDAP und ihre Tagespolitik allgegenwärtig ist, hätte dieses Ziel kaum erreicht. Die offene Propaganda fand ihren Platz in Wochenschauen, Lehr- und Dokumentarfilmen. Im Spielfilm erscheinen die NSDAP und ihre Symbole bzw. Organisationen – wie SA, Hitler-Jugend oder Reichsarbeitsdienst – nur vereinzelt. Selbst die so genannten Propagandafilme politisch linientreuer Regisseure wie Veit Harlan oder Karl Ritter bildeten gegenüber der Flut der mehr oder weniger leichten „Unterhaltungsfilme“ eine Minderheit von weniger als 20 Prozent. Von über 100 Produktionsgesellschaften, die zwischen 1930 und 1932 im republikanischen Deutschen Reich aktiv gewesen waren, blieb 1942 nur noch ein einziges Unternehmen übrig – der staatseigene UFI-Konzern (Ufa-Film GmbH). Kinos Vorgeschrieben war ein Beiprogramm aus Kultur- bzw. Dokumentarfilm und Wochen- schau. Festgelegt war auch, dass an bestimmten Feiertagen ernste Filme gezeigt werden mussten. Ab 1941 durften in deutschen Kinos keine amerikanischen Filme mehr gezeigt werden. Die nationalsozialistische Medienpolitik setzte ganz auf die emotionale Wirkung, die das Ansehen von Spielfilmen und Wochen- schauen in großen, vollbesetzten Kinosälen auf den einzelnen Menschen ausübte. Auch in Kasernen und Betrieben wurden daher Filmprogramme veranstaltet. Das Massenerlebnis verstärkte die Effekte der Propaganda, besonders beim jugendlichen Publikum. Um alle Altersgruppen mit der Filmpropaganda erreichen zu können, wurde mit dem Lichtspielgesetz vom 16. Februar 1934 die bis dahin noch bestehende Altersgrenze von 6 Jahren für Kinobesuche aufgehoben. Der Hitler-Jugend wurden Kinosäle für die so genannten Jugendfilmstunden zur Verfügung gestellt. -

Karin Moser Der Österreichische Werbefilm Werbung – Konsum – Geschichte
Karin Moser Der österreichische Werbefilm Werbung – Konsum – Geschichte Herausgegeben von Karin Moser, Franz X. Eder und Mario Keller Beiräte Reinhild Kreis, Holger Schramm und Guido Zurstiege Band 1 Karin Moser Der österreichische Werbefilm Die Genese eines Genres von seinen Anfängen bis 1938 Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Veröffentlicht mit Unterstützung des Austrian Science Fund (FWF): PUB 684-Z Mit dieser Arbeit liegt der erste Band der Reihe „Werbung – Konsum – Geschichte“ vor. Die peer reviewed Studien werden sich aus geistes-,sozial-,kultur-,kommunikations-und integrativwissenschaftlicher Perspektive den Themenfeldern Werbung, Marketing, Konsum und Material Culture in Geschichte und Gegenwart widmen. Das Herausgeberinnen team will mit diesen Publikationen den produktiven, diskursiven und interdisziplinären Austausch befördern und Anstoß zu weiterführenden wissenschaftlichenArbeitenindiesenThemenfelderngeben. ISBN 978-3-11-061896-9 e-ISBN (PDF) 978-3-11-062230-0 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-061914-0 Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz. Weitere Informationen finden Sie unter http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Library of Congress Control Number: 2019943493 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. © 2019 Karin Moser, Publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston. Dieses Buch ist als Open-Access-Publikation verfügbar über www.degruyter.com. Satz: Integra Software Services Pvt. Ltd. Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck Coverabbildung: Der blonde Strumpf (Werbedia 1937, Palmers Archiv) www.degruyter.com Vorwort An die 20 Jahre sind Film, Kino und Fernsehen zentraler Teil meiner Forschungs-, Lehr- und Vermittlungsarbeit. -
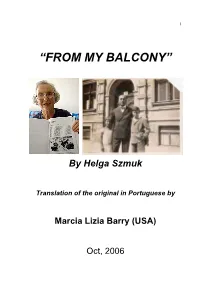
“From My Balcony”
1 “FROM MY BALCONY” By Helga Szmuk Translation of the original in Portuguese by Marcia Lizia Barry (USA) Oct, 2006 2 Introduction Many of my friends and my sons, have been for a long time, telling me to write my memories. I finally decided to take their advice. Why not? After all, they are very dear to me. I took my time though, trying to gather so many deeds of my crazy life of tribulation, which was not very easy considering I am in my 80's. As soon as I had finished the first couple of chapters, I asked them to correct my Portuguese errors. However, not one of them volunteered. Nevertheless, I understand. I know how tedious the work can be. My English students, or even my astronomer friends, often ask me to correct their English texts. It is pure suffering. I would rather write the articles all over again (which is handiwork) than correct what is completely wrong. The same applies to my Portuguese; someone else would have to re-write my texts I am sure. My great new friend, Bob Sharp, never told me I should write my memories. Then I sent him a few pages to read and see what he thought of it. Being a Journalist, writing and analyzing texts is what he does every day. He made the corrections in record time and offered to work on the entire book. We met in strange circunstances and at the same time humorous. I wrote to the Newspaper, more specifically to the Department in charge of taking readers' complaints, about the terrible habit of smoking in public places, like Shopping Malls. -

The Austrian Aschenputtel: Empress Elizabeth of Austria As Icon of Austrian National Identity
Trinity College Trinity College Digital Repository Trinity Publications (Newspapers, Yearbooks, The Trinity Papers (2011 - present) Catalogs, etc.) 2013 The Austrian Aschenputtel: Empress Elizabeth of Austria as Icon of Austrian National Identity Caitlin Gura Trinity College Follow this and additional works at: https://digitalrepository.trincoll.edu/trinitypapers Part of the European History Commons Recommended Citation Gura, Caitlin, "The Austrian Aschenputtel: Empress Elizabeth of Austria as Icon of Austrian National Identity". The Trinity Papers (2011 - present) (2013). Trinity College Digital Repository, Hartford, CT. https://digitalrepository.trincoll.edu/trinitypapers/20 The Austrian Aschenputtel: Empress Elizabeth of Austria as Icon of Austrian National Identity Caitlin Gura uring the post-World War II era, the four Allied Powers restored Dsovereignty and established neutrality in the Second Republic of Austria through the State Treaty of 1955. Among other motivations, this policy was designed to thwart any movement to rebuild the pan-German nation. Austria was charged with the task of creating a new identity to make a clear distinction that it is dissimilar from Germany. The new Austrian republic turned its gaze to the golden age of the Hapsburg Imperial Empire as one of the starting points in creating a new historical narrative for the nation. The local film industry seized upon this idea, which resulted in the Kaiserfilm genre. A prominent example of this variety of film is Ernst Marischka’s late 1950s blockbuster movies: the Sissi trilogy. Within the scope of this analysis, I argue how the films ignited a “Sissi phenomenon” which led to a resurgence and transformation of Empress Elisabeth of Austria as a popular cultural icon and a consequential impact on the reconfiguration of Austrian national identity. -

The Museum of Modern Art Celebrates Vienna's Rich
THE MUSEUM OF MODERN ART CELEBRATES VIENNA’S RICH CINEMATIC HISTORY WITH MAJOR COLLABORATIVE EXHIBITION Vienna Unveiled: A City in Cinema Is Held in Conjunction with Carnegie Hall’s Citywide Festival Vienna: City of Dreams, and Features Guest Appearances by VALIE EXPORT and Jem Cohen Vienna Unveiled: A City in Cinema February 27–April 20, 2014 The Roy and Niuta Titus Theaters NEW YORK, January 29, 2014—In honor of the 50th anniversary of the Austrian Film Museum, Vienna, The Museum of Modern Art presents a major collaborative exhibition exploring Vienna as a city both real and mythic throughout the history of cinema. With additional contributions from the Filmarchiv Austria, the exhibition focuses on Austrian and German Jewish émigrés—including Max Ophuls, Erich von Stroheim, and Billy Wilder—as they look back on the city they left behind, as well as an international array of contemporary filmmakers and artists, such as Jem Cohen, VALIE EXPORT, Michael Haneke, Kurt Kren, Stanley Kubrick, Richard Linklater, Nicholas Roeg, and Ulrich Seidl, whose visions of Vienna reveal the powerful hold the city continues to exert over our collective unconscious. Vienna Unveiled: A City in Cinema is organized by Alexander Horwath, Director, Austrian Film Museum, Vienna, and Joshua Siegel, Associate Curator, Department of Film, MoMA, with special thanks to the Österreichische Galerie Belvedere. The exhibition is also held in conjunction with Vienna: City of Dreams, a citywide festival organized by Carnegie Hall. Spanning the late 19th to the early 21st centuries, from historical and romanticized images of the Austro-Hungarian empire to noir-tinged Cold War narratives, and from a breeding ground of anti- Semitism and European Fascism to a present-day center of artistic experimentation and socioeconomic stability, the exhibition features some 70 films. -

Writing with Music: Self-Reflexivity in the Screenplays of Walter Reisch
arts Article Writing with Music: Self-Reflexivity in the Screenplays of Walter Reisch Claus Tieber 1,* and Christina Wintersteller 2 1 Institut für Theater- Film- und Medienwissenschaft, University of Vienna, Althanstraße 14, 1090 Wien, Austria 2 Filmarchiv Austria, Obere Augartenstraße 1e, 1020 Wien, Austria; c.wintersteller@filmarchiv.at * Correspondence: [email protected] Received: 10 October 2019; Accepted: 26 January 2020; Published: 28 January 2020 Abstract: Self-reflexivity is a significant characteristic of Austro-German cinema during the early sound film period, particular in films that revolve around musical topics. Many examples of self-reflexive cinematic instances are connected to music in one way or another. The various ways in which music is integrated in films can produce instances of intertextuality, inter- and transmediality, and self-referentiality. However, instead of relying solely on the analysis of the films in order to interrogate the conception of such scenes, this article examines several screenplays. They include musical instructions and motivations for diegetic musical performances. However, not only music itself, but also music as a subject matter can be found in these screenplays, as part of the dialogue or instructions for the mis-en-scène. The work of Austrian screenwriter and director Walter Reisch (1903–1983) will serve as a case study to discuss various forms of self-reflexivity in the context of genre studies, screenwriting studies and the early sound film. Different forms and categories of self-referential uses of music in Reisch’s work will be examined and contextualized within early sound cinema in Austria and Germany in the 1930s. -

Retrospektive Romy Schneider R E D I E N H C S E Y N I C M S O I P R
Retrospektive Romy Schneider r e d i e n h c S e y N I c m S o I P R A l u z 7 n e t i e b r a h e r D n e d i e b r e d i e n h c S y m o r d n u n o l e D n i a l A , y a r e D s e u q c a J »Ich kann nichts im Leben, Für das große Publikum war Romy Schneider – »un - aber alles auf der Leinwand« sere Romy« – auch immer diese Sissi. Doch die Schau - Dass Romy Schneider zum unsterblichen Mythos ge - spielerin selbst sah das vollkommen anders: »Ich hasse worden ist, liegt auch an ihrem viel zu frühen Tod, über dieses Sissi-Image. Was gebe ich den Menschen den die Presse seinerzeit heftige Spekulationen an - schon, außer immer wieder Sissi. Sissi? Ich bin doch stellte, bis hin zum Verdacht auf Selbstmord. Ganz ähn - längst nicht mehr Sissi, ich war das auch nie. Ich bin lich wie etwa im Fall von Marilyn Monroe oder James eine unglückliche Frau von 42 Jahren und heiße Romy Dean, von Elvis Presley oder Lady Di wurde ihr Tod mys - Schneider.« Das sagte sie 1981, nur ein Jahr vor ihrem tifiziert. Von einem Mythos geht Faszination aus, die Tod. Sie selbst schrieb einmal auf einem ihrer unzähli - Faszination des Unerreichbaren, die Faszination des gen Zettel eine Liste jener Filme auf, die vor ihr selbst Singulären. Und Romy Schneider war, ist singulär. -

Leták Romy Schneider
ŽIVOTNÍ POUTˇ / LEBENSWEG / SA VIE ŽIVOT PRO FILM / EIN LEBEN FÜR DIE Výstava / Ausstellung / Exposition LEINWAND / UNE VIE POUR LE FILM Vernisáž / Vernissage / Vernissage Divadlo / Theater / Théâtre Pouze německy / Nur deutsch / Uniquement en allemand Romy Schneider Österreichisches Theatermuseum & Filmarchiv Austria 11. 10. – 30. 11. 2011 11. 10., 18:00 Praha 1, RKF, Jungmannovo nám. 18 Romy Schneider: Romy Dvě tváře jedné ženy Vstup volný / Eintritt frei / Entrée libre Zwei Gesichter einer Frau / Deux visages d’une femme Česky, německy, francouzsky / Tschechisch, deutsch, französisch / 23. 11., 19:30 Praha 1, Činoherní klub, Ve Smečkách 26 Tchèque, allemand, français Vstup volný / Eintritt frei / Entrée libre do / bis / jusqu'au: 30. 11. Schneider po–pá / Mo–Fr / Lun–Ven: 10–13 h; 14–16 h, České titulky / Tschechische Untertitel / Sous-titré en tchèque kromě českých a rakouských svátků a akcí v RKF / Außer an österreichischen und Režie, scénář a protagonistka / Regie, Stück & Darstellung / tschechischen Feiertagen sowie während Veranstaltungen im ÖKF / Sauf les jours De et avec: Chris Pichler fériés autrichiens et tchèques et lors des manifestations au RKF „V životě nemůžu nic, ale na plátně vše,“ říkávala o sobě Romy Schnei- Romy Schneider (1938–1982) patřila k těm rakouským hercům, der. Chris Pichler prezentuje opravdovou, nespoutanou umělkyni Romy kteří udělali mezinárodní kariéru. Pocházela z divadelnické rodiny: Schneider s respektem a spříz něností duší. Působivé představení, Babička Rosa Albach-Retty byla dvorní herečkou a stejně jako otec během něhož se sama Romy Schneider dostane ke slovu prostřed - Wolf Albach-Retty působila ve vídeňském Burgtheatru. Matka nictvím deníkových zápisků, dopisů, telefonátů a rozhovorů. Magda Schneider, po jejímž boku jako patnáctiletá debutovala, byla filmovou hvězdou třicátých let. -

Titel Kino 2/2001(2 Alternativ)
EXPORT-UNION OF GERMAN CINEMA 2/2001 ”MEDIUM OF ENTERTAINMENT & CULTURAL MESSENGER“ A message from the new Federal Government Commissioner for Cultural Affairs and the Media, Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin GERMAN FILM PRIZE ... and the nominees are … GERMAN BOX OFFICE HIT ”THE EXPERIMENT“ by Oliver Hirschbiegel Kino Moritz Bleibtreu, in ”THE EXPERIMENT“ (photo © SENATOR Christian Berkel FILM) GERMAN CINEMA GERMAN FILMS at the official program of the Directors’ Fortnight Ecce Homo by Mirjam Kubescha World Sales please contact: Confine Film, Munich phone/fax +49-89-13 03 87 66 Directors’ Fortnight: ”Le Cinéma dans tous ses états“ The Films of the Fishes by Helma Sanders-Brahms World Sales please contact: Helma Sanders GmbH, Berlin phone/fax +49-30-2 15 83 44 Cannes Junior Eine Hand voll Gras A Handful of Grass by Roland Suso Richter World Sales: Bavaria Film International, Geiselgasteig phone +49-89-64 99 26 86 · fax +49-89-64 99 37 20 Critics’ Week: Short Film Competition Staplerfahrer Klaus – Der erste Arbeitstag Forklift Driver Klaus – The First Day on the Job by Jörg Wagner, Stefan Prehn World Sales: ShortFilmAgency Hamburg phone +49-40-3 91 06 30 · fax +49-40-39 10 63 20 Critics’ Week: FIPRESCI Discovery of the Year Die Innere Sicherheit The State I Am In by Christian Petzold World Sales: First Hand Films, CH-Bülach phone +41-1-8 62 21 06 · fax +41-1-8 62 21 46 CANNES FILM FESTIVAL Critics’ Week: Short Film Night Forever Flirt: Nijinsky at the Laundromat The Autograph Triumph of the Kiss by Percy Adlon World Sales please contact: Leora -

Copyright by Christelle Georgette Le Faucheur 2012
Copyright by Christelle Georgette Le Faucheur 2012 The Dissertation Committee for Christelle Georgette Le Faucheur Certifies that this is the approved version of the following dissertation: Defining Nazi Film: The Film Press and the German Cinematic Project, 1933-1945 Committee: David Crew, Supervisor Sabine Hake, Co-Supervisor Judith Coffin Joan Neuberger Janet Staiger Defining Nazi Film: The Film Press and the German Cinematic Project, 1933-1945 by Christelle Georgette Le Faucheur, Magister Artium Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin May 2012 Acknowledgements Though the writing of the dissertation is often a solitary endeavor, I could not have completed it without the support of a number of institutions and individuals. I am grateful to the Department of History at the University of Texas at Austin, for its consistent support of my graduate studies. Years of Teaching Assistantships followed by Assistant Instructor positions have allowed me to remain financially afloat, a vital condition for the completion of any dissertation. Grants from the Dora Bonham Memorial Fund and the Centennial Graduate Student Support Fund enabled me to travel to conferences and present the preliminary results of my work, leading to fruitful discussions and great improvements. The Continuing Fellowship supported a year of dissertation writing. Without the help of Marilyn Lehman, Graduate Coordinator, most of this would not have been possible and I am grateful for her help. I must also thank the German Academic Exchange Service, DAAD, for granting me two extensive scholarships which allowed me to travel to Germany.