Gutachten Über Max Und Maria Wutz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
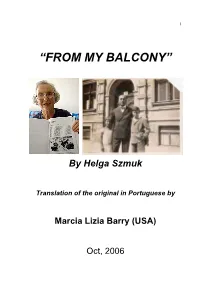
“From My Balcony”
1 “FROM MY BALCONY” By Helga Szmuk Translation of the original in Portuguese by Marcia Lizia Barry (USA) Oct, 2006 2 Introduction Many of my friends and my sons, have been for a long time, telling me to write my memories. I finally decided to take their advice. Why not? After all, they are very dear to me. I took my time though, trying to gather so many deeds of my crazy life of tribulation, which was not very easy considering I am in my 80's. As soon as I had finished the first couple of chapters, I asked them to correct my Portuguese errors. However, not one of them volunteered. Nevertheless, I understand. I know how tedious the work can be. My English students, or even my astronomer friends, often ask me to correct their English texts. It is pure suffering. I would rather write the articles all over again (which is handiwork) than correct what is completely wrong. The same applies to my Portuguese; someone else would have to re-write my texts I am sure. My great new friend, Bob Sharp, never told me I should write my memories. Then I sent him a few pages to read and see what he thought of it. Being a Journalist, writing and analyzing texts is what he does every day. He made the corrections in record time and offered to work on the entire book. We met in strange circunstances and at the same time humorous. I wrote to the Newspaper, more specifically to the Department in charge of taking readers' complaints, about the terrible habit of smoking in public places, like Shopping Malls. -

The Austrian Aschenputtel: Empress Elizabeth of Austria As Icon of Austrian National Identity
Trinity College Trinity College Digital Repository Trinity Publications (Newspapers, Yearbooks, The Trinity Papers (2011 - present) Catalogs, etc.) 2013 The Austrian Aschenputtel: Empress Elizabeth of Austria as Icon of Austrian National Identity Caitlin Gura Trinity College Follow this and additional works at: https://digitalrepository.trincoll.edu/trinitypapers Part of the European History Commons Recommended Citation Gura, Caitlin, "The Austrian Aschenputtel: Empress Elizabeth of Austria as Icon of Austrian National Identity". The Trinity Papers (2011 - present) (2013). Trinity College Digital Repository, Hartford, CT. https://digitalrepository.trincoll.edu/trinitypapers/20 The Austrian Aschenputtel: Empress Elizabeth of Austria as Icon of Austrian National Identity Caitlin Gura uring the post-World War II era, the four Allied Powers restored Dsovereignty and established neutrality in the Second Republic of Austria through the State Treaty of 1955. Among other motivations, this policy was designed to thwart any movement to rebuild the pan-German nation. Austria was charged with the task of creating a new identity to make a clear distinction that it is dissimilar from Germany. The new Austrian republic turned its gaze to the golden age of the Hapsburg Imperial Empire as one of the starting points in creating a new historical narrative for the nation. The local film industry seized upon this idea, which resulted in the Kaiserfilm genre. A prominent example of this variety of film is Ernst Marischka’s late 1950s blockbuster movies: the Sissi trilogy. Within the scope of this analysis, I argue how the films ignited a “Sissi phenomenon” which led to a resurgence and transformation of Empress Elisabeth of Austria as a popular cultural icon and a consequential impact on the reconfiguration of Austrian national identity. -

Retrospektive Romy Schneider R E D I E N H C S E Y N I C M S O I P R
Retrospektive Romy Schneider r e d i e n h c S e y N I c m S o I P R A l u z 7 n e t i e b r a h e r D n e d i e b r e d i e n h c S y m o r d n u n o l e D n i a l A , y a r e D s e u q c a J »Ich kann nichts im Leben, Für das große Publikum war Romy Schneider – »un - aber alles auf der Leinwand« sere Romy« – auch immer diese Sissi. Doch die Schau - Dass Romy Schneider zum unsterblichen Mythos ge - spielerin selbst sah das vollkommen anders: »Ich hasse worden ist, liegt auch an ihrem viel zu frühen Tod, über dieses Sissi-Image. Was gebe ich den Menschen den die Presse seinerzeit heftige Spekulationen an - schon, außer immer wieder Sissi. Sissi? Ich bin doch stellte, bis hin zum Verdacht auf Selbstmord. Ganz ähn - längst nicht mehr Sissi, ich war das auch nie. Ich bin lich wie etwa im Fall von Marilyn Monroe oder James eine unglückliche Frau von 42 Jahren und heiße Romy Dean, von Elvis Presley oder Lady Di wurde ihr Tod mys - Schneider.« Das sagte sie 1981, nur ein Jahr vor ihrem tifiziert. Von einem Mythos geht Faszination aus, die Tod. Sie selbst schrieb einmal auf einem ihrer unzähli - Faszination des Unerreichbaren, die Faszination des gen Zettel eine Liste jener Filme auf, die vor ihr selbst Singulären. Und Romy Schneider war, ist singulär. -

Leták Romy Schneider
ŽIVOTNÍ POUTˇ / LEBENSWEG / SA VIE ŽIVOT PRO FILM / EIN LEBEN FÜR DIE Výstava / Ausstellung / Exposition LEINWAND / UNE VIE POUR LE FILM Vernisáž / Vernissage / Vernissage Divadlo / Theater / Théâtre Pouze německy / Nur deutsch / Uniquement en allemand Romy Schneider Österreichisches Theatermuseum & Filmarchiv Austria 11. 10. – 30. 11. 2011 11. 10., 18:00 Praha 1, RKF, Jungmannovo nám. 18 Romy Schneider: Romy Dvě tváře jedné ženy Vstup volný / Eintritt frei / Entrée libre Zwei Gesichter einer Frau / Deux visages d’une femme Česky, německy, francouzsky / Tschechisch, deutsch, französisch / 23. 11., 19:30 Praha 1, Činoherní klub, Ve Smečkách 26 Tchèque, allemand, français Vstup volný / Eintritt frei / Entrée libre do / bis / jusqu'au: 30. 11. Schneider po–pá / Mo–Fr / Lun–Ven: 10–13 h; 14–16 h, České titulky / Tschechische Untertitel / Sous-titré en tchèque kromě českých a rakouských svátků a akcí v RKF / Außer an österreichischen und Režie, scénář a protagonistka / Regie, Stück & Darstellung / tschechischen Feiertagen sowie während Veranstaltungen im ÖKF / Sauf les jours De et avec: Chris Pichler fériés autrichiens et tchèques et lors des manifestations au RKF „V životě nemůžu nic, ale na plátně vše,“ říkávala o sobě Romy Schnei- Romy Schneider (1938–1982) patřila k těm rakouským hercům, der. Chris Pichler prezentuje opravdovou, nespoutanou umělkyni Romy kteří udělali mezinárodní kariéru. Pocházela z divadelnické rodiny: Schneider s respektem a spříz něností duší. Působivé představení, Babička Rosa Albach-Retty byla dvorní herečkou a stejně jako otec během něhož se sama Romy Schneider dostane ke slovu prostřed - Wolf Albach-Retty působila ve vídeňském Burgtheatru. Matka nictvím deníkových zápisků, dopisů, telefonátů a rozhovorů. Magda Schneider, po jejímž boku jako patnáctiletá debutovala, byla filmovou hvězdou třicátých let. -

Diplomarbeit
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit „Inszenierungen des Wiener Mädels“ Verfasserin Laura Scherwitzl Angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2008 Studienkennzahl: A 317 Studienrichtung: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuerin: Univ.-Prof.Dr. Hilde Haider-Pregler Für meine lieben Eltern Inhalt 1 EINLEITENDE WORTE UND PROBLEMSTELLUNG .................................... 3 2 JUNGE GROßSTADT WIEN ........................................................................... 4 2.1 Entwicklung zur Großstadt .................................................................................... 4 2.2 Frauen(-bilder) der Wiener Moderne .................................................................... 6 2.2.1 Die femme fatale ................................................................................................ 8 2.2.2 Damen der Wiener Gesellschaft ........................................................................ 9 2.2.3 Mode als Ausdruck der Frauenemanzipation .................................................. 10 3 LITERARISCHE GEBURT DES SÜßEN MÄDELS UND DES WIENER MÄDELS ............................................................................................................... 12 3.1 Arthur Schnitzler ................................................................................................... 12 3.1.1 Generationskonflikt ........................................................................................ -

Copyright by Christelle Georgette Le Faucheur 2012
Copyright by Christelle Georgette Le Faucheur 2012 The Dissertation Committee for Christelle Georgette Le Faucheur Certifies that this is the approved version of the following dissertation: Defining Nazi Film: The Film Press and the German Cinematic Project, 1933-1945 Committee: David Crew, Supervisor Sabine Hake, Co-Supervisor Judith Coffin Joan Neuberger Janet Staiger Defining Nazi Film: The Film Press and the German Cinematic Project, 1933-1945 by Christelle Georgette Le Faucheur, Magister Artium Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin May 2012 Acknowledgements Though the writing of the dissertation is often a solitary endeavor, I could not have completed it without the support of a number of institutions and individuals. I am grateful to the Department of History at the University of Texas at Austin, for its consistent support of my graduate studies. Years of Teaching Assistantships followed by Assistant Instructor positions have allowed me to remain financially afloat, a vital condition for the completion of any dissertation. Grants from the Dora Bonham Memorial Fund and the Centennial Graduate Student Support Fund enabled me to travel to conferences and present the preliminary results of my work, leading to fruitful discussions and great improvements. The Continuing Fellowship supported a year of dissertation writing. Without the help of Marilyn Lehman, Graduate Coordinator, most of this would not have been possible and I am grateful for her help. I must also thank the German Academic Exchange Service, DAAD, for granting me two extensive scholarships which allowed me to travel to Germany. -

S Chneider R
Auflage 1/2018 Bahnhof Wir möchten uns hier bei allen Leihgebern und Privatsammle- Berchtesgaden rinnen ganz herzlich Richtung Ramsau/ bedanken, die uns für Richtung ERÖFFUNG Mai 2015 Bischofswiesen diese Ausstellung so Salzburg toll unterstützen. Ein besonderer Dank geht an Frau G. Schu- bert, die uns von An- fang an tatkräftig un- terstützt und uns ei- Richtung nen Teil ihrer Samm- lung überlassen hat. Schönau v.l.Bürgermeister H.Rasp, Martina Klegraefe, Schwester Bernadette, Hans Klegraefe, Künstler Angerer. d .Jüngere Parkplatz chneider Auch Schwester M. Bernadette, einer Königssee kehrt heim Ein Weltstar damaligen Schulfreundin von Romy, Jennerbahn heute Ordensschwester im Internat Goldenstein, sind wir zu großem Romy- S Dank verpflichtet. Original-Kostüme, Schneider- Zeichnungen, Bilder und vieles mehr Ausstellung hat sie uns für die Ausstellung über- lassen. Königssee omy Die begleitende Internetseite und weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie unter: www.romy-schneider-ausstellung.de facebook.com/RomySchneiderAusstellung R Eintrittspreise: AUSSTELLUNG v. l. Schwester M. Bernadette, Berni Zauner, Schwester von Frau Erwachsene. .€ 6.00 direkt am Königssee im „alten Bahnhof“ Wurm, Trude Wurm, Florian Klegraefe, Martina Klegraefe, Frau Ermäßigung. € 5.50 Rasp, Maria Klegraefe, Maria Hutterer, Sylvia Silichner, Tochter/ Enkel v. Frau Rasp, Maria Roider. (Gruppen, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte) Pilat, Seestraße 17 • ✆ +49 (0) 86 52 / 975 65 84 Nicht auf dem Foto: Fr. Engelsberger, Paula Buchner, E.M. Kinder . € 4.00 -

German Actresses of the 2000S – a Study of Female Representation, Acting and Stardom
German Actresses of the 2000s – A Study of Female Representation, Acting and Stardom Verena von Eicken Doctor of Philosophy University of York Theatre, Film and Television September 2014 Abstract This thesis centres on four German actresses active from the year 2000: Nina Hoss, Sandra Hüller, Sibel Kekilli and Diane Kruger. These performers have embodied a range of multifaceted female characters, as well as offering insightful representations of ‛Germanness’ at home and abroad. Their films are emblematic of the revival of German cinema in the 2000s, which has seen the proliferation of commercially successful historical dramas and the emergence of the critically lauded Berlin School art film movement. This research seeks to contribute to German film studies by considering the role actresses have played in the context of the resurging German cinema of the new millennium. The four actresses are discussed both in terms of the female representations offered by their films, and as performers and stars. The films of Nina Hoss, Sandra Hüller and Sibel Kekilli explore the particular social, political and cultural circumstances of women in contemporary Germany, such as the ramifications of reunification and a changing economic order, the persistent female inequality in the workplace and the family, and the nationally specific conception of the mother role. Contributing to the study of film acting and performance, analyses of the four actresses’ performances are conducted to demonstrate how they enhance the films. Analysing and comparing the work of actresses from the 1920s until the present day, a German screen acting tradition is identified that is characterised by the actresses’ maintenance of a critical distance to the character they portray: female performers working across different decades share a stilted, non-naturalistic acting style, which imbues their characters with a sense of mastery and counteracts their frequent experience of oppression or objectification. -

Magische Momente
Seite 6 BERCHTESGADENER ANZEIGER Nr. 222 – Mittwoch, den 25. September 2013 Bücher zu regionalen Themen Am Montag wäre Romy Schneider 75 Jahre alt geworden: Berchtesgadener Landschaftsaufnahmen: Eine Buchvorstellung zum Geburtstag Magische Momente Berchtesgaden – Einen Bild- Anne und Dirk Schiff präsentieren ihr Werk »Romy hautnah« im Hotel »Edelweiß« band mit eindrucksvollen Berchtesgaden – Romy Aufnahmen zeigt der Berch- Schneider, eine der bekann- tesgadener Verlag »editions- testen Schauspielerinnen der nowfish«: »Berchtesgaden – deutschen und europäischen Magische Momente«. Land- Filmgeschichte, hätte am schaftsfotograf Christian Montag, 23. September, ihren Bothner, der Berchtesgaden 75. Geburtstag gefeiert. Die- mehrmals besucht hat, hat sen Tag nahm das Verleger- zahlreiche Natursehenswür- Ehepaar Anne und Dirk Schiff digkeiten fotografiert. Ein aus München zum Anlass, um Euro jedes verkauften Buches ihr neues Werk »Romy haut- kommt den Hochwasserop- nah! Begegnungen« im Hotel fern im Berchtesgadener Land »Edelweiß« vorzustellen. Ne- zugute. ben Zeitzeugen, die aktiv an dem Buch mitwirkten, ließen Bekannte Motive sind dabei, sich auch der Bürgermeister etwa die winterliche Landschaft vom Lockstein aus – samt Ka- von Schönau am Königssee, Magische Momente von Berch- Stefan Kurz, und der Ge- pelle. Magische Momente im Klausbachtal hat er ebenso ein- tesgaden liefert dieser neu er- schäftsführer der BGLT, Ste- schienene Bildband. phan Köhl, die Buchvorstel- gefangen wie den klassischen lung bei schönstem Wetter auf Blick vom Jenner auf den Kö- Foto: editionsnowfish der Dachterrasse nicht entge- nigssee. »Ruhe pur« heißt ein Überhaupt wurden alle hen. Motiv am Hintersee, Sonnenun- tergang, tiefe Schatten. Magi- Aufnahmen des Bildbandes in Rund ein Jahr Recherchear- sche Nächte liefert Christian den frühen Morgenstunden, beit steckt in dem Buch. Anne in der Abenddämmerung Bothner in Berchtesgaden, und Dirk Schiff haben Zeitzeu- oder in tiefer Nacht geschos- wenn er den Nachthimmel mit gen von Romy und Magda sen. -
OÖ. Heimatblätter; 2007 Heft
KULTUR OÖ. HEIMATBLÄTTER 2007 HEFT 1/2 Beiträge zur Oö. Landeskunde I 61. Jahrgang I www.land-oberoesterreich.gv.at 2007 HEFT 1/2 I OÖ. HEIMATBLÄTTER OÖ. 61. Jahrgang 2007 Heft 1/2 Herausgegeben von der Landeskulturdirektion OÖ. KÜNSTLERJUBILÄEN. ANALYSE – DOKUMENTATION – REFLEXION Franz Zamazal: Wilhelm Kienzl und Oberösterreich (Teil I) 3 Ingrid Radauer-Helm: Hebert Ploberger (1902–1977) Eine Spurensuche an Österreichs Bühnen 35 Josef Demmelbauer: Geistesverwandt über Zeiten und Räume Gertrud Fussenegger zum Geburtstag 99 ZEITGESCHICHTE Ernst Kollros: Objekt rechtspolitischer Willkür – Der einmalige Fall des Luxushotels Weinzinger 106 THEMEN AUS DER LANDESKUNDE Klaus Petermayr: Kinderspruch und Kinderlied Zur Überlieferung in Oberösterreich und Salzburg 113 Franz Gillesberger: Eine alte Liederhandschrift im Ebenseer Heimatmuseum 124 Josef Moser: Das Gnadenbild in der Pfarrkirche Ohlsdorf – und Varianten eines Grundmotivs 128 Walter Rieder: Produkt mit einst „tragender Rolle“: Zur Erinnerung an den letzten Holzschuhmacher des Salzkammerguts 133 BUCHBESPRECHUNGEN 139 1 Medieninhaber: Land Oberösterreich Mitarbeiter: Herausgeber: Landeskulturdirektion Dr. Franz Zamazal Zuschriften (Manuskripte, Besprechungsexem- Knabenseminarstraße 33, 4040 Linz plare) und Bestellungen sind zu richten an den Schriftleiter der OÖ. Heimatblätter: Mag. Ingrid Radauer-Helm Camillo Gamnitzer, Landeskulturdirektion, Pro- Uhlplatz 5/33, 1080 Wien menade 37, 4021 Linz, Tel. 0 73 2 / 77 20-1 54 77 HR Dr. Josef Demmelbauer Jahresabonnement (2 Doppelnummern) E 12,– Parkgasse 1, 4910 Ried i. I. (inkl. 10 % MwSt.) HR Dr. Ernst Kollros Hersteller: Druckerei Rudolf Trauner GesmbH & Unterer Markt 5, 4292 Kefermarkt Co KG, Köglstraße 14, 4021 Linz Mag. Dr. Klaus Petermayr Grafische Gestaltung: Mag. art. Herwig Berger, Oö. Volksliedwerk Steingasse 23 a, 4020 Linz Landeskulturzentrum Ursulinenhof Landstraße 31, 4020 Linz Für den Inhalt der einzelnen Beiträge zeichnet der jeweilige Verfasser verantwortlich Dr. -

Franz Marischka Filmproduzent Im Gespräch Mit Kurt Von Daak
BR-ONLINE | Das Online-Angebot des Bayerischen Rundfunks http://www.br-online.de/alpha/forum/vor0201/20020102.shtml Sendung vom 02.01.2002, 20.15 Uhr Franz Marischka Filmproduzent im Gespräch mit Kurt von Daak von Daak: Herzlich willkommen beim Alpha-Forum. Unser heutiger Gast ist Franz Marischka, Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur. Er wurde am 2. Juli 1918 in Wien geboren, emigrierte 1939 nach London und kehrte 1946 als britischer Staatsbürger nach Wien zurück. Er schrieb über 100 Drehbücher, führte Regie bei rund 30 Filmen und ebenso vielen Fernsehspielen und Fernsehserien. Er hat sich jedoch noch nicht zur Ruhe gesetzt. Herr Marischka, was machen Sie heute? Marischka: Ich spiele bei den Seefestspielen in Prien am Chiemsee im "Weißen Rössl" den Kaiser Franz Joseph. Das macht mir irrsinnig viel Spaß und der Gag dabei ist, dass das "Weiße Rössl" 1910 geschrieben worden ist: Damals war der Kaiser Franz Joseph genauso alt wie ich heute, nämlich 83 Jahre alt. Das macht mir wirklich sehr großen Spaß. von Daak: Welcher von Ihren drei Berufen hat Ihnen denn am meisten Spaß gemacht? Marischka: Das kann ich sofort beantworten: das Schreiben. Der Autor ist immer der Glücklichste. Er kann sich alles noch alleine in seinem Kopf vorstellen und sich auch an allem in seinem Manuskript erfreuen. Was dann aber herauskommt, ist jedoch, wie wir wissen, nicht immer das Gleiche. Deswegen habe ich dann später auch selbst Regie geführt: In der Hoffnung, dass ich das, was ich geschrieben habe, auch noch irgendwie umsetzen kann. Aber das Dasein als Autor ist schon das Schönste. Ich schreibe auch heute noch: Ich schreibe noch Drehbücher. -

Michelle Marly Romy Und Der Weg Nach Paris
MICHELLE MARLY ROMY UND DER WEG NACH PARIS MICHELLE MARLY ROMY UND DER WEG NACH PARIS Roman ISBN 978-3-7466-3523-1 Aufb au Taschenbuch ist eine Marke der Aufb au Verlag GmbH & Co. KG 1. Aufl age 2021 © Aufb au Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2021 Satz LVD GmbH, Berlin Druck und Binden CPI books GmbH, Leck, Germany Printed in Germany www.aufb au-verlag.de Drei Menschen haben mein Leben verändert: Alain Delon, Luchino Visconti und Coco Chanel. ROMY SCHNEIDER I. ALAIN DELON KAPITEL 1 PARIS 10. April 1958 Die Air-France-Maschine aus München durchbrach die Wolken- decke über der Île-de-France und gab durch das kleine, runde Fens- ter den Blick auf Wiesen und Ackerflächen frei. Die Dörfer mit den erstaunlich dicht aneinanderlehnenden Gehöften wirkten aus die- ser Höhe so winzig wie die Häuschen in einer Spielzeuglandschaft. Eine steile Kurve, und schon kam die Metropole in Sicht, impo- sante, helle Gebäude mit Schieferdächern, gelegentlich umgeben von Grün, das Stadtbild durchschnitten von einem dunkel schim- mernden Wasserband. Selbst aus dieser Entfernung und trotz des trüben Wetters ließ sich die besondere Atmosphäre erahnen, die seit Jahrzehnten in dem amerikanischen Song »April in Paris« be- sungen wurde. Der Charme des Frühlings schien nur auf die Rei- senden zu warten, und wie fast alle Fluggäste träumte auch Rose- marie Albach von einem Kaffee unter blühenden Bäumen, dem süßen Duft dieses Monats und einer lauen Brise, die sie wie eine Umarmung umfing. Das Lied auf den Lippen, löste sie sich von der Aussicht und betrachtete sich in dem Spiegel der kleinen Puderdose, die sie in Händen hielt.