Flotter Transporter
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

BZ-Opelrekord LP.Pdf
Bewegte Zeiten Peter Kurze • Eckhart Bartels Der Sieg der schönen Linie Delius Klasing Verlag Folgende Bände dieser Reihe sind außerdem im Delius Klasing Verlag erschienen: Bewegte Zeiten Borgward Isabella Bewegte Zeiten DKW-Meisterklasse Bewegte Zeiten Citroën 2 CV – Die Ente Bewegte Zeiten Ford Taunus Bewegte Zeiten Goggomobil Bewegte Zeiten Karmann Ghia Bewegte Zeiten Kleinwagen der Fünfziger Jahre Bewegte Zeiten Lloyd – der Wagen für Dich Bewegte Zeiten Mercedes 190–300 SE Bewegte Zeiten Porsche 356 Bewegte Zeiten Trabant Bewegte Zeiten VW-Käfer Bewegte Zeiten Wartburg 311/312 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 1. Auflage ISBN 978-3-7688-2653-2 © by Delius, Klasing & Co. KG, Bielefeld Einbandgestaltung: Gabriele Engel Layout: Gabriele Engel und Peter Kurze Druck: Kunst- und Werbedruck, Bad Oeynhausen Printed in Germany 2009 Alle Rechte vorbehalten! Ohne ausdrückliche Erlaubnis des Verlages darf das Werk, auch nicht Teile daraus, weder reproduziert, übertragen noch kopiert werden, wie z. B. manuell oder mithilfe elektronischer und mechanischer Systeme inklusive Fotokopieren, Bandaufzeichnung und Datenspeicherung. Delius Klasing Verlag, Siekerwall 21, D-33602 Bielefeld Tel.: 0521/559-0, Fax: 0521/559-115 E-Mail: [email protected] www.delius-klasing.de Aufbau nach dem Krieg Durch den Zweiten Weltkrieg werden in Rüsselsheim über 47 Prozent der Werksanlagen und Gebäude zerstört oder schwer beschädigt. Eine Wie- deraufnahme der Produktion erscheint unmöglich. Man beginnt mit Auf- räumarbeiten und ersten Werkstattaufträgen für die US Army. Dann die Enttäuschung: Die Alliierten verfügen den Abtransport der kompletten Kadett-Fertigungsanlagen in die Sowjetunion, als Reparationsleistung. -

Isabella-Klassik 2021-2
Isabella Klassik Inklusive der Club-Mitteilungen von: BORGWARD-CLUB e. V. Digitales Magazin für Liebhaber historischer Borgward-Fahrzeuge · Ausgabe II/2021 Carl F. W. Borgward IG e. V. mit Sitz in Bremen Peter Kurze Herausgeber Borgward in der Krise, die Geschichte einer misslungenen Sanierung · 3 Isabella Straßenlage · Teil 2 · 24 Liebe Leser, herzlichen Dank für Ihre vielen Zuschriften, die voller Lob für die Technik Octane ...................................................................................................................11 1. Ausgabe waren, weitere Themen-Vorschläge beinhalteten und Museum: Richtung Norden und dann immer geradeaus .................13 die besten Wünsche für die Zukunft enthielten. Straßenlage der Isabella · Teil II ...................................................................24 Termine .................................................................................................................39 Die Zukunft ist der Knackpunkt. Die kostenlose Isabella Klassik Mipa Protector · Ein hochfester Acryl-Lack .............................................30 wird nur existieren können, wenn die Kosten durch verkaufte Test Multiöle .......................................................................................................30 Clubmitteilungen Anzeigen gedeckt werden. Da helfen die Clubs mit ihren Seiten Wundermittel Bremsenreiniger ...................................................................30 und die Unternehmen mit ihren Anzeigen. Das ist neudeutsch eine Werkzeug: Nietmutternknarre .....................................................................32 -

I Cmotof K La S S Ik
usgeprägte Persönlichkeiten waren sie m it unverwech I cMotof A selbarem Aussehen - die klassischen Automobile früherer Zeiten. Thiummobile wie der V 8. die Isabella oder das Glas Coup*, aber auch die Corvette, das Daytona K l a s s i k Coup* oder Sprite M k I. otor Klassik läßt die motorisierte Vergangenheit M wieder lebendige Gegenwart werden. In jeder Ausgabe von neuem ... Motor Klassik. Eine Klasse für sich. otor Klassik erhalten Sie überall im /.eitschriften- M handel. Jeden Monat O d e r S ie abonnieren stehendem Coupon. Abonnement-Bestellschein! Straße. Nr. Ich möchte M otor Klassik abonnieren Der Abonnements-Preis beträgt DM 55,80 incl. Porto und MwSt. (Ausland DM 65,40 incl. Porto). Sie erhallen dann 12 Hefte zum Preis von II Motor Klassik erscheint jeden Monat Bitte kreuzen Sie die gewünschte Zahlungsweise an □ Bankeinzug. Die Bankeinzugsermachtigung erlischt mit Kündigung des Abonnements Unterschrift Datum W ichtige rechtliche Garantie: M ir ist bekannt, daß ich innerhalb von 10 Tagen nach Erhall des Heftes von diesem Vertrag zurucklreten kann Hierzu genügt eine kurze schriftliche Mitteilung Kontonummer an den Verlag Von dieser Garantie habe ich Kenntnis genommen und bestätige dies durch meine zweite Unterschrift Bankleitzahl □ Überweisung. Bitte kein Geld einsenden. Rechnung abwarten. Datum, rechtsverbindliche Unterschrift Coupon bitte einsenden an Vor- und Zuname Vereinigte Motor-Verlage GmbH * Ce. KG - Abonnement-Abteilung - Postfach 1042.7000 Stuttgart I t-c/ fz c z j& Borgward—Goliath-Lloyd DER RHOMBUS Mitteilungsblatt der BORGWARD Interessengemeinschait Herausgeber: Borgward-Interessen^emeinschaft Hartmut Loges, Paul-Goerens-Str. 30 D 4300 Essen 1 T e l. 0201/701165 R e d a k tio n : Hartmut Loges Clubleitung: Hartmut Loges Vertretung: Ulrich Kotte, Saatweide 16, 4236 Hamminkeln-Ringenberg T e l. -

2 - 2018 Organisation
2 - 2018 Organisation 1. Vorsitzender: Clubanschrift 2. Vorsitzender Johannes Herrmann Gottfried Schwaner Lerchenhain 86 Richtweg 33 48301 Nottuln 52511 Geilenkirchen 02502 8497 0177 7710871 02451/ 72483 [email protected] [email protected] Kassenwart: Schriftführerin Ersatzteilwart Klaus Schink Christa Elsaesser Friedrich Helfer Engelnkamp 32 Serrester Str.8 Pappelweg 20 48282 Emsdetten 52428 Jülich 59423 Unna 02572 / 2502 02463/5732 0171/3218333 klaus.schink@lloyd-freunde- [email protected]@lloyd-freunde-ig. ig.com ig.com com Impressum, weitere Kon- takte und Informationen drittletzte Seite des Heftes Technischer Leiter Redaktion FmL Heinz Dröse Jochen Fröhlich Bahnhofstr. 68, 27616 Stubben Robert-Bunsen-Str. 25 28357 Tel/Fax 04748/2367 Bremen heinz.droese@lloyd-freunde- 0421 2053137 u. 0176 55128359 ig.com jochen.froehlich@lloyd-freunde-ig. com Ehrenvorsitzender Karl-Heinz Baedecker Liebe Lloyd Freundinnen-/freunde Jetzt ist auch das Jahrestreffen schon wieder hinter uns, ein sehr gut organisiertes Treffen mit großer Beteiligung. Man kann hier rundhe- rum zufrieden sein, auch das Umfeld war sehr schön gewählt. Die Mitgliederentwicklung verläuft auch positiv, seit langem haben wir wieder die 400er Marke geknackt. Die Vorbereitung für das nächste Jahrestreffen läuft an, leider ist bis- her noch kein „Freiwilliger“ in Sicht, der sich bereit erklärt, das Tref- fen auszurichten. Es wäre schön, wenn wir bis Ende Juni Bescheid wüssten, da wir sonst wieder aus dem Vorstand Vorschläge erarbei- ten müssten. Das Team um Gottfried sollte doch einmal eine Pause bekommen. Immer wieder kommen Anfragen auf uns zu, ob man Werkstätten im Club hat, die sich um Restauration der Lloyds kümmern könnten und auch bezahlbar sind. -
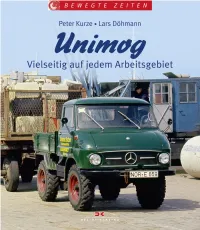
Unimog LP.Pdf
Vielseitig auf jedem Arbeitsgebiet Bewegte Zeiten Peter Kurze • Lars Döhmann Vielseitig auf jedem Arbeitsgebiet Delius Klasing Verlag Folgende Bände der Reihe sind bereits im Delius Klasing Verlag erschienen: Borgward Isabella Mercedes Benz/8 Citroën 2 CV: Die Ente NSU Prinz Citroën DS Opel Ascona DKW-Meisterklasse Opel Rekord Ford Taunus 17 M Porsche 356 Goggomobil Trabant Karmann Ghia VW-Bulli Kleinwagen der Fünfzigerjahre VW-Käfer Lloyd – der Wagen für Dich Wartburg 311/312 Mercedes 190–300 SE Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 1. Auflage 2013 ISBN 978-3-7688-3596-1 © by Delius, Klasing & Co. KG, Bielefeld Lektorat: Klaus Bartelt Layout: Peter Kurze / Gabriele Engel Lithografie: scanlitho.teams, Bielefeld Druck: Print Consult, München Alle Rechte vorbehalten! Ohne ausdrückliche Erlaubnis des Verlages darf das Werk weder komplett noch teilweise reproduziert, übertragen oder kopiert werden, wie z. B. manuell oder mithilfe elektronischer und mechanischer Systeme inklusive Fotokopieren, Bandaufzeichnung und Datenspeicherung. Delius Klasing Verlag, Siekerwall 21, D - 33602 Bielefeld Tel: 0521/559-0, Fax: 0521/559-115 E-Mail: [email protected] www.delius-klasing.de Der Unimog erhält den Mercedes-Stern Die Firmen Boehringer und Erhard & Söhne hatten sich in der Vergangen- heit beim Unimog-Projekt finanziell enorm engagiert. Schon Mitte des Jahres 1950 stieß man in Göppingen bei Boehringer an die Grenzen der Finanz- und Kapazitätsdecke. Den guten Verkaufserfolgen und den Markt- chancen sollte aber mit einer Ausweitung der Produktion Rechnung getra- gen werden. Die beiden schwäbischen Firmen waren nicht in der Lage, ge- nügend Unimog zu produzieren. -

News 2011 25.01.2011 10:48 Uhr Seite 2
News 2011 25.01.2011 10:48 Uhr Seite 2 ® ® 2011 NEW RELEASES NEUHEITEN NOUVEAUTÉ News 2011 25.01.2011 10:49 Uhr Seite 3 Bubmobile 1:87 05728 Feb. Haflinger, orange – Limited Edition 1000 – 05729 May Haflinger-Set – Limited Edition 1000 – Sep. 05550 Pinzgauer, grün / green 05551 Pinzgauer m. Plane, rot / w. canvas, red – Limited Edition 1000 each – 2011 – FAIR OY – T 05552 Sep. 05778 Feb. 05779 Feb. Pinzgauer mit Koffer, grau / w. box, grey Unimog 406 Bundeswehr / military Unimog 406 „Toy Fair Express 2011“ – Limited Edition 1000 – – Limited Edition 1000 – – Limited Edition 1000 – 06518 Feb. 08776 Mar. VW T1, Hänger / trailer, VW Beetle ‘60 „Service“ VW T2 Camping, grün / green – Limited Edition 1000 – – Limited Edition 1000 – 09353 May 09302 Feb. BUBmobil Mustang GT350, rot / red F100, Hänger / trailer, Porsche 356 „Club Race“ – Limited Edition 1000 – – Limited Edition 1000 – - 2 - News 2011 25.01.2011 10:49 Uhr Seite 4 ® 06002 Feb. 08804 Mar. 06052 Mar. VW Käfer ‘49, grau / VW Beetle ‘49, grey VW Golf GTI, silber / silver VW T1 / BMW Isetta „Service“ – Limited Edition 1000 – – Limited Edition 1000 – – Limited Edition 1000 – 05752 Feb. 06306 Feb. 06252 Mar. BMW 328 Roadster, schwarz / black Porsche 356B T5 Coupé, grau / grey Wartburg 311 Coupé / Eriba-Puck – Limited Edition 1000 – – Limited Edition 1000 – – Limited Edition 1000 – 06704 Apr. 09151 Feb. 09106 Feb. Mercedes-Benz 300 SL, grau / grey Mini Van, grün / green MINI Cooper S, gelb-schwarz / yellow-black – Limited Edition 1000 – – Limited Edition 1000 – – Limited Edition 1000 – 08203 May 09107 Feb. Typ 64 „Berlin-Rom“, grün / green MINI Cooper S „Universa“ – Limited Edition 1000 – – Limited Edition 500 – 07801 May Set „BUB-Job“ – Limited Edition 1000 – - 3- News 2011 25.01.2011 10:49 Uhr Seite 5 ® Bubmobile 1:87 Abb. -

Komfort Und Klasse
BEWEGTE ZEITEN Peter Kurze • Halwart Schrader Komfort und Klasse Delius Klasing Verlag Folgende Bände der Reihe sind bereits im Delius Klasing Verlag erschienen: Borgward Isabella Mercedes-Benz/8 Citroën 2 CV: Die Ente NSU Prinz Citroën DS Opel Ascona DKW-Meisterklasse Opel Rekord Ford Taunus 17 M Porsche 356 Goggomobil Trabant Karmann Ghia Unimog Kleinwagen der Fünfzigerjahre VW-Bulli Lloyd – der Wagen für Dich VW-Käfer Mercedes 190–300 SE Wartburg 311/312 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. 1. Auflage 2013 ISBN 978-3-7688-3689-0 © by Delius, Klasing & Co. KG, Bielefeld Layout: Peter Kurze / Gabriele Engel Lektorat: Klaus Bartelt Lithografie: scanlitho.teams, Bielefeld Druck: Print Consult, München Alle Rechte vorbehalten! Ohne ausdrückliche Erlaubnis des Verlages darf das Werk weder komplett noch teilweise reproduziert, übertragen oder kopiert werden, wie z. B. manuell oder mithilfe elektronischer und mechanischer Systeme inklusive Fotokopieren, Bandaufzeichnung und Datenspeicherung. Delius Klasing Verlag, Siekerwall 21, D - 33602 Bielefeld Tel: 0521/559-0, Fax: 0521/559-115 E-Mail: [email protected] www.delius-klasing.de 5 Prestige war wieder gefragt Bundeskanzler Konrad Adenauer ent- Die Entwicklung des Automobilwesens hat schon in ihren Anfängen steigt dem Fond eines Mercedes-Benz zwei sich deutlich voneinander abgrenzende Trends erkennen lassen: Die 300. Regierung, Diplomatie sowie Schaffung kleiner, wirtschaftlicher und für »Jedermann« erschwinglicher hochrangige Vertreter der deutschen Fortbewegungsmittel, um den Mobilitätsansprüchen breiter Käufer- Wirtschaft und Industrie zogen den schichten zu entsprechen – und auf der anderen Seite das Bereitstellen Dreihunderter jedem anderen Wagen großer, luxuriöser, mit allem erdenklichen Komfort versehener Fahrzeuge vor (vorhergehende Seite). -

Katalog 2010 Deutsch
® ® 2010 – D – ® ... ein Anspruch setzt Maßstäbe Premium ClassiXXs... von der Passion zur Profession Wenn Sie die Premium ClassiXXs Kollektion 2010 in Händen halten, dann ist dies bereits der neunte Gesamt- katalog unserer im Jahre 2002 gegründeten Firma. Gerade in Zeiten der wirtschaftlichen Krise hat sich unser Grundsatz als richtig erwiesen, dass nicht nur Firmengröße und größtmögliches Wachstum entscheidend sind. Aus diesem Grund ist Premium ClassiXXs nach wie vor komplett eigenfinanziert und somit Banken- und Investorenunabhängig. Dies war im Jahre 2009, einem auch für Premium ClassiXXs nicht einfachen Geschäftsjahr, für uns von großem Vorteil. Um auch in Zukunft die notwendige Unabhängigkeit für die Realisierung unserer Ideen und die unverzichtbare Flexibilität bei der Reaktion auf eventuelle Verände- rungen der Marktgegebenheiten zu erhalten, soll dies auch zukünftig so bleiben. Aufgrund unserer Geburtsjahre 1963 und 1966, aufgewachsen mit den unter- schiedlichsten Spielzeugautos und „gestählt“ durch zahlreiche „Auto-Quartett- schlachten“, wurde uns in einer Zeit des immer stärker werdenden Individual- verkehrs die Vorliebe für die Automobile des 20. Jahrhunderts praktisch in die Wiege gelegt. Deshalb haben wir ganz bestimmte Vorstellungen, wie wir unsere Modelle entwickeln und produzieren – sehen aber auch die Verantwortung unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern gegenüber. Nach langjähriger Berufserfahrung im Spielzeug- und hochwertigen Modellbereich hatten wir uns entschlossen, eigene unverwechselbare Produkte zu kreieren, -

IK-2021-1 Isabella-Klassik
Inklusive der Mitteilungen BORGWARD Freunde Stuttgart Isabella Klassik BORGWARD-CLUB e. V. Digitales Magazin für Liebhaber historischer Borgward-Fahrzeuge · Ausgabe I/2021 Carl F. W. Borgward IG e. V. mit Sitz in Bremen Peter Kurze Herausgeber Liebe Leser, Liebe auf den ersten Blick: Borgward Isabella Combi Borgward Flotte: Zirkus Eldorado die Isabella Klassik (IK) wendet sich an die Liebhaber historischer Borgward-Fahrzeuge� Technik Das breMOBILeum �������������������������������������������������������������������������������������� �7 Harro Hartmann gestorben ��������������������������������������������������������������������� �8 Dieses kostenlose digitale Magazin soll Ihnen nützliche Service- Kupfer-Nickel-Bremsleitungen ��������������������������������������������������������������� �6 Johann Jaxy gestorben ������������������������������������������������������������������������������ �9 Informationen in den Bereichen der Restaurierung und der Nachfertigung von Zier und Blechteilen ��������������������������������������������� �8 Zirkus Eldorado.............................................................................................12 Fahrzeugtechnik bieten� Weitere Artikel beschäftigen sich mit der BORGWARD-lsabella: Straßenlage �������������������������������������������������������21 Nachlese Treffen 2020 Borgward-Club Frankfurt-Würzburg ����20 spannenden Geschichte der Borgward-Gruppe, die zwischen 1930 Der Alleskönner: 3D-Druck ���������������������������������������������������������������������26 Buchbesprechung: Borgward -

Bestellungen
MLK_11_Layout 28.10.2009 14:21 Uhr Seite 1 Der neue MOTORLITERATUR-KATALOG: Die große Auswahl aktueller Auto- und Technikbücher! · Automobilmarken .........................................2 · Automobil allgemein ...................................26 · Autotechnik ................................................29 · Motorsport .................................................31 ° Seite 26 · Motorsport | Marken....................................33 · Motorrad ....................................................35 · Motorrad | Reiseführer.................................39 · Eisenbahn...................................................43 ° Seite 34 · Nutzfahrzeuge & Traktoren ..........................45 · DVDs & Modelle ..........................................49 · Restposten | Sonderangebote .......................50 · Kalender.....................................................55 ° Seite 47 BESTELLUNGEN: Telefon: 0531 708606 · Fax: 0531 708601 e-mail: [email protected] · Internet: www.heel-verlag.de HEEL Verlag GmbH · Gut Pottscheidt · 53639 Königswinter Tel.: 02223 9230-38 · Fax: 02223 9230-13 Redaktionsstand: Oktober 2009 · Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten Lieferung solange Vorrat reicht / Portofreie Lieferung ab E 50,– Bestellwert!* Titel mit „Vorankündigung“ Frühjahr 2010 werden in jedem Fall portofrei nachgeliefert! Lieferzeit ca. 5 bis 7 Arbeitstage. *innerhalb Deutschlands ° Alle Katalogtitel demnächst auch über www.heel-verlag.de online bestellbar! MLK_11_Layout 23.10.2009 14:26 Uhr Seite 2 | Abarth bis Alfa Luciano -

Deutscher Automobil-Veteranen-Club E.V. 4-2020 51
CM_4-2020_24_11_20.qxp_Layout 1 26.11.20 08:42 Seite 1 Deutscher Automobil-Veteranen-Club e.V. 4-2020 51. Jahrgang CM_4-2020_24_11_20.qxp_Layout 1 26.11.20 08:42 Seite 2 CM_4-2020_24_11_20.qxp_Layout 1 26.11.20 08:42 Seite 3 Editorial Liebe DAVC-Mitglieder, liebe Oldtimerfreunde! Meine Verabschiedung im Clubmagazin 3-20 war Nachdem vorsichtige Locke- wohl doch etwas voreilig, Corona hat seine eigenen rungen im Sommer wieder ei- Gesetzmäßigkeiten. nige Aktivitäten wie kleine Treffen, Clubausfahrten und Unsere Präsidiumssitzung und JHV am 31.10. in touristische Veranstaltungen Kassel haben wir noch als Präsensveranstaltung ermöglicht haben, löst derzeit durchführen können. Nach Aufhebung des Beher- die bereits erwartete zweite bergungsverbotes unter dem Hinweis auf geringste Coronawelle eine Vollbrem- Ansteckungsrisiken in Hotels und der Genehmi- sung aus. Bereits geplante gung durch die Hessische Gesundheitsbehörde, Veranstaltungen bis ins Frühjahr 2021 hinein wur- wurde durch das Tagungshotel ein vorbildliches den schon abgesagt. Vorsichtige Hoffnung macht Hygienekonzept umgesetzt. Wir haben mit der JHV die für Ende Dezember, Anfang Januar angekün- noch unsere formalen Aufgaben für 2019/20 erfül- digte beginnende Impfaktion, es könnte damit bis len können, ansonsten wäre es noch zu klären gewe- zum Sommer ein annähernd normales Leben wie- sen, ob in 2021 zwei oder nur eine HV durchgeführt der möglich sein. Lassen wir uns den Optimismus werden müssen. Eine mögliche Verschärfung der nicht nehmen. Der Terminkalender für das 2. Halb- Lage in 2021 konnte ebenfalls nicht ausgeschlossen jahr wird durch viele Terminverschiebungen stark werden. anwachsen, wir haben viel nachzuholen. Ganz nach Leider haben vor der Versammlung die Kandidaten dem Motto, das Leben des DAVC findet in den Lan- für den Vorstand sehr kurzfristig ihr Erscheinen ab- desgruppen statt, werden wir wieder unsere eigenen gesagt und auch kein Einverständnis zur Wahl in Veranstaltungen organisieren. -
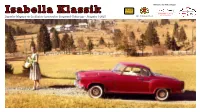
Isabella Klassik · Ausgabe Sommer 2021
Inklusive der Mitteilungen BORGWARD Freunde Stuttgart Isabella Klassik BORGWARD-CLUB e. V. Digitales Magazin für Liebhaber historischer Borgward-Fahrzeuge · Ausgabe I/2021 Carl F. W. Borgward IG e. V. mit Sitz in Bremen Peter Kurze Herausgeber Liebe Leser, Liebe auf den ersten Blick: Borgward Isabella Combi Borgward Flotte: Zirkus Eldorado die Isabella Klassik (IK) wendet sich an die Liebhaber historischer Borgward-Fahrzeuge� Technik Das breMOBILeum �������������������������������������������������������������������������������������� �7 Harro Hartmann gestorben ��������������������������������������������������������������������� �8 Dieses kostenlose digitale Magazin soll Ihnen nützliche Service- Kupfer-Nickel-Bremsleitungen ��������������������������������������������������������������� �6 Johannes Jaxy gestorben �������������������������������������������������������������������������� �9 Informationen in den Bereichen der Restaurierung und der Nachfertigung von Zier und Blechteilen ��������������������������������������������� �8 Zirkus Eldorado.............................................................................................12 Fahrzeugtechnik bieten� Weitere Artikel beschäftigen sich mit der BORGWARD-lsabella: Straßenlage �������������������������������������������������������21 Nachlese Treffen 2020 Borgward-Club Frankfurt-Würzburg ����20 spannenden Geschichte der Borgward-Gruppe, die zwischen 1930 Der Alleskönner: 3D-Druck ���������������������������������������������������������������������26 Buchbesprechung: Borgward