Jahresheft 2009 Vorstand: Redaktion
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Agenda 05.10.2019 Bis 13.10.2019 Highlights
Agenda 05.10.2019 bis 13.10.2019 Highlights Herbstfest Treffpunkt Obersaxen Mundaun Highlights, Brauchtum / Fest, Dies & Das Datum: 5.10.2019, 10:00 - 16:00 Ort: Mehrzweckhalle/Dorfplatz, 7134 Obersaxen Informationen: Treffpunkt Obersaxen Mundaun , Telefon: 0041 81 933 13 77, [email protected], www.treffpunkt-obersaxenmundaun. ch Herbstfest in Obersaxen Mundaun mit Brunch, Markt, Spiel, Spass, Verpflegungsstand, geführtem Rundgang im Steinhauser Zentrum und musikalischer Unterhaltung. Anmeldung zum Brunch bis am 3. Oktober 2019. Highlights, Bühne, Konzert Klassik, Brass Band Sursilvana und Coro Opera Viva Konzert Weitere in Ilanz/Glion Datum: 6.10.2019, 17:00 Ort: Katholische Kirche, Glennerstrasse 5, 7130 Ilanz Informationen: Brass Band Sursilvana, Telefon: 0041 79 2836431 , [email protected], www. bbsursilvana.ch Vorverkauf: www.bbsursilvana.ch Tauchen Sie ein in die Welt der Intrigen und gefährlichen Liebschaften aus zeitlosen Opern, zusammen mit der Brass Band Sursilvana und dem Coro Opera Viva, dem renommierten Opernchor der Opera Viva in Obersaxen. Klassisches Konzert im Safiental Highlights, Konzert Klassik Datum: 6.10.2019, 19:00 Ort: Kirche, 7106 Tenna Kosten: Kollekte Ursula Suter (Panflöte), Hanna Kägi (Violine) und Magdalena Pemberton (Orgel, Klavier und Lyrik) spielen ausgewählte Stücke aus Klassik und Folklore. Highlights, Konzert Konzert – Jugend-Sinfonieorchester Graubünden in Klassik Breil/Brigels Datum: 11.10.2019, 20:00 Ort: Pfarrkirche Brigels, 7165 Breil / Brigels Informationen: Christian Barenius, Telefon: 0041 79 745 36 06, [email protected] Kosten: Kollekte Das diesjährige Orchesterkonzert „la magia della danza“ vereint eine bunte und abwechslungsreiche Zusammenstellung von romantischen Tänzen für Sinfonieorchester, die das Publikum sicherlich von den Stühlen reissen werden. Seite 1 / 20 03.Oktober 2019 Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten powered by Information & Hotel-Reservation: 0041 81 920 11 00, [email protected], www.surselva.info Veranstaltungen 05. -

Federal Councillor Alain Berset and His Meteoric Rise Traditions
THE MAGAZINE FOR THE SWISS ABROAD jANuARy 2012 / NO.1 Federal Councillor Alain Berset and his meteoric rise Traditions: the UNESCO list and Switzerland Iouri Podladtchikov: an incredible talent Glacier Express in the Goms Valley, Valais The magic of panoramic Altitude 4000 If you want to admire an Winter views. exceptional view of around Allow yourself to be captivated by the passing 29 mountain tops reaching peaks of over 4000 meters, landscapes on board Switzerland’s most includingSwitzerland’s famous panoramic train. highest mountain, the Pointe Dufour, a trip to the The Glacier Express links the An unforgettable journey Gornergrat is a must. It can Tip 1 two most important regions Since its first journey in easily be reached by cog- in the Swiss Alps, Valais and 1930, the Glacier Express wheel railway from Zermatt. MySwitzerland.com Graubünden. On board, you has lost none of its magic, Webcode: A41609 will travel through 91 tunnels particularly in Winter. It took and cross 291 bridges be- 50 years before trains were Winter sports tween Zermatt, the home able to run on the impass- The Oberalp Pass in of the Matterhorn, and able mountain section of the Graubünden is transformed St.Moritz, the glamorous Furka in Winter! in Winter into a playground station of the Engadin. In for tobogganing enthusi- its panorama cars, a journey NetworkSwitzerland asts,skiers, snowboarders of over seven hours will seem Register at and hikers. The view of the like just a few minutes, as the MySwitzerland.com/asoby Urseren Valley and the views of nature in Winter are 31 March 2012 and win mountains of the Gotthard Tip 2 so magnificent. -

Masterplan «Rund Um Den Mundaun» Detailgestaltung Und Umsetzung Kurzinformation Gemeinden
Masterplan «Rund um den Mundaun» Detailgestaltung und Umsetzung Kurzinformation Gemeinden 20.06.2017 1 Umsetzung Masterplan Kurzinfo Terminplan Projekte 2017 2018 2019ff. Ausbau Misanenga / Stein, Erschliessung Piz Sezner – Alp Nova – Um Su / Scharls Berg- bahnen Planung und Realisation Beschneiungskonzept Ausbau Gipfelweg Konzeption Grundangebot Bike Realisation Grundangebot Bike Sommer- und Erlebnisangebote: Sommer- und Erlebnisangebote: Planung & Realisation Konzeption Aufbau Infrastrukturgesellschaft Finanzierung Projekte aus Masterplan Gemeinden/ Infrastrukturgesellschaft 20.06.2017 2 Umsetzung Masterplan Kurzinfo Ganzjahres-Projekte ➲ Projekt Sommer- und Erlebnisangebote) ° Überarbeitung der Sommer- und Erlebnisangebote durch Erlebnisplan GmbH ° Konzeptionsphase Juni – September 2017 ° NEU: Integration sämtlicher Interessensgruppen in die Arbeitsgruppe Sommerangebote ➲ Projekt 8: Ausbau Gipfelweg ° Projektierungsphase gestartet ° BAB-Verfahren noch hängig ° Realisierung im Sommer 2018 ➲ Projekt 9: Grundangebot Bike ° Projektierungsphase gestartet ° Machbarkeitsstudie von Trailworks Bau und Planung von Bikestrecken GmbH bis Ende August 2017 vorliegend ° Realisierung 1. Teil im Sommer 2018 20.06.2017 3 Umsetzung Masterplan Kurzinfo Grobkonzept Beschneiung ➲ Aktuell beschneite Achsen im Skigebiet Obersaxen Mundaun ° Ausbau Lumnezia 2008/09 ° Obersaxen / Übergang Lumnezia 2010/11 ° Obersaxen – Meierhof 2015 Vella Triel Piz Sezner Stein Hitzeggen Piz Mundaun Wali Sasolas Kartitscha Cuolm Sura Untermatt Misanenga Valata Meierhof Aktuell -

SWISS REVIEW the Magazine for the Swiss Abroad February 2016
SWISS REVIEW The magazine for the Swiss Abroad February 2016 80 years of Dimitri – an interview with the irrepressible clown February referenda – focus on the second Gotthard tunnel Vaping without nicotine – the e-cigarette becomes a political issue In 2016, the Organisation of the Swiss Abroad celebrates 100 years of service to the Fifth Switzerland. E-Voting, bank relations, consular representation; which combat is the most important to you? Join in the discussions on SwissCommunity.org! connects Swiss people across the world > You can also take part in the discussions at SwissCommunity.org > Register now for free and connect with the world SwissCommunity.org is a network set up by the Organisation of the Swiss Abroad (OSA) SwissCommunity-Partner: Contents Editorial 3 Dear readers 4 Mailbag I hope you have had a good start to the new year. 2016 is a year of anniversaries for us. We will celebrate 25 5 Books years of the Area for the Swiss Abroad in Brunnen this “Eins im Andern” by Monique Schwitter April, then 100 years of the OSA in the summer. Over the course of those 100 years, hundreds of thousands 6 Images of people have emigrated from Switzerland out of ne- Everyday inventions cessity or curiosity, or for professional, family or other reasons. The OSA is there for them as they live out their 8 Focus life stories. Its mission is to support Swiss people living abroad in a variety of Switzerland and the refugee crisis ways. It too is constantly changing. “Swiss Review” has had a new editor-in-chief since the beginning of No- 12 Politics vember. -

A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland
A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland Dr. Liliana Schönberger Contents Abstract .............................................................................................................................. 3 1 Introduction ............................................................................................................. 4 1.1 Light pollution ............................................................................................................. 4 1.1.1 The origins of artificial light ................................................................................ 4 1.1.2 Can light be “pollution”? ...................................................................................... 4 1.1.3 Impacts of light pollution on nature and human health .................................... 6 1.1.4 The efforts to minimize light pollution ............................................................... 7 1.2 Hypotheses .................................................................................................................. 8 2 Methods ................................................................................................................... 9 2.1 Literature review ......................................................................................................... 9 2.2 Spatial analyses ........................................................................................................ 10 3 Results ....................................................................................................................11 -

Fundaziun Da Cultura Lumnezia Jahresbericht 2016
CULTURA EN LUMNEZIA – Fundaziun da cultura Lumnezia Jahresbericht 2016 www.culturalumnezia.ch - [email protected] Fundaziun da cultura Lumnezia – Casa d' Angel – Dado Baselgia 116 – CH-7148 Lumbrein 1 CULTURA EN LUMNEZIA Inhalt 2016 im Überblick 3 Jahresbericht 2016 4 Anhang A: Jahresrechnung 2016 9 Anhang B: cultura en Lumnezia - Jahresprogramm 11 Anhang C: guids da cultura Lumnezia 13 Anhang D: passadis – über alle Berge 14 2 CULTURA EN LUMNEZIA 2016 im Überblick Das Jahr 2016 war vor allem von der ersten in eigener Regie gestaltete Ausstellung in der Casa d'Angel geprägt. Doch auch die anderen Projekte der Fundaziun da cultura Lumnezia (FCL) fangen an sich zu entfalten. Doch auch die Verlängerung des Leistungsvertrages mit der Gemeinde Lumnezia war eine wichtige Anerkennung der bisherigen Leistung. Casa d'Angel : Die kulturhistorische Ausstellung Passadis – über alle Berge von Gastkurator Beat Gugger kam sehr gut bei den Besuchern an, und insgesamt konnten mehr Besucher verzeichnet werden als im Eröffnungsjahr 2015. Ein grosses Veranstaltungsprogramm liess die Nachbarn aus Vals, Hinterrhein, Safien, Obersaxen und Sumvitg in die Casa d'Angel kommen, um von den alten Verbindungen über die Berge hinweg zu erzählen. Cultura en Lumnezia : Die Veranstaltungsreihe der FCL knüpft dieses Jahr eng an die Ausstellung in der Casa d'Angel an. Weitere kleinere Veranstaltungen finden im Winter rund um den Kristall statt oder aber in Café romontsch-Regie. Café romontsch : Im Februar 2016 wurde das Konzept Café romontsch für Romanischlernende und ihre Sprachgottis lanciert. Bis Ende Jahr hat sich eine feste Gruppe von etwa 10 Personen herauskristallisiert, andere kommen hinzu, wenn es ihnen die Zeit erlaubt. -

Agenda 22.08.2020 Bis 30.08.2020 Highlights
Agenda 22.08.2020 bis 30.08.2020 Highlights Konzert: Chiara in Trun Highlights, Konzert Weitere Datum: 22.8.2020, 20:00 - 22:00 Ort: Fundaziun Ogna, Gassa 22, 7166 Trun Kosten: Erwachsene CHF 15.00, Stundenten CHF 10.00, Kinder bis 16 Jahre kostenlos Die Stimme lässt aufhorchen: Dunkel, kraftvoll, etwas rauchig. Wenn Chiara auf Romanisch singt, dann ist das bei aller Frauenpower nicht im entferntesten Girly-Pop. Highlights, Lesung und Vernissage "Unser Knobli wurde ein Stern" in Bühne Vella Datum: 28.8.2020, 19:00 Ort: Biblioteca lumnezia, Palius 33 A, 7144 Vella Informationen: Biblioteca Lumnezia, [email protected], www.unserknobliwurdeeinstern.ch Barbara De Giorgi präsentiert "Unser Knobli wurde ein Stern". Ein Kinderbuch zum Umgang mit Trauer. Pilzkunde Wochenende in Obersaxen Highlights, Dies & Das, Führung Datum: 28.8.2020, 20:00 29.8.2020, 09:00 Ort: Infobüro Meierhof , 7134 Obersaxen Informationen: Surselva Tourismus Info Obersaxen, Telefon: 0041 81 933 22 22, [email protected] Kosten: Erwachsene CHF 70.00, Kinder bis 15 Jahre CHF 30.00 inkl. Mittagessen In diesem Kurs werden Sie in die Pilzwelt eingeführt. Der Kursabend vertieft die Kunst der selbständigen Bestimmung der Pilze. Auf der Exkursion spüren Sie den Pilzen in ihrem Lebensraum nach. Highlights, Konzert Weitere, Konzert Open-air Konzert mit Peter Finc Pop / Rock / Jazz "Soularpower" in Waltensburg Datum: 29.8.2020, 20:15 Ort: Hotel Ucliva, Darums 10, 7158 Waltensburg / Vuorz Informationen: Hotel Ucliva, Telefon: 0041 81 941 22 42, [email protected] Kosten: Kostenlos Peter Finc ist ein Musiker den man schwer in eine Schublade stecken kann. Seine Bandbreite geht von leisen gefühlvollen Klängen bis zu rockigen wilden Songs aus eigener Feder. -

Snow and Avalanche Climatology of Switzerland
Research Collection Doctoral Thesis Snow and avalanche climatology of Switzerland Author(s): Laternser, Martin Christian Publication Date: 2002 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-004304153 Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library Diss. ETH No. 14493 SNOW AND AVALANCHE CLIMATOLOGY OF SWITZERLAND A dissertation submitted to the SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH for the degree of DOCTOR OF NATURAL SCIENCES presented by MARTIN CHRISTIAN LATERNSER dipl. Natw. ETH born July 19, 1966 citizen of Zurich (ZH) accepted on the recommendation of Prof. Dr. Albert Waldvogel, examiner Prof. Dr. Heinz Wanner, co-examiner Dr. Martin Schneebeli, co-examiner 2002 Contents Abstract 5 Kurzfassung 7 1 Introduction 11 2 Climate Trends from Homogeneous Long-Term Snow Data 15 2.1 Introduction .....................................................................................................16 2.2 Data.................................................................................................................17 2.3 Small-scale snow variability and consequences for trend analyses....................22 2.3.1 Apparent climate trend of long-term snow data due to station shifts........22 2.3.2 Assessing the small-scale variability of snow data by comparing neigh- bouring stations ......................................................................................25 -

Entsorgungsplan Plan Da Recicladi
Molok-Standorte Ablieferungszeiten: Täglich 06.00 – 22.00 Uhr (Nachtruhe einhalten!) Abfallart Standorte entsorgung Flond (Sammelstelle) Surcuolm (Sammelstelle) obersaxen Valata (Abzweigung Bergbahnen) Affeier (Sammelstelle Valdunga/Abzweigung Egga) Meierhof (Bushaltestelle) Giraniga (Abzweigung Pilavarda) mundaun recicladi Hauskehricht Canterdü (Abzweigung Tavanasa) St. Martin (bei Restaurant) Miraniga (bei Kapelle) Misanenga (Rufalipark/Abzweigung Panorama/Werkhof Bianchi Bau AG) Flond (Sammelstelle) Affeier (Sammelstelle Valdunga) Surcuolm (Sammelstelle) Miraniga (bei Kapelle) Glas Valata (Abzweigung Bergbahnen) Meierhof (Bushaltestelle) Misanenga (Abzweigung Panorama) Canterdü (Abzweigung Tavanasa) Entsorgungsplan Stahl- und Alubüchsen Affeier (Sammelstelle Valdunga) Sammeltouren Plan da recicladi Abfallart Bereitstellung Sammeltag An den publizierten Sammeltagen in Altkleider, Schuhe, 1 – 2 mal jährlich den dafür verteilten, speziellen Säcken Wird von den Sammelorganisationen publiziert. Lederwaren an der Hauptstrasse deponieren Papier in nicht zu schweren Bündel 2 mal jährlich (Frühjahr und Herbst) (die Schüler danken!) gem. Angaben Papier Wird von der Schule Obersaxen Mundaun publiziert. aus der Publikation bereitstellen Gemeinde Obersaxen Mundaun // Vorstadt 26 // CH-7134 Obersaxen // Tel. +41 (0)81 920 50 80 // Fax +41 (0)81 920 50 81 // [email protected] // www.obersaxenmundaun.swiss Karton in nicht zu schweren Bündel 2 mal jährlich (Frühjahr und Herbst) (die Schüler danken!) gem. Angaben Karton Wird von der Schule -

Selected Biographical Sketches
Swiss American Historical Society Review Volume 40 Number 2 Article 6 6-2004 Selected Biographical Sketches Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review Part of the European History Commons, and the European Languages and Societies Commons Recommended Citation (2004) "Selected Biographical Sketches," Swiss American Historical Society Review: Vol. 40 : No. 2 , Article 6. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review/vol40/iss2/6 This Article is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Swiss American Historical Society Review by an authorized editor of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. et al.: Selected Biographical Sketches SELECTED BIOGRAPHICAL SKETCHES Samuel Strasser Rickly, Columbus The venerable banker, is one of the familiar figures in Columbus and one of the city' s most prominent citizens. He is the son of John and Anna Rickly, nee Strasser, and was born January 2, 1819, in Btitzberg, Canton Bern, Switzerland, where the name was spelled Rickli. He is the only survivor of a family of eighteen children. His grandfathers, on both sides, were extensive grain merchants , doing business during the French Revolution , and his father, although by trade a saddler (at which trade Mr. Rickly was required to work from the time he was 12 or 13 years old), also followed the grain business. His father was postmaster of the parish, and from the time Mr. Rickly was twelve years old until he left Switzerland, he acted as letter carrier, often exposed to great hardships on account of the distance he had to travel. -
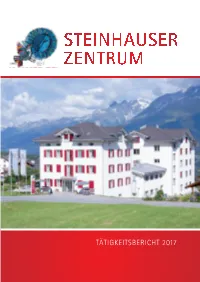
Steinhauser Zentrum
STEINHAUSER ZENTRUM TÄTIGKEITSBERICHT 2017 3 INHALTS- LEITBILD VERZEICHNIS STEINHAUSER ZENTRUM 3 Leitbild Steinhauser Zentrum 4 Impressionen Willkommen im Steinhauser Zentrum Steinhauser- Casanova Stiftung 5 Bericht Präsident Stiftungsrat, Thomas Mirer 6 Bericht aus der Betriebskommission, Josef Nigg WIR SIND ETWAS BESONDERES mögliche Freiheit. In Ihrem letzten Lebensabschnitt pflegen 7 Organigramm Steinhauser-Casanova Stiftung Das Steinhauser Zentrum ist das 2003 erstellte Senioren- wir Sie palliativ und lindern so Ihre Leiden. Sie erhalten bis heim der privatrechtlichen Steinhauser-Casanova Stiftung. zuletzt umfassende und angemessene medizinische Versor- Gelegen in der schönen Walsergemeinde Obersaxen ist es gung. Wir sehen Sinn in einem würdigen Leben. 8 Jahresrechnung Steinhauser-Casanova Stiftung das Zuhause von Betagten, mit öffentlichem Restaurant, Kapelle und kleiner Wellnessoase. Wir bieten verschiedene Als Mieter oder Mieterin können Sie von der zeitgemässen Inf- 11 Bericht der Revisionsstelle Wohn- und Betreuungsformen an: von Alterswohnungen rastruktur und dem vielfältigen Angebot profitieren. Sie erleben über Betreutes Wohnen bis hin zu Pflegewohngruppen. Die uns als zuvorkommenden Ansprechpartner und erhalten bei Be- Aufenthaltsdauer richtet sich nach den Wünschen und dem darf rund um die Uhr Unterstützung. 12 Impressionen Bedarf der Bewohner. Als Angehörige sind Sie uns wichtig und jederzeit herzlich will- Wir sehen uns als Ort der Begegnung, als offenes Haus. Be- kommen. Wir pflegen den Kontakt zu Ihnen und informieren Sie Das Steinhauser Zentrum suchszeiten kennen wir keine. Das Restaurant ermöglicht regelmässig. Kontakte zwischen unseren Bewohnern, unseren Mietern Sind Sie bei uns Gast, geben wir unser Bestes, damit Sie bei uns 14 Bericht der Heimleitung/Leitung Administration, Carmen Rensch und der übrigen Bevölkerung. Spezielle Anlässe bringen Ab- Genuss, Entspannung und gemütliches Beisammensein erleben 15 Personelles wechslung ins tägliche Leben. -

Brigels Waltensburg Andiast Bietet Aber Noch Viel Mehr Suchen Und Buchen Sie Über Ihre Unterkunft, Als Pisten
Winter 2019/20 Hier wartet Ihr Winterglück Inklusive Top Angebote Breil/Brigels, Ilanz/Glion, Lumnezia, Obersaxen Mundaun, Safiental, Trun Informationen und Buchungen Willkommen in «meiner» Surselva In der einmaligen Winterwelt der Surselva bin ich aufgewachsen und Suchen und buchen auf www.surselva.info habe meine Leidenschaft zum Skifahren entdeckt. «Meine» Surselva mit den herrlichen Wintersportregionen Obersaxen Mun daun Val Lumnezia und Brigels Waltensburg Andiast bietet aber noch viel mehr Suchen und buchen Sie über www.surselva.info Ihre Unterkunft, als Pisten. Für mich als Spitzensportler ist die Erholung sehr wichtig. diverse Zusatzleistungen und Pauschalangebote zum besten Preis und Dazu fi nde ich in der Surselva die besten Voraussetzungen. Geniessen ohne Buchungsgebühr. auch Sie die Ruhe und die verschneite Winterlandschaft. Zum Beispiel auf den über 200 km präparierten Winterwanderwegen. Für viel Ab- • Über 40 Hotels und Pensionen (siehe auch Hotelverzeichnis ab Seite 32) wechslung und Spass bei Gross und Klein sorgen rasante Schlittelab- • Zahlreiche Bed & Breakfast-Betriebe fahrten. Alles in einem, kompakt und abwechslungsreich – so ist unse- • Über 300 Ferienwohnungen und Ferienhäuser re Feriendestination Surselva auch im Winter. Die vorliegende Winterbroschüre stellt Ihnen die • Maiensäss-Hütten Vielfalt vor und macht Lust auf einen Besuch bei uns. Falls Sie noch weiter schmökern und • Agrotouristische Betriebe/Bauernhöfe bereits «virtuell» in unsere Feriendestination reisen möchten, besuchen Sie unsere Website: • Berggasthäuser www.surselva.info. • Diverse Pauschalangebote Surselva App: Wir freuen uns auf Sie! • Gruppenunterkünfte Mehr Service für Sie. • Etc. Carlo Janka Olympiasieger, Weltmeister, Gesamt-Weltcup-Sieger (Ski Alpin) Informationen Wir sind telefonisch erreichbar: Montag bis Freitag 08.00 –11.30 Uhr/13.30 –17.00 Uhr Inhaltsverzeichnis Tel.