Beschlussvorlage Status: Öffentlich Datum: 04.03.2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Prima Broschuere Komplett 2021.Indd
GRUSSWORT Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, Hinter uns liegt coronabedingt ein schwieriges Jahr. tätigen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (PSYMA) Grundlegende Informationen zum Thema Gesundheit sind gleichwohl mit der Ärztegenossenschaft PriMa vernetzt und eine psycho- unverändert wichtig und mit dieser Broschüre „Ihre PriMa Ärzte“, die therapeutische Tagesbereitschaft für akute Fälle geschaffen. Mehr 2021 zum 12. Male erscheint, möchten wir Ihnen wieder Hilfestellung dazu in unserer Broschüre. im Alltag geben. Das Hospiznetz Marburg wirkt segens- und erfolgreich bei der PriMa steht für „Prävention in Marburg“. Betreuung schwerstkranker und sterbender Patienten im häuslichen Umfeld in unserem Landkreis. Das Hospizgebäude steht für die Über 350 Ärztinnen und Ärzte haben sich unter diesem Namen stationäre Betreuung von Patienten zur Verfügung. Die Arbeit genossenschaftlich organisiert, um Ihnen – eingebettet in die erfolgt mit den PriMa Ärztinnen und Ärzten Hand in Hand. Mehr Gesundheitsregion Marburg-Biedenkopf – dabei zu helfen, gesund Informationen hierzu finden Sie in der Broschüre. zu bleiben. Uns liegt dabei die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung sowohl in den Städten wie auf dem Land sehr am Mit unserer Patientenverfügung, die gemeinsam mit den Kliniken Herzen. im Landkreis Marburg-Biedenkopf erarbeitet wurde, bieten wir eine Unterstützung, die bereits von vielen Menschen angenommen wurde. Die PriMa eG wurde 2016 als erstes Ärztenetz in Hessen von der Sollten Sie sich näher mit diesem Thema auseinander setzen wollen, Kassenärztlichen Vereinigung Hessen zertifiziert. Hiermit wird so nehmen sich Ihre PriMa Ärztinnen und Ärzte hierzu gerne die Zeit. auch unser ständiges Bemühen um eine reibungslose Abstimmung Sprechen Sie uns an! zwischen Haus- und Fachärzten anerkannt. Im Namen der Kolleginnen und Kollegen der PriMa eG wünschen wir Neben der Vorstellung unserer PriMa Ärztinnen und Ärzte haben Ihnen ein gutes Jahr 2021. -
Jetzt Bestellen 340
11. Vorspeisen 22. Flammkuchen Mittagsangebot (Mo. bis Fr. 11:00 - 14:30 Uhr) * Kid’s Menü che ionale Kü 500. Pizza-Brot mit Knoblauch 2.50€ 400. Flammkuchen Internat 501. Pizza-Brot mit Kräuterbutter 2.50€ Elsässer Art Menü 1 - 5.00€ 502. Pizza-Brot mit Gouda-Käse 2.50€ Creme Fraiche, 6.30€ Pizza ø24cm mit Salami 503. Pizza-Brot mit Tomatensauce 2.50€ Zwiebeln, Speck, + Capri Sonne 504. Pizza-Brot mit Fetakäse 3.00€ Kräuter 505. Portion Maissalat 3.00€ 401. Flammkuchen Mediterana + Überraschungsei 506. Portion Gurkensalat 3.00€ Creme Fraiche, fr. Tomaten, 507. Portion Tomatensalat 3.00€ Fetakäse, Peperoni, Menü 2 - 5.00€ 508. Portion Eisbergsalat 3.00€ Kräuter Pasta mit Tomatensauce 509. Portion Pommes oder Kroketten 2.50€ 402. Flammkuchen Elsässer Art + Capri Sonne 510. Portion Pizzabrötchen Special + Überraschungsei mit Kräuterbutter oder Special-Sauce 3.00€ Creme Fraiche, Zwiebeln, 511. Hamburger 3.00€ Speck, Kräuter, Käse 512. Cheeseburger 3.60€ 403. Flammkuchen Italia Pizza ø30cm + Salat (Nr. 524) 5.50€ 513. Doppelburger 4.20€ Creme Fraiche, fr. Tomaten, Jede Pasta + Salat (Nr. 524) 5.00€ 514. Doppelcheeseburger 4.70€ Basilikum, Mozzarella Jedes Schnitzel + Salat (Nr. 524) 6.00€ 517. Portion Tzatziki 3.00€ 404. Flammkuchen Greece Salat 5.00€ 519. Chicken Nuggets 6 Stück 3.60€ Creme Fraiche, Gyros, Rucola, LIEFERZEITEN: 520. Chicken Nuggets 14 Stück 6.70€ Zwiebeln 521. Chicken Wings 7 Stück 3.60€ 405. Flammkuchen Fresh Dauerangebote (Mo. bis Fr. & Feiertage 14:30 - 23:00 Uhr)* Mo. -Fr. 11.0 0- 23.00 Uhr 522. Chicken Wings 14 Stück 6.70€ Creme Fraiche, Knoblauch, 523. -

Willkommen Im Landkreis Marburg- Biedenkopf
Willkommen im Landkreis Marburg- Biedenkopf Informationen für Flüchtlinge Revision 1 Inhalt 1: Alltag ......................3 11: Gewalt ....................16 Alltag in Deutschland (3) Rassistische Gewalt (16) Vergewaltigung (16) 2: Rechtliche Fragen ..........4 Häusliche Gewalt (17) Beratungsstellen (4) Anwalt / Anwältin (5) 12: Essen ...................... 17 3: Das Asylverfahren .........5 13: Familie/Kind ...............18 Schutz gegen Abschiebung (6) Erziehungsberatung (18) Kirchenasyl (6) Schwangerschaft (18) Kinderbetreuung (19) 4: Wohnen .................... 7 Was ist bei Umzügen zu tun? (7) 14: Günstige 5: Verkehr ....................8 Einkaufsmöglichkeiten ...19 Wie komme ich dahin? (9) Günstige Kleidungsläden (19) Günstige Tickets (9) Günstige Läden für Möbel/Woh- nungseinrichtung (19) 6: Arbeit .....................10 Günstiger Kinderladen (20) Dürfen Sie arbeiten? (10) 15: Arbeit oder Ausbildungsstelle (10) Religion ................... 20 Islam (20) 7: Finanzen ...................11 Evangelische Kirche (20) Schulden (12) Katholische Kirche (21) 8: Deutschkurse ............. 12 Judentum (21) Hilfen zum Deutschlernen (13) 16: Freizeit .................... 21 9: Bildung ................... 13 17: Ehrenamtliche Schule (13) Unterstützung ............22 Deutsche Schulabschlüsse (13) Stadt Marburg (22) Ausbildung (14) Marburg-Biedenkopf (22) Universität (14) Hessen (23) Studium in Marburg (14) Studium in Deutschland (14) Impressum .................23 10: Gesundheit ................14 Hausärzte/Hausärztinnen (15) Notfall (15) Kliniken -

Working Paper No 13
Working Paper No 13 Forum Demokratieforschung Beiträge aus Studium und Lehre Working Paper-Reihe im Fachgebiet Demokratieforschung am Institut für Politikwissenschaft der Philipps-Universität Marburg Working Paper No 13 Bürger_innenbeteiligung in Marburg Bericht der wissenschaftlichen Begleitung zum Prozess der Konzeptentwicklung im Juli 2018 Projektteam „Bürger_innenbeteiligung“ aus den Bachelor- und Masterstudiengängen der Politikwissenschaft am Institut für Politikwissenschaft der Philipps-Universität Marburg Leitung: Ursula Birsl Fabrice Bappert, Mona Schwarz, Julia Closmann, Nikolas Fiekas, Aygün Habibova, Florian Aldinger, Celia Himmel, Caroline Stockmann, Lukas Zittlau Titelbild: Füllhorn von Christel Irmscher (Original: Acryl auf Leinwand 1997) Impressum Forum Demokratieforschung, Working Paper Reihe im Fachgebiet Demokratieforschung Am Institut für Politikwissenschaft an der Philipps-Universität Marburg, Beiträge aus Studium und Lehre Herausgeberinnen: Prof'in Dr. Ursula Birsl, Matti Traußneck (M.A. Politologin) Working Paper No 13 (Juli 2018) ISSN 2197-9491 http://www.uni-marburg.de/fb03/politikwissenschaft/institut/lehrende/birsl/forumdemokratie Kontakt: Prof'in Dr. Ursula Birsl Matti Traußneck Philipps-Universität Marburg Institut für Politikwissenschaft Wilhelm-Röpke-Str. 6G DE-35032 Marburg E-Mail: [email protected] [email protected] Bürger_innebeteiligung in Marburg – die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung im Überblick Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 16. September -

Gesamtevaluation Der Radverkehrskonferenzen 2016
Impressum Herausgeber: Landkreis Marburg-Biedenkopf, Im Lichtenholz 60, 35043 Marburg, www.marburg-biedenkopf.de Zusammenstellung: Fachbereich Büro der Landrätin, Fachdienst Bürgerbeteiligung, Ideen- und Beschwerdemanagement Kontakt: Ruth Glörfeld (Fachdienstleiterin), Telefon 06421 405-1212 Daniela Deuermeier, Telefon 06421 405-1518 Jonas Becker, Telefon 06421 405-1447 E-Mail: [email protected] Web: www.mein-marburg-biedenkopf.de Marburg, Oktober 2016 Was braucht es, um im Alltag öfter aufs Rad zu steigen? Etwa wenn es darum geht, den Betrieb, die Schule oder auch den Supermarkt zu erreichen. Wie steht es um die Sicherheit und auch den Service? Welche Infrastruktur können wir jenen bieten, die uns und unsere touristischen Angebote mit dem Rad erreichen möchten? Diesen und weiteren Fragen haben wir zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Marburg-Biedenkopf auf Grundlage der Analyse unseres aktuellen Radroutennetzes beraten und gemeinsame Ideen entwickelt. Im Sommer 2015 konnte die im Auftrag des Landkreises erarbeitete Bestandsaufnahme eines Radroutennetzes erfolgreich abgeschlossen werden. Im September 2015 bildeten die Online-Umfrage sowie die erste Radverkehrskonferenz den Auftakt zu einem bürgernahen Entwicklungsprozess. In einem strukturierten Beteiligungsverfahren setzte die Kreisverwaltung in Kooperation mit der Marburg Stadt + Land Tourismus GmbH in 2016 mit je zwei Regionalkonferenzen in den Kommunen des Landkreises innerhalb der EU-Förderregionen „Burgwald-Ederbergland“, „Marburger Land“ und „Lahn-Dill-Bergland“, den Bürgerdialog fort. Darüber hinaus bot die Beteiligungsplattform www.mein- marburg-biedenkopf.de allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich auch digital mit Ideen, Vorschlägen und Kommentaren einzubringen. Im Rahmen der Regionalkonferenzen haben wir alle Teilnehmenden gebeten, uns eine Rückmeldung zur jeweiligen Veranstaltung zu geben. Diese Rückmeldungen finden Sie in dieser Broschüre. -

Meine Marburger Feuerwehren
MEINE MARBURGER FEUERWEHREN Eine Verlagsbeilage der Oberhessischen Presse und Mein Marburg extra – 19.10.2019 | 23.10.2019 MEINE MARBURGER FEUERWEHREN 2 „Bergen, Löschen, Retten, Schützen“ Grußwort von Wieland Stötzel, Bürgermeister und Brandschutzdezernent der Universitätsstadt Marburg Liebe Mitbürgerinnen, Liebe Freiwilligen Feuerwehr Marburg de es mich freuen, wenn Sie sich Mitbürger, Sie halten eine engagieren können. Scheuen Sie auch selbst bei der Freiwilligen Sonderbeilage über die Frei- nicht den Weg zu einer unserer Feuerwehr Marburg engagieren willige Feuerwehr der Univer- Einheiten. Dort erhalten Sie In- wollen. sitätsstadt Marburg in Ihren formationen, die über die Dar- Als Brandschutzdezernent bin Händen. stellung in dieser Sonderbeilage ich stolz auf das großartige En- weit hinausgehen. Feuerwehr ist gagement unserer Freiwilligen Hier stellen sich unsere einzelnen ein einzigartiges Solidarkonzept. Feuerwehr. Ich wünsche mir, Stadtteilfeuerwehren mit ihren Blicken wir nur auf die Unwetter- dass es auch zukünftig so bleibt; Standorten, Abteilungen, Sonder- ereignisse der letzten beiden Jahre vielleicht bald mit Ihrer Betei- aufgaben, Qualifikationen sowie zurück, bei denen teilweise über ligung! ihrer Ausrüstung vor. Marburg 250 Feuerwehrleute gleichzeitig Und nun wünsche ich Ihnen hat im Verhältnis zu seiner Ein- im Einsatz waren, sieht man, wie spannende Einblicke in die Ar- wohnerzahl die größte Freiwillige gut und stabil das System unserer beit der Freiwilligen Feuerwehr Feuerwehr in ganz Hessen. Bei Freiwilligen Feuerwehr Marburg Marburg. uns geschieht „Bergen, Löschen, funktioniert. Retten, Schützen“ überwiegend Ich bedanke mich für Ihr Interes- Ihr im Ehrenamt mit über 500 freiwil- se an einer Institution, die einen Wieland Stötzel ligen Feuerwehrleuten. wichtigen Baustein der Sicherheit Bürgermeister und Diese Aufgabe ist vielfältig, so aller Marburgerinnen und Mar- Brandschutzdezernent Wieland Stötzel ist Brandschutz- dass auch Sie sich innerhalb der burger darstellt. -

Brand Schwelt Die Ganze Nacht
2 I Oberhessische Presse BLICK INS LAND Donnerstag, 3. Februar 2011 STANDPUNKT Brand schwelt die ganze Nacht von Manfred Obergeschoss des Wohnhauses in Wehrshausen war voller Rauch · Bewohner blieben unverletzt Hitzeroth Ein Schwelbrand in einem Forscher machen Wohnhaus im Marburger sich verdient Ortsteil Wehrshausen hat Praxisferne kann man den am Dienstagabend die Sprachwissenschaftlern vom Feuerwehren aus der Deutschen Sprachatlas nicht Kernstadt und mehreren nachsagen: Jetzt hat das an Ortsteilen in Atem gehal- der Marburger Universität an- gesiedelte Team um Professor ten. Erst am Mittwoch- Heinrich Dingeldein einen morgen rückten die Weh- Wortatlas vorgelegt, der die ren ab. Verletzt wurde Vielfalt der Alltagssprache in ländlichen Gebieten Hessens niemand. analysiert. Und dabei haben von Sonja Lecher die Forscher eine erstaunliche Bandbreite von Ausdrücken Marburg. In der gesamten zu Tage gefördert, die in Hes- Nacht blieb die Feuerwehr sen im Alltag verwendet wer- Wehrshausen vor Ort, um im- den. Als Bestandsaufnahme mer wieder den Brand nach- der Sprache bietet diese wis- zulöschen und zu kontrollie- senschaftliche Fleißarbeit un- ren, so dass das Haus erst gegen verzichtbares Handwerkszeug 9.30 Uhr an das Besitzer-Ehe- für weitere Forschungen. paar übergeben wurde. Ursa- che für den Brand sind offenbar Handwerksarbeiten im ersten Obergeschoss gewesen, zitiert IM BLICKPUNKT die Feuerwehr den Hausbesit- zer. Die genaue Ursache und die Stadionsprecher Höhe des Schadens ermitteln derzeit Sachverständige und die schnuppert Kriminalpolizei. „Bundesliga-Luft“ Gegen 18.45 Uhr wurden der Bis zum Mittwochmorgen musste die Feuerwehr den Schwelbrand an dem Haus immer wieder nachlöschen. Foto: Michael Hoffsteter Einsatzleitdienst der Feuerwehr Christian Nahr- Marburg und die Einheiten der wurden. Die Einliegerwohnung zur Kühlung bereit, um zu ver- Anke Schmidt mit. -

Die Auswirkungen Des Strukturwandels Im Marburger Einzelhandel
Heft 1 Thorsten LAU Die Auswirkungen des Strukturwandels im Marburger Einzelhandel Thorsten Lau Zitat: LAU, Thorsten (2009): Die Auswirkungen des Strukturwandels im Marburger Ein- zelhandel. – In: GEOFOCUS Heft 1. Online-Version: www.uni-marburg.de/FB19/personal/professoren/paal/geofocus www.uni-marburg.de/FB19/personal/professoren/strambach/geofocus Suchbegriffe: Einzelhandel, Strukturwandel, Marburg Abstract: Marburg is a typical medium-sized town, performing the supply tasks of a regional center within the German System of Central Places. But in spite of that serious problems concerning the structure and the dynamics in retail trade are identified. The traditional historic center gets into increasing competition with suburban shopping centers and other neighboured towns, due to the fact of bad accessibility und upscale retail trade offers. At the same time, the restructuring of business owner- ship and retail trade organization takes place. Main objective of this publication is the structural analysis of retail trade in Marburg as well as the interpretation of the dynamic change and its consequences for safeguarding the local supply facili- ties for the resident population. Herausgeberinnen: Michaela Paal (Stadtgeographie; Raumordnung und –planung) Simone Strambach (Geographie der Dienstleistung, Innovation und Kommunikation) beide: FB 19 Geographie der Philipps-Universität Marburg ISSN 1865-6811 (erscheint unregelmäßig) © GEOFOCUS Marburg 2009. All rights reserved 0 Die Auswirkungen des Strukturwandels im Marburger Einzelhandel Anstelle eines Vorworts Michaela Paal Stadtgeographie ist in erster Linie Großstadtforschung. Begründet ist diese Fokussierung in der Mannigfaltigkeit und Intensität, mit der soziale, ökonomische und politische Prozesse in den gro- ßen Verdichtungsräumen zu beobachten sind. Parallel zu dieser – zweifellos auch der Globalisie- rung und dem Zeitgeist geschuldeten – Hinwendung zu Megacities, Global Cities oder Weltstädten findet die Vernachlässigung der Arbeit über Klein- und Mittelzentren statt. -
Kolat Und May Parieren Glänzend
28 Lokalsport Mittwoch, 27. Januar 2010 BASKETBALL-BEZIRKSLIGA WEIBLICHE U15 Großseelheim gewinnt 67:33 (jpk). Die U15-Basketballerinnen der SG Wallau-Laasphe haben ihr Bezirksliga-Spiel beim SV Großseelheim 33:67 ver- loren. Ohne Aufbauspielerinnen Kim Winterhoff und Kath- rin Walke hatten die Gäste keine Chance in dem Vivien von Wittgenstein (2), Caroline Schaumann (17), Elisa Oster- mann(12) und Fatma Arslan (2) punkteten. Der Sieger hatte seine treffsichersten Schützinnen in Maren Nau (13), Fran- ziska Kraus (12) und Hannah Weidemann (8). Basketball Herren-Oberliga Hessen Herren-Kreisliga A Kronberg II–MTV Gießen 80:86 Wieseck II–Nonnenroth 86:98 Offenbach–BC Marburg 74:66 Kirchhain–VfB Gießen V 65:79 Aschaffenbg.–ACT Kassel 92:80 Lollar–NiGla Baskets 75:63 Gelnhausen–Grünberg 100:84 Lich IV–Wetzlar II 68:86 Weiterstadt–Langen II 88:90 MTV Gießen II–Krfdorf II 38:45 1.Gelnhausen 13 1228:995 25 1.Nonnenroth 12 1034:775 23 2.MTV Gießen 12 999:831 22 2.Lollar 13 994:834 23 3.Offenbach 12 920:839 21 3.Wetzlar II 13 969:882 21 4.Weiterstadt 13 1046:944 21 4.Krofdorf-Glbg. II 12 733:719 19 5.Langen II 13 945:992 19 5.VfB Gießen V 12 786:787 18 6.Grünberg 12 1016:1039 18 6.Wieseck II 12 882:883 18 7.ACT Kassel 12 964:931 18 7.MTV Gießen II 11 649:681 15 8.Aschaffenbg./K. 13 908:1073 16 8.NiGla Baskets 11 552:754 14 9.BC Marburg 13 825:1062 15 9.Lich IV 12 687:797 14 10.Kronberg II 13 997:1142 14 10.Kirchhain 12 784:958 14 Die D-Jugend-Kicker der Sportfreunde Blau-Gelb Marburg feiern ihren überragenden Keeper Anil Kolat, der im Finale drei Siebenmeter pariert. -

Infrastrukturbericht 2009
- 2 - Herausgeber: Der Magistrat der Universitätsstadt Marburg, Fachbereich Arbeit, Soziales und Wohnen Fachdienst Soziale Leistungen Friedrichstraße 36 35035 Marburg Telefon: 06421-201 0 Telefax: 06421-201 576 Redaktion: M. A. Anne-Mareike Keßler Marburg, Dezember 2009 - 3 - Vorwort Der Infrastrukturbericht der Stadt Marburg soll einen aktuellen Überblick über Entwick- lung, Struktur und infrastrukturelle Ausstattung der Kernstadt und der 20 Stadtteile geben. Die Stadtteile sind ein sehr wichtiger Bestandteil der Stadt, denn sie bieten einem beachtlichen Teil der Marburger Bevölkerung Wohn- und Arbeitsplätze. Ihre Entwicklung ist daher von wesentlicher Bedeutung für die Stadt Marburg. Dieser Bericht soll eine Übersicht über das soziale und kulturelle Angebot, über Ein- kaufsmöglichkeiten für Mittel des täglichen Bedarfs, die medizinische Versorgung vor Ort und die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel in Marburg und den Stadtteilen geben. Der Bericht „Marburg 2020 – Demographischer Wandel“ veranschaulicht die Auswir- kungen des demographischen Wandels auf die kommunale Infrastruktur. Die Bevölke- rungsentwicklung der Bundesrepublik wird in den nächsten Jahrzehnten von Schrumpfungstendenzen gekennzeichnet. Der demographische Wandel wird Regio- nen, Städte und auch Marburg verändern. Die Marburger Bevölkerungsentwicklung hat sich nach Zuwächsen in den 90-er Jahren in den letzten Jahren abgeschwächt und nähert sich einer Stagnationsphase. Die Bevölkerungsprojektion bis zum Jahre 2020 zeigt einen leichten, jedoch stetig verlaufenden Rückgang der Bevölkerungszah- len, wodurch Teile der Infrastruktur insgesamt betroffen sein werden, was sich vor allem in kleineren bzw. bereits heute knapp ausgestatteten Stadtteilen zeigen wird. Deshalb haben räumliche Verteilungsmuster von Versorgungsinfrastrukturen künftig einen noch zentraleren Charakter. Die Zukunftsfähigkeit der Stadt Marburg und ihrer Region zu erhalten bedeutet, sich jetzt mit den zu erwartenden oder möglichen Ent- wicklungstendenzen und ihren voraussichtlichen Auswirkungen zu beschäftigen. -

Busverbindungen - Hinfahrt** Zur Richtsbergschule / RGS*
Busverbindungen - Hinfahrt** zur Richtsbergschule / RGS* Gültig ab 15.12.2019 Wehrda** – Uni-Klinikum - RGS: Linie 19 / 18 Sachsenring 7:20 Uhr Cappeler Gleiche** – RGS: Linie 22 Magdeburger Str. 7:23 Uhr Cappeler Gleiche 7:31 Uhr Auf dem Schaumrück 7:25 Uhr August-Bebel-Platz 7:36 Uhr Lärchenweg 7:28 Uhr Moischer Str. 7:42 Uhr Mengelsgasse 7.30 Uhr Sohlgraben 7:46 Uhr Einkaufszentrum Wehrda 7:32 Uhr Sommerstr. 7:48 Uhr Ginseldorfer Weg B2 7:36 Uhr Paul-Natorp-Str. 7:50 Uhr Studentendorf B2 7:39 Uhr Schubertstr. 7:51 Uhr Uniklinikum A2 7:44 Uhr Raiffeisenstr. 7:54 Uhr H-Meerwein-Str. 7:47Uhr RGS – Karlsb Weg A2 8:00 Uhr Botan. Garten 7:49 Uhr Bus fährt ab hier weiter als Linie 18 Allnatal** - RGS: Linie 17 (S) RGS Karlsb. Weg an: 7:57 Uhr Hermersh., Steinküppel 7:10 Uhr Haddamsh.,Steinborn 7:15 Uhr Hauptbahnhof** – RGS: Linie 6 Cyriaxweimar, Cyriaxstr. 7:18 Uhr Hauptbahnhof A3 7:22 Uhr Taubenweg an 7:27 Uhr – dort in Li 15 zur RGS ab 7:35 Uhr Volkshochschule 7:25 Uhr Rudolphsplatz A1 7:27 Uhr Stadtwald ** – RGS: Linie 8 (S) Adolf-Reichwein-Schule 7:33 Uhr Platz der weißen Rose 7:13 Uhr Körnerstr. 7:34 Uhr Graf-v-Stauffenberg-Str. 7:15 Uhr Südbahnhof A1 7:37Uhr Zwetschenweg 7:21 Uhr Stadtbüro A1 7:40 Uhr Wilhelmsplatz B2 an: 7:26 Uhr Pommernweg A1 7:46 Uhr Umstieg in Linie 15 zur RGS, dabei Haltestelle wechseln zu Christa-Czempiel-Platz 7:50 Uhr Wilhelmsplatz A1 ab: 7:37 Uhr Eisenacher Weg B2 an: 7:52 Uhr RGS – Karlsbader Weg A2 an: 7:51 Uhr Michelbach** – RGS: Linie 15 (S) MR-Ost** – RGS: Linie 18 (S) S S Michelbach, Lindenplatz 7:10 Uhr Moischt Bürgerhaus B2 7:14 Michelbach, Am Wall 7:13 Uhr Schröck Balzer 7:18 Zur Weinstraße 7:23 Uhr Schröck Reutergasse 7:21 Wehrshausen - Kirche 7:24 Uhr Schröck Grundschule 7:24 7:27 Neuhöfe 7:27 Uhr Ginseldorf Friedhof 7:39 Soldatengraben B2 7:30 Uhr Ginseldorf Backhaus A3 7:40 Herrmannstr. -
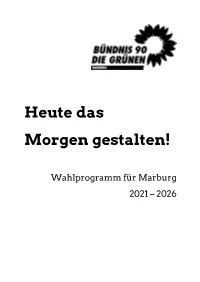
Wahlprogramm Für Marburg 2021 – 2026
Wahlprogramm für Marburg 2021 – 2026 Zukunft entscheidet sich hier! ........................................................................................ 1 Umwelt, Natur und Klima in Marburg schützen ....................................................... 4 Stadtentwicklung in Marburg: Sozial und ökologisch ......................................... 12 Bildungsstadt Marburg: Chancengleichheit und Teilhabe ermöglichen ....... 16 Wohnen in Marburg: Bezahlbar und barrierefrei ................................................... 20 Mobilität in Marburg: Verkehrswende gestalten ................................................... 22 Grüne Sozialpolitik in Marburg: Für eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe ............................................................................................. 32 Lebendige Demokratie in Marburg: Bürger*innenbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement .................................................................................. 42 Gleichstellungspolitik in Marburg: Her mit dem guten Leben! ........................ 45 Gesund leben in Marburg ............................................................................................... 50 Sportstadt Marburg .......................................................................................................... 53 Erlebnis Marburg: Nachhaltiger Tourismus ............................................................. 56 Kultur in Marburg: Vielfältig und für alle ................................................................. 60 Wirtschaft