Bericht Zur Stadtteilentwicklung Am Richtsberg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Prima Broschuere Komplett 2021.Indd
GRUSSWORT Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, Hinter uns liegt coronabedingt ein schwieriges Jahr. tätigen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (PSYMA) Grundlegende Informationen zum Thema Gesundheit sind gleichwohl mit der Ärztegenossenschaft PriMa vernetzt und eine psycho- unverändert wichtig und mit dieser Broschüre „Ihre PriMa Ärzte“, die therapeutische Tagesbereitschaft für akute Fälle geschaffen. Mehr 2021 zum 12. Male erscheint, möchten wir Ihnen wieder Hilfestellung dazu in unserer Broschüre. im Alltag geben. Das Hospiznetz Marburg wirkt segens- und erfolgreich bei der PriMa steht für „Prävention in Marburg“. Betreuung schwerstkranker und sterbender Patienten im häuslichen Umfeld in unserem Landkreis. Das Hospizgebäude steht für die Über 350 Ärztinnen und Ärzte haben sich unter diesem Namen stationäre Betreuung von Patienten zur Verfügung. Die Arbeit genossenschaftlich organisiert, um Ihnen – eingebettet in die erfolgt mit den PriMa Ärztinnen und Ärzten Hand in Hand. Mehr Gesundheitsregion Marburg-Biedenkopf – dabei zu helfen, gesund Informationen hierzu finden Sie in der Broschüre. zu bleiben. Uns liegt dabei die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung sowohl in den Städten wie auf dem Land sehr am Mit unserer Patientenverfügung, die gemeinsam mit den Kliniken Herzen. im Landkreis Marburg-Biedenkopf erarbeitet wurde, bieten wir eine Unterstützung, die bereits von vielen Menschen angenommen wurde. Die PriMa eG wurde 2016 als erstes Ärztenetz in Hessen von der Sollten Sie sich näher mit diesem Thema auseinander setzen wollen, Kassenärztlichen Vereinigung Hessen zertifiziert. Hiermit wird so nehmen sich Ihre PriMa Ärztinnen und Ärzte hierzu gerne die Zeit. auch unser ständiges Bemühen um eine reibungslose Abstimmung Sprechen Sie uns an! zwischen Haus- und Fachärzten anerkannt. Im Namen der Kolleginnen und Kollegen der PriMa eG wünschen wir Neben der Vorstellung unserer PriMa Ärztinnen und Ärzte haben Ihnen ein gutes Jahr 2021. -

Willkommen Im Landkreis Marburg- Biedenkopf
Willkommen im Landkreis Marburg- Biedenkopf Informationen für Flüchtlinge Revision 1 Inhalt 1: Alltag ......................3 11: Gewalt ....................16 Alltag in Deutschland (3) Rassistische Gewalt (16) Vergewaltigung (16) 2: Rechtliche Fragen ..........4 Häusliche Gewalt (17) Beratungsstellen (4) Anwalt / Anwältin (5) 12: Essen ...................... 17 3: Das Asylverfahren .........5 13: Familie/Kind ...............18 Schutz gegen Abschiebung (6) Erziehungsberatung (18) Kirchenasyl (6) Schwangerschaft (18) Kinderbetreuung (19) 4: Wohnen .................... 7 Was ist bei Umzügen zu tun? (7) 14: Günstige 5: Verkehr ....................8 Einkaufsmöglichkeiten ...19 Wie komme ich dahin? (9) Günstige Kleidungsläden (19) Günstige Tickets (9) Günstige Läden für Möbel/Woh- nungseinrichtung (19) 6: Arbeit .....................10 Günstiger Kinderladen (20) Dürfen Sie arbeiten? (10) 15: Arbeit oder Ausbildungsstelle (10) Religion ................... 20 Islam (20) 7: Finanzen ...................11 Evangelische Kirche (20) Schulden (12) Katholische Kirche (21) 8: Deutschkurse ............. 12 Judentum (21) Hilfen zum Deutschlernen (13) 16: Freizeit .................... 21 9: Bildung ................... 13 17: Ehrenamtliche Schule (13) Unterstützung ............22 Deutsche Schulabschlüsse (13) Stadt Marburg (22) Ausbildung (14) Marburg-Biedenkopf (22) Universität (14) Hessen (23) Studium in Marburg (14) Studium in Deutschland (14) Impressum .................23 10: Gesundheit ................14 Hausärzte/Hausärztinnen (15) Notfall (15) Kliniken -

Working Paper No 13
Working Paper No 13 Forum Demokratieforschung Beiträge aus Studium und Lehre Working Paper-Reihe im Fachgebiet Demokratieforschung am Institut für Politikwissenschaft der Philipps-Universität Marburg Working Paper No 13 Bürger_innenbeteiligung in Marburg Bericht der wissenschaftlichen Begleitung zum Prozess der Konzeptentwicklung im Juli 2018 Projektteam „Bürger_innenbeteiligung“ aus den Bachelor- und Masterstudiengängen der Politikwissenschaft am Institut für Politikwissenschaft der Philipps-Universität Marburg Leitung: Ursula Birsl Fabrice Bappert, Mona Schwarz, Julia Closmann, Nikolas Fiekas, Aygün Habibova, Florian Aldinger, Celia Himmel, Caroline Stockmann, Lukas Zittlau Titelbild: Füllhorn von Christel Irmscher (Original: Acryl auf Leinwand 1997) Impressum Forum Demokratieforschung, Working Paper Reihe im Fachgebiet Demokratieforschung Am Institut für Politikwissenschaft an der Philipps-Universität Marburg, Beiträge aus Studium und Lehre Herausgeberinnen: Prof'in Dr. Ursula Birsl, Matti Traußneck (M.A. Politologin) Working Paper No 13 (Juli 2018) ISSN 2197-9491 http://www.uni-marburg.de/fb03/politikwissenschaft/institut/lehrende/birsl/forumdemokratie Kontakt: Prof'in Dr. Ursula Birsl Matti Traußneck Philipps-Universität Marburg Institut für Politikwissenschaft Wilhelm-Röpke-Str. 6G DE-35032 Marburg E-Mail: [email protected] [email protected] Bürger_innebeteiligung in Marburg – die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung im Überblick Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 16. September -

Die Auswirkungen Des Strukturwandels Im Marburger Einzelhandel
Heft 1 Thorsten LAU Die Auswirkungen des Strukturwandels im Marburger Einzelhandel Thorsten Lau Zitat: LAU, Thorsten (2009): Die Auswirkungen des Strukturwandels im Marburger Ein- zelhandel. – In: GEOFOCUS Heft 1. Online-Version: www.uni-marburg.de/FB19/personal/professoren/paal/geofocus www.uni-marburg.de/FB19/personal/professoren/strambach/geofocus Suchbegriffe: Einzelhandel, Strukturwandel, Marburg Abstract: Marburg is a typical medium-sized town, performing the supply tasks of a regional center within the German System of Central Places. But in spite of that serious problems concerning the structure and the dynamics in retail trade are identified. The traditional historic center gets into increasing competition with suburban shopping centers and other neighboured towns, due to the fact of bad accessibility und upscale retail trade offers. At the same time, the restructuring of business owner- ship and retail trade organization takes place. Main objective of this publication is the structural analysis of retail trade in Marburg as well as the interpretation of the dynamic change and its consequences for safeguarding the local supply facili- ties for the resident population. Herausgeberinnen: Michaela Paal (Stadtgeographie; Raumordnung und –planung) Simone Strambach (Geographie der Dienstleistung, Innovation und Kommunikation) beide: FB 19 Geographie der Philipps-Universität Marburg ISSN 1865-6811 (erscheint unregelmäßig) © GEOFOCUS Marburg 2009. All rights reserved 0 Die Auswirkungen des Strukturwandels im Marburger Einzelhandel Anstelle eines Vorworts Michaela Paal Stadtgeographie ist in erster Linie Großstadtforschung. Begründet ist diese Fokussierung in der Mannigfaltigkeit und Intensität, mit der soziale, ökonomische und politische Prozesse in den gro- ßen Verdichtungsräumen zu beobachten sind. Parallel zu dieser – zweifellos auch der Globalisie- rung und dem Zeitgeist geschuldeten – Hinwendung zu Megacities, Global Cities oder Weltstädten findet die Vernachlässigung der Arbeit über Klein- und Mittelzentren statt. -
Kolat Und May Parieren Glänzend
28 Lokalsport Mittwoch, 27. Januar 2010 BASKETBALL-BEZIRKSLIGA WEIBLICHE U15 Großseelheim gewinnt 67:33 (jpk). Die U15-Basketballerinnen der SG Wallau-Laasphe haben ihr Bezirksliga-Spiel beim SV Großseelheim 33:67 ver- loren. Ohne Aufbauspielerinnen Kim Winterhoff und Kath- rin Walke hatten die Gäste keine Chance in dem Vivien von Wittgenstein (2), Caroline Schaumann (17), Elisa Oster- mann(12) und Fatma Arslan (2) punkteten. Der Sieger hatte seine treffsichersten Schützinnen in Maren Nau (13), Fran- ziska Kraus (12) und Hannah Weidemann (8). Basketball Herren-Oberliga Hessen Herren-Kreisliga A Kronberg II–MTV Gießen 80:86 Wieseck II–Nonnenroth 86:98 Offenbach–BC Marburg 74:66 Kirchhain–VfB Gießen V 65:79 Aschaffenbg.–ACT Kassel 92:80 Lollar–NiGla Baskets 75:63 Gelnhausen–Grünberg 100:84 Lich IV–Wetzlar II 68:86 Weiterstadt–Langen II 88:90 MTV Gießen II–Krfdorf II 38:45 1.Gelnhausen 13 1228:995 25 1.Nonnenroth 12 1034:775 23 2.MTV Gießen 12 999:831 22 2.Lollar 13 994:834 23 3.Offenbach 12 920:839 21 3.Wetzlar II 13 969:882 21 4.Weiterstadt 13 1046:944 21 4.Krofdorf-Glbg. II 12 733:719 19 5.Langen II 13 945:992 19 5.VfB Gießen V 12 786:787 18 6.Grünberg 12 1016:1039 18 6.Wieseck II 12 882:883 18 7.ACT Kassel 12 964:931 18 7.MTV Gießen II 11 649:681 15 8.Aschaffenbg./K. 13 908:1073 16 8.NiGla Baskets 11 552:754 14 9.BC Marburg 13 825:1062 15 9.Lich IV 12 687:797 14 10.Kronberg II 13 997:1142 14 10.Kirchhain 12 784:958 14 Die D-Jugend-Kicker der Sportfreunde Blau-Gelb Marburg feiern ihren überragenden Keeper Anil Kolat, der im Finale drei Siebenmeter pariert. -

Infrastrukturbericht 2009
- 2 - Herausgeber: Der Magistrat der Universitätsstadt Marburg, Fachbereich Arbeit, Soziales und Wohnen Fachdienst Soziale Leistungen Friedrichstraße 36 35035 Marburg Telefon: 06421-201 0 Telefax: 06421-201 576 Redaktion: M. A. Anne-Mareike Keßler Marburg, Dezember 2009 - 3 - Vorwort Der Infrastrukturbericht der Stadt Marburg soll einen aktuellen Überblick über Entwick- lung, Struktur und infrastrukturelle Ausstattung der Kernstadt und der 20 Stadtteile geben. Die Stadtteile sind ein sehr wichtiger Bestandteil der Stadt, denn sie bieten einem beachtlichen Teil der Marburger Bevölkerung Wohn- und Arbeitsplätze. Ihre Entwicklung ist daher von wesentlicher Bedeutung für die Stadt Marburg. Dieser Bericht soll eine Übersicht über das soziale und kulturelle Angebot, über Ein- kaufsmöglichkeiten für Mittel des täglichen Bedarfs, die medizinische Versorgung vor Ort und die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel in Marburg und den Stadtteilen geben. Der Bericht „Marburg 2020 – Demographischer Wandel“ veranschaulicht die Auswir- kungen des demographischen Wandels auf die kommunale Infrastruktur. Die Bevölke- rungsentwicklung der Bundesrepublik wird in den nächsten Jahrzehnten von Schrumpfungstendenzen gekennzeichnet. Der demographische Wandel wird Regio- nen, Städte und auch Marburg verändern. Die Marburger Bevölkerungsentwicklung hat sich nach Zuwächsen in den 90-er Jahren in den letzten Jahren abgeschwächt und nähert sich einer Stagnationsphase. Die Bevölkerungsprojektion bis zum Jahre 2020 zeigt einen leichten, jedoch stetig verlaufenden Rückgang der Bevölkerungszah- len, wodurch Teile der Infrastruktur insgesamt betroffen sein werden, was sich vor allem in kleineren bzw. bereits heute knapp ausgestatteten Stadtteilen zeigen wird. Deshalb haben räumliche Verteilungsmuster von Versorgungsinfrastrukturen künftig einen noch zentraleren Charakter. Die Zukunftsfähigkeit der Stadt Marburg und ihrer Region zu erhalten bedeutet, sich jetzt mit den zu erwartenden oder möglichen Ent- wicklungstendenzen und ihren voraussichtlichen Auswirkungen zu beschäftigen. -

Busverbindungen - Hinfahrt** Zur Richtsbergschule / RGS*
Busverbindungen - Hinfahrt** zur Richtsbergschule / RGS* Gültig ab 15.12.2019 Wehrda** – Uni-Klinikum - RGS: Linie 19 / 18 Sachsenring 7:20 Uhr Cappeler Gleiche** – RGS: Linie 22 Magdeburger Str. 7:23 Uhr Cappeler Gleiche 7:31 Uhr Auf dem Schaumrück 7:25 Uhr August-Bebel-Platz 7:36 Uhr Lärchenweg 7:28 Uhr Moischer Str. 7:42 Uhr Mengelsgasse 7.30 Uhr Sohlgraben 7:46 Uhr Einkaufszentrum Wehrda 7:32 Uhr Sommerstr. 7:48 Uhr Ginseldorfer Weg B2 7:36 Uhr Paul-Natorp-Str. 7:50 Uhr Studentendorf B2 7:39 Uhr Schubertstr. 7:51 Uhr Uniklinikum A2 7:44 Uhr Raiffeisenstr. 7:54 Uhr H-Meerwein-Str. 7:47Uhr RGS – Karlsb Weg A2 8:00 Uhr Botan. Garten 7:49 Uhr Bus fährt ab hier weiter als Linie 18 Allnatal** - RGS: Linie 17 (S) RGS Karlsb. Weg an: 7:57 Uhr Hermersh., Steinküppel 7:10 Uhr Haddamsh.,Steinborn 7:15 Uhr Hauptbahnhof** – RGS: Linie 6 Cyriaxweimar, Cyriaxstr. 7:18 Uhr Hauptbahnhof A3 7:22 Uhr Taubenweg an 7:27 Uhr – dort in Li 15 zur RGS ab 7:35 Uhr Volkshochschule 7:25 Uhr Rudolphsplatz A1 7:27 Uhr Stadtwald ** – RGS: Linie 8 (S) Adolf-Reichwein-Schule 7:33 Uhr Platz der weißen Rose 7:13 Uhr Körnerstr. 7:34 Uhr Graf-v-Stauffenberg-Str. 7:15 Uhr Südbahnhof A1 7:37Uhr Zwetschenweg 7:21 Uhr Stadtbüro A1 7:40 Uhr Wilhelmsplatz B2 an: 7:26 Uhr Pommernweg A1 7:46 Uhr Umstieg in Linie 15 zur RGS, dabei Haltestelle wechseln zu Christa-Czempiel-Platz 7:50 Uhr Wilhelmsplatz A1 ab: 7:37 Uhr Eisenacher Weg B2 an: 7:52 Uhr RGS – Karlsbader Weg A2 an: 7:51 Uhr Michelbach** – RGS: Linie 15 (S) MR-Ost** – RGS: Linie 18 (S) S S Michelbach, Lindenplatz 7:10 Uhr Moischt Bürgerhaus B2 7:14 Michelbach, Am Wall 7:13 Uhr Schröck Balzer 7:18 Zur Weinstraße 7:23 Uhr Schröck Reutergasse 7:21 Wehrshausen - Kirche 7:24 Uhr Schröck Grundschule 7:24 7:27 Neuhöfe 7:27 Uhr Ginseldorf Friedhof 7:39 Soldatengraben B2 7:30 Uhr Ginseldorf Backhaus A3 7:40 Herrmannstr. -
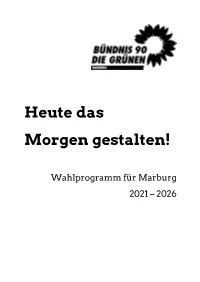
Wahlprogramm Für Marburg 2021 – 2026
Wahlprogramm für Marburg 2021 – 2026 Zukunft entscheidet sich hier! ........................................................................................ 1 Umwelt, Natur und Klima in Marburg schützen ....................................................... 4 Stadtentwicklung in Marburg: Sozial und ökologisch ......................................... 12 Bildungsstadt Marburg: Chancengleichheit und Teilhabe ermöglichen ....... 16 Wohnen in Marburg: Bezahlbar und barrierefrei ................................................... 20 Mobilität in Marburg: Verkehrswende gestalten ................................................... 22 Grüne Sozialpolitik in Marburg: Für eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe ............................................................................................. 32 Lebendige Demokratie in Marburg: Bürger*innenbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement .................................................................................. 42 Gleichstellungspolitik in Marburg: Her mit dem guten Leben! ........................ 45 Gesund leben in Marburg ............................................................................................... 50 Sportstadt Marburg .......................................................................................................... 53 Erlebnis Marburg: Nachhaltiger Tourismus ............................................................. 56 Kultur in Marburg: Vielfältig und für alle ................................................................. 60 Wirtschaft -

Friedhofsgebührenordnung Der Universitätsstadt Marburg Tritt Am 01
67/2 Friedhofsgebührenordnung der Universitätsstadt Marburg Aufgrund der §§ 5, 51 Nr. 6 und 93 Absatz 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i. d. F. vom 07. März 2005 (GVBl. I 2005, 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), der §§ 1 bis 5a, 9 und 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) i. d. F. vom 17. März 1970 (GVBl. I, S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Januar 2005 (GVBl. I S. 54), den Bestimmungen des Hessischen Verwaltungsvollstre- ckungsgesetzes (HessVwVG) i. d. F. vom 12. Dezember 2008 (GVBl. I 2009, S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. November 2010 (GVBl. I S. 421, 425) und des § 27 der Friedhofssatzung der Universitätsstadt Marburg vom 10. Dezember 2012 hat die Stadtver- ordnetenversammlung der Universitätsstadt Marburg am 30. November 2012 die folgende Friedhofsgebührenordnung (aktueller Stand: I. Nachtrag vom 23.04.2019) beschlossen: § 1 Allgemeines (1) Die Universitätsstadt Marburg betreibt die Friedhöfe Hauptfriedhof (Ockershäuser Allee), Sankt Jost, Cappel, Dilschhausen, Haddamshausen, Marbach, Wehrda, Ockershausen, Bauerbach, Cyriaxweimar, Ginseldorf, Hermershausen, Ronhausen, Wehrshausen, Bar- füßertor, Bortshausen, Dagobertshausen, Gisselberg, Michelbach und Schröck als öf- fentliche Einrichtung. (2) Für die Inanspruchnahme der Friedhöfe und deren Einrichtungen und Anlagen sowie für die damit zusammenhängenden Amtshandlungen der Friedhofsverwaltung (gebühren- pflichtige Leistungen) erhebt die Universitätsstadt Marburg nach Maßgabe dieser Ord- nung Gebühren. -
Philipps-Universität Marburg
nblick wiges G 5 Bachacker Kläran- m h E o l d b o r n La 6 Blumengarten lage B Zu orch r Ewiges Tal L A ü Am c m Am k . W 189 Sc W d e Rote heid er A stei iß W a uf n e 184 e d n g aße ld e A. r - Grube r Lahn 303 ehung Grabenstr r J 209 Galgengrundau) ö ch t c g r Flieder- Ringstr. a h B g Grün- i straße 309 . schiebel n S . Grundschule r K d t - r m Michelbach G S o e (im . 6 . tsum v e r Ringstr r o r g r - M ß t t a r ß r n e O t s r S i i c S f > - g r e f r n e en e h h onn we r f c S g n o 226 e ü h r a l - i i elb u Mecklen- d h o k h e n l e r b A i Am Jäger- e d 199 t i r l T e h n e m t n 229 wäldchen h F S B ü ac e s 316 S e n der Görtzb M S I r n ic h M i W h tü n l m c S 246 l e p G a elstal Friedrich- e F Industriestr a W ü t l Fröbel-Str r m Rehbocks- r d r l b e l m ecke A a b Ernst-Lemmer-Straße a W i A P n h ß c e e e A e h h aß r trChristopho- r e r r Srusstraße - r a ge v c bur o S k Magde m < Caldern t e 283 r r . -

RP325 Cohn Marion R.Pdf
The Central Archives for the History of the Jewish People Jerusalem (CAHJP) PRIVATE COLLECTION MARION R. COHN – P 325 Xeroxed registers of birth, marriage and death Marion Rene Cohn was born in 1925 in Frankfurt am Main, Germany and raised in Germany and Romania until she immigrated to Israel (then Palestine) in 1940 and since then resided in Tel Aviv. She was among the very few women who have served with Royal British Air Forces and then the Israeli newly established Air Forces. For many years she was the editor of the Hasade magazine until she retired at the age of 60. Since then and for more than 30 years she has dedicated her life to the research of German Jews covering a period of three centuries, hundreds of locations, thousands of family trees and tens of thousands of individuals. Such endeavor wouldn’t have been able without the generous assistance of the many Registors (Standesbeamte), Mayors (Bürgermeister) and various kind people from throughout Germany. Per her request the entire collection and research was donated to the Central Archives for the History of the Jewish People in Jerusalem and the Jewish Museum in Frankfurt am Main. She passed away in 2015 and has left behind her one daughter, Maya, 4 grandchildren and a growing number of great grandchildren. 1 P 325 – Cohn This life-time collection is in memory of Marion Cohn's parents Consul Erich Mokrauer and Hetty nee Rosenblatt from Frankfurt am Main and dedicated to her daughter Maya Dick. Cohn's meticulously arranged collection is a valuable addition to our existing collections of genealogical material from Germany and will be much appreciated by genealogical researchers. -

Der Kreisausschuss
Der Kreisausschuss Zehnte Fassung 2000/2001 Redaktion: Dr. Markus Morr Redaktionelle Mitarbeit bei der ersten Fassung: Annette Kaufmann Informationen zur Lokalgeschichtsforschung, Kulturamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf, August 2000 Orts-Chroniken, Schriften zu Ortsjubiläen und lokalgeschichtlich interessante Publikationen im Landkreis Marburg-Biedenkopf - Zehnte Fassung - Einführung Stand: 2000/2001 Die nachfolgende Auflistung enthält mit Aus- Sinn und Zweck dieser Zusammenstellung, die nahme von Marburg Literaturangaben zu jeder es zuvor auf Kreisebene noch nicht gab , sind Stadt und Gemeinde im Kreisgebiet. Die Unter- verbesserte Arbeitsbedingungen im Bereich der teilung erfolgt nach folgenden Gesichts- Lokalgeschichtsforschung und Heimatpflege. punkten: Auch Kooperationen können dadurch erleichtert werden. a) Chroniken, b) Jubiläumsschriften, Leider sind immer noch viele Angaben in dieser c) Ortsgeschichte, Liste bislang nicht enthalten. Wir bitten daher d) Periodika, um weitere Hinweise, wie die Publikationen ex- e) Sonstiges. akt heißen, wo deren (weitere) Standorte sind und was zudem noch zu ergänzen wäre. Bitte Sofern es möglich war, wurde den jeweiligen teilen Sie uns neue oder noch zu ergänzende Nennungen auch der Standort bzw. die Stand- Literaturhinweise unter folgender Kontaktadres- orte hinzugefügt, gegebenenfalls sogar mit se mit: Signatur. Diese Auflistung sollte von Ihnen - also den Interessierten und damit den Nutzern - laufend ergänzt und aktualisiert werden. Das Kontaktadresse: gilt auch für Institutionen, Archive etc. Kreisausschuss Marburg-Biedenkopf,- Kulturamt, Im Lichtenholz 60, Nachdem zuerst Angaben erfolgen, die nach 35034 Marburg, Kommunen geordnet wurden, werden im An- Tel.: 06421/405-628, schluß daran Literaturangaben zum Landkreis Fax.: 06421 / 405-500 (zentrale Poststelle) und zu einigen thematischen Schwerpunkten E-Mail: [email protected] aufgeführt. Verzeichnis der Standorte Biegenstr. 11, Ernst-von-Hülsen-Haus, Sofern bekannt befinden sich die Angaben der 35032 Marburg.