Hochsauerlandkreis Landschaftsplan “Hoppecketal”
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Geologie Und Paläontologie in Westfalen Heft9
Geologie und Paläontologie in Westfalen Heft9 Sporen und Phytoplankton aus den Raumländer Schichten (BI. 4916 Bad Berleburg) LOTHAR SCHÖLLMANN Hydrologische Markierungsversuche in WesHalen: Ein historischer Überblick DIETER W. ZYGOWSKI Landschaftsverband Westfalen - Lippe ' . ~ ,1· . .: • ''' ' 1 - Hinweise für Autoren In der Schriftenreihe Geologie und Paläontologie in Westfalen werden geowissenschaftliche Beiträge veröffentlicht, die den Raum Westfalen betreffen. Druckfertige Manuskripte sind an die Schriftleitung zu schicken. Aufbau des Manuskriptes 1. Titel kurz und bezeichnend. 2. Klare Gliederung. 3. Zusammenfassung in Deutsch am Anfang der Arbeit. Äußere Form 4. Manuskriptblätter einseitig und weitzeilig beschreiben; Maschinenschrift, Verbesserungen in Druckschrift. 5. Unter der Überschrift: Name des Autors (ausgeschrieben), Anzahl der Abbildungen, Tabellen und Tafeln; Anschrift des Autors auf der 1. Seite unten. 6. Literaturzitate im Text werden wie folgt ausgeführt: (AUTOR, Erscheinungsjahr: evtl. Seite) oder AUTOR (Erschei nungsjahr: evtl. Seite). Angeführte Schriften werden am Schluß der Arbeit geschlossen als Literaturverzeichnis nach den Autoren alphabetisch geordnet. Das Literaturverzeichnis ist nach folgendem Muster anzuordnen: SIEGFRIED, P. (1959): Das Mammut von Ahlen (Mammonteusprimigenius BLUMENB.). - Paläont. Z. 30, 3: 172-184, 3 Abb., 4 Tat.; Stuttgart. WEGNER, T. (1926): Geologie Westfalens und der angrenzenden Gebiete. 2. Aufl. - 500 S., 1 Tat., 244 Abb.; Pader born (Schöningh). 7. Schrifttypen im Text: doppelt unterstrichen = Fettdruck. einfach unterstrichen oder gesperrt= Sperrung. Gattungs- und Artnamen unterschlängeln = Kursivdruck. Autorennamen durch GROSSBUCHSTABEN wiedergeben. Abbildungsvorlagen 8. In den Text eingefügte Bilddarstellungen sind Abbildungen (Abb. 2). Auf den Tafeln stehen Figuren (faf. 3, Fig.2) oder Profile (f af. 5, Profil 2). 9. Strichzeichnungen können auf Transparentpapier oder Photohochglanzpapier vorgelegt werden. Photographien müssen auf Hochglanzpapier abgezogen sein. KorreKturen 10. -

Die Diemel Von Helmut Rosenkranz
Die Diemel von Helmut Rosenkranz Bekanntlich entspringt die Diemel am Kahlen Pöhn bei Usseln. Die Quellgegend der Diemel liegt auf der Diemel-Eder/Fulda/Weser-Wasserscheide. Dies bedeutet, dass die nach Nordosten fließende Diemel direkt in die Weser mündet. Von ihrer Quelle fließt die Diemel im nordwestlichen Teil Hessens innerhalb des Landkreises Waldeck- Frankenberg zuerst sanft bergab nach Usseln und dann nordwärts durch ein schönes Tal, in dem 3 Dörfer liegen: Hemmighausen, Deisfeld und Gieb- ringhausen. Danach erreicht ihr Wasser von Süden kommend den Diemelsee, in den die von Westen heran fließende Itter einmündet. Kurz vor der Staumauer der Diemeltalsperre verläuft durch diesen Stausee die Grenze der Bundesländer Hessen und Nordrhein-Westfalen. Unterhalb der Staumauer und damit ab Helminghausen durchfließt die Diemel in nordöstlicher Richtung ein Tal. Bis zu 595 m hohe Berge thronen dort majestätisch über dem Tal, in dem es außer Helminghausen keine weiteren Dörfer gibt, bis auf Padberg und Giershagen, die beide auf einem Berg ober- halb der Diemel liegen. In diesem Tal wird die Diemel zuerst von der aus Richtung Süden kommenden Rhene und dann von der aus westlicher Richtung heran fließenden Hoppecke gespeist. Danach verlässt die Diemel den Naturpark Diemelsee, wobei sie südöstlich am Sintfeld vorbei fließt und über Marsberg nach Westheim gelangt. Dieser Beitrag soll verdeutlichen, dass die Diemel gerade hier in Westheim einige Male ihren Lauf verändert hat bzw. verändert wurde. Bis zum 16. Jahrhundert floss die Diemel von Marsberg kommend am Gut Westheim vorbei, dann unterhalb des Hoppenbergs, durch das heutige Belgrad, um dann vor dem Felsgrad des „Steinbrinks“ (heutiges Heiligen- haus bei Brekers) in Richtung Osten seinen Lauf fortzusetzen. -

Karten TK50 Hessen
Bebra, Stadt Wildeck LK Hersfeld-Rotenburg LK Hersfeld-Rotenburg Dankmarshausen Blatt 01 Wartburgkreis Meckbach 01.22 Ronshausen LK Hersfeld-Rotenburg 01.21 FFH-Gebiet Ludwigsau FFH-Gebiet Rohrlache von Fulda LK Hersfeld-Rotenburg Seulingswald Regierungsbezirk Heringen 01.20 VSG Fuldatal zwischen Rotenburg Kassel und Niederaula Anschluss Blatt 02 01.19 Heringen (Werra), Stadt LK Hersfeld-Rotenburg 01.18 Herfabach Friedewald LK Hersfeld-Rotenburg 01.17 FFH-Gebiet Dreienberg Bad Hersfeld, bei Friedewald Kreisstadt NSG Dreienberg 01.16 LK Hersfeld-Rotenburg bei Friedewald Werra 01.15 FFH-Gebiet Werra 01.14 01.13 zwischen Phillippsthal 01.11 und Herleshausen 01.12 01.10 01.8 01.7 01.9 01.6 01.5 01.4 01.1 Solz Philippsthal (Werra) 01.3 01.2 01.0 LK Hersfeld-Rotenburg FFH-Gebiet Kaliwerk Werra, Landecker Berg STEGAL bei Ransbach Standort MIDAL Hattorf Zellersbach Vacha, Stadt Wartburgkreis Schenklengsfeld Hohenroda ter LK Hersfeld-Rotenburg Uls LK Hersfeld-Rotenburg Fischbach Unterbreizbach Rohrfernleitungsanlage zur EntsorgungWartburgkreis der Salzabwässer aus demBreizbach hessisch-thüringischen Kalirevier in die Nordsee/ Jade Antragskonferenz zum Raumordnungsverfahren FFH-Gebiet FFH-Gebiet Untersuchungskorridore Maßstab 1: 50.000 i.O. Anlage 4 Eitra Kalkmagerrasen zwischen Vorderrhön Datum Name Land: HE Ausgabeformat: DIN A3 Blatt 01 Eiterfeld Morschen und Sontra Bearb. 03.02.2014 Ernst Ing.- und Planungsbüro Carl-Peschken-Str. 12 LANGE GbR 47441 Moers LK Fulda Gepr. 03.02.2014 Justka 1 Tel.: +49 2841 7905 - 0 Freig. km Fax +49 2841 7905 -

Hessen-Forst
HESSEN-FORST Artgutachten 2005 Fischökologische Untersuchung der hessischen Anteile des Fließgewässersystems der Diemel Band III 2005 FENA Servicestelle für Forsteinrichtung und Naturschutz Fischökologische Untersuchung der hessischen Anteile des Fließgewässersystems der Diemel Band III 2005 Im Auftrag des Landes Hessen, vertreten durch Hessen Forst - Forsteinrichtung, Information, Versuchswesen - Dr. Ulrich Schwevers, Dr. Beate Adam & Dipl.-Geogr. Oliver Engler Neustädter Weg 25 36320 Kirtorf-Wahlen Tel.: 06692 / 6044 Fax: 06692 / 6045 e-Mail: [email protected] Überarbeitete Fassung, Stand: Juli 2006 Band I 0 Zusammenfassung 0-1 1 Einleitung 1-1 2 Material und Methoden 2-1 3 Untersuchungsgebiet 3-1 4 Gewässermonographien 4-1 Band II 5 Artmonographien 5-1 Band III 6 Bewertung der fischökologischen Situation 6-1 6.1 Anthropogene Einflüsse auf den aquatischen Lebensraum 6-2 6.1.1 Organische Belastung 6-2 6.1.2 Thermische Belastung 6-2 6.1.3 Gewässerstruktur 6-3 6.1.4 Aquatische Biotopstruktur und Fischfauna 6-4 6.1.5 Substrate 6-5 6.1.6 Lineare Durchgängigkeit 6-6 6.1.6.1 Aufwanderung 6-6 6.1.6.2 Abwanderung 6-9 6.1.7 Laterale Vernetzung 6-13 6.1.8 Naturschutz 6-14 6.1.9 Nutzungskonflikte 6-17 6.1.9.1 Wasserkraft 6-17 6.1.9.2 Freizeitnutzung 6-18 6.1.9.3 Fischereiliche Nutzung und Hege 6-18 6.2 Autochthone und aktuelle Fischfauna 6-20 6.2.1 Autochthone Fischfauna des Diemelsystems 6-20 6.2.2 Aktuelle Fischfauna des Diemelsystems 6-22 6.3 Regionale Rote Liste 6-27 6.4 Erhaltungszustand der FFH-Arten 6-32 6.5 Ökologischer Zustand der Fischfauna gemäß EG-WRRL 6-34 7 Literatur 7-1 Anhang 1: Dokumentation der Geländeerfassung Anhang 2: Fischbestandsdaten der Probestellen Fischökologische Untersuchung des Gewässersystems der Diemel Kap. -

Integriertes Klimaschutzkonzept Für Den Kreis Paderborn
Integriertes Klimaschutzkonzept für den Kreis Paderborn Bericht Dezember 2011 Das Integrierte Klimaschutzkonzept wurde im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative der Bundesregierung gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Herausgeber Kreis Paderborn Der Landrat Aldegrever Straße 10-14 33102 Paderborn Projektleitung Kreis Paderborn Dipl.-Ing. Martin Hübner, techn. Dezernent Dipl.Verw. (FH) Daniela Zielke-Naß, Umweltamt Tel: 05251 – 308270 E-Mail: [email protected] Förderung Zuwendungsgeber: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) Förderkennzeichen: 03KS1336 Bearbeitung IfR Institut für Regionalmanagement / Dr. Grauthoff Unternehmensberatung für Energie und Umwelt c/o IfR Projektbüro Nordrhein-Westfalen, Bullmannaue 11, 45327 Essen Dezember 2011 Integriertes Klimaschutzkonzept Kreis Paderborn Inhaltsverzeichnis 1. Vorwort ......................................................................................................................................................... 9 2. Übergeordnete Rahmenbedingungen ..................................................................................................... 11 2.1 Politische Beschlüsse und Programme zum Klimaschutz .................................................................... 11 2.1.1 IPCC-Berichte ................................................................................................................................ 11 2.1.2 Nationale Ebene ........................................................................................................................... -
Sauerland Zur Weser
VOM SAUERLAND ZUR WESER www.diemelradweg.de VOM 4-STERNE ZERTIFIZIERUNG Das Gütesiegel „ADFC-Qualitätsroute“ bewertet Fernradwege nach deutschlandweit einheitlichen Kriterien wie Befahrbarkeit, Ober- flächenbeschaffenheit, Wegweisung, Routenführung, touristische SAUERLAND Infrastruktur und Öffentlicher Nahverkehr. 2017 wurde der Diemelradweg vom ADFC mit vier von fünf Sternen ZUR ausgezeichnet und gehört seitdem auch offiziell zu den Qualitäts- WESER radrouten Deutschlands. STRECKENPROFIL DIEMELRADWEG • Wegbeschaffenheit und Routencharakter Der Diemelradweg ist größtenteils asphaltiert und verläuft vorwiegend direkt an der Diemel entlang. Wenn Sie Padberg erklommen haben, fahren Sie weitestgehend ohne große Steigung bis zur Mündung der Diemel nach Bad Karlshafen. WILLKOMMEN AUF DEM DIEMELRADWEG • Beschilderung „Immer am Fluss entlang vom Sauerland bis an die Weser“. Der Diemelradweg ist einheitlich ausgeschildert. Ein mit bunten Kreisen dargestellter Radfahrer weist Ihnen den Weg; charakteristisch ist der Ammonit im Vorderrad. So lautet das Motto für den Diemelradweg. Erleben Sie, wie sich das klare Wasser, das sich An Kreuzungspunkten stehen Pfeilwegweiser, die das Nah- und Fernziel mit der Ent- sprudelnd aus einer Quelle in nahezu 700 m Höhe nahe Willingen/Usseln in das Bachbett fernungsangabe anzeigen; Zwischenwegweiser weisen auf den korrekten Verlauf des ergießt, zu einem richtigen Fluss entwickelt, der nach ca. 112 km gemächlich in die Weser Diemelradweges: Rot auf nordrhein-westfälischer Seite und grün auf hessischem Gebiet. mündet. -
Experience Grimmheimat Nordhessen
EXPERIENCE GRIMMHEIMAT NORDHESSEN FREE LEISURE FUN WITH INCLUDING ALL LEISURE TIME ACTIVITIES 2020 FREE TRAVEL BY BUS AND TRAIN www.MeineCardPlus.de EXPERIENCE GRIMMHEIMAT NORDHESSEN CONTENT Welcome to Grimms ´home North Hesse About MeineCardPlus 4 North Hesse is the home of the Brothers Grimm. Jacob and Wilhelm Grimm spent most of their lives Map of leisure activities 6 here, in this picture postcard landscape, where they also collected and wrote down their world-famous fairy tales. The Brothers Grimm enjoyed their travels, The for keen swimmers 8 which took them all over the region; numerous diary entries and letters prove how much they loved living here. for underground Follow in their footsteps and discover the Grimms´ The 28 adventures home North Hesse. Your personalised visitor pass MeineCardPlus gives you unrestricted access to this unique region. Experience more than 140 leisure time activities free of charge during your holiday here. The for nature lovers 31 From water park fun to outstanding museums, a chilling ride on a summer toboggan run to a hike in the mountains or remarkable guided city tours. You for leisure time The 37 even travel for free on the region‘s public transport activities system. Refer to this brochure for more detailed information. We hope you have a fun-filled holiday in our fairy tale The for culture 53 region; enjoy your stay and please, tell everyone you know what a magical time you had! Regards, The for mobility 82 your holiday team from the Grimms´ home North Hesse FREE LEISURE FUN WITH MEINE Eintrittskarte ins Urlaubsvergnügen MEIN Fahrschein für Bus & Bahn MEINE Eintrittskarte ins Urlaubsvergnügen MEIN Fahrschein für Bus & Bahn ABOUT MeineCardPlus is your free pass to North Hesse‘s world of Most of the participating leisure, facilities are easily reached leisure time activities. -
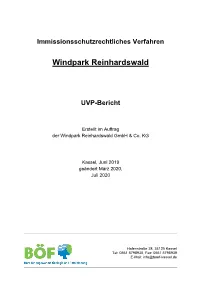
Windpark Reinhardswald
Immissionsschutzrechtliches Verfahren Windpark Reinhardswald UVP-Bericht Erstellt im Auftrag der Windpark Reinhardswald GmbH & Co. KG Kassel, Juni 2019 geändert März 2020, Juli 2020 Hafenstraße 28, 34125 Kassel Tel: 0561 5798930, Fax: 0561 5798939 E-Mail: [email protected] Auftraggeber: Windpark Reinhardswald GmbH & Co. KG Über dem Maibach 2 34393 Grebenstein Auftragnehmer: BÖF Büro für angewandte Ökologie und Forstplanung GmbH Hafenstraße 28 34125 Kassel www.boef-kassel.de Projektleitung: Birte Schwoch Bearbeiter: Stefan Brinkmann Julia Hartung Simone Leibmann Birte Schwoch UVP-Bericht Windpark Reinhardswald Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 EINLEITUNG ....................................................................................................... 1 1.1 VERANLASSUNG .................................................................................................... 1 1.2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN .................................................................................... 2 1.3 DATENGRUNDLAGEN .............................................................................................. 2 2 VORHABENSBESCHREIBUNG UND WESENTLICHE WIRKUNGEN ................ 3 2.1 WINDKRAFTANLAGEN ............................................................................................. 3 2.2 ZUWEGUNG ........................................................................................................... 7 2.3 KABELTRASSE UND NETZANSCHLUSS ...................................................................... 8 2.4 ZISTERNEN ...........................................................................................................10 -

Treffen Der Generationen Am 26.04.2019
Jahrgang 51 Donnerstag, den 11. April 2019 Nummer 15 Aus dem Inhalt LINUS WITTICH Medien KG online lesen: www.wittich.de TREFFEN DERGENERATIONEN AM 26.04.2019 Zu einem Höhepunktder besonderen Art DerSeniorenbeiratund derSchützenvereinMotzfeld1992e.V. ladenein. Treffender Generationen/Schnupperschießen,Chor...... AndachtimSchützenhauszuMotzfeld • Kaffeetrinken, Abendessen -Möglichkeit zu Spielen; In dieser Ausgabe musikalischerUmrahmung/esdarfauchgetanzt werden- unsereCOUPON- • Termin:Freitag,26.04.2019ab15:00 Uhr BEILAGE mit: • Schützenhaus zu Motzfeld •Rabattaktionen •Angeboten •Empfehlungen Alle Altersklassensindangesprochen/HerzlichWillkommen …und mehr www.gemeinde-friedewald.de Ihr Spezialist für Überdachungen •Eingang-Überdachung •Carport JETZT NEU •Terrassen-Überdachung •Balkon SAUNA– •Wintergarten •Innenausbau BAU in 36266 Heringen (Werra) •Oberland 3 Telefon: 06624 //9 91515 67 06 www.Holzbau-Heyer.de Mobil: 0173 /7345280 Friedewald -2- Nr.15/2019 Wirladen alle Vereine ein,sichandieser Aktion zu beteiligen. Alle,die einenTraktor mitHängerodereinen PKWmit Hänger mitbringen können,meldensichbitte beiOrtsvorsteher Jürgen Zimmermann(Tel.:06674 1392). BlaueSäcke stellt dieGemeinde, Handschuhe sind mitzubringen. Versicherungsamtfür Im Anschlussandie Aktion werden Bratwürstchen und Getränke rentenangelegenheit zurStärkung an diefleißigen Helfer ausgegeben. Ortsbeirat Friedewald beim kreisausschussdes landkreises hersfeld-rotenburg, sonderbetriebsplan Friedrich-Ebert-straße9,36251 Bad hersfeld gemäߧ52Abs.2 Allgemeine geschäftszeiten: -

2021 O Zielle Erö Nung Hohe Mark Steig
DIE RÖMER-LIPPE-ROUTE WASSERERLEBNIS RÖMERKULTUR RÖMER-LIPPE-ROUTE FÜR ALLE TAGESTOUREN UND WEGESCHLEIFEN Die Lippe ist das ideale Reiseziel für Radwanderer, Natur- Seit jeher bestand zwischen der Lippe und ihren Anwohnern FFH-Gebiete sowie entlang flussbegleitender Kanäle, zu Vor über 2.000 Jahren erstreckte sich der Machtbereich des Als deutschlandweit erster Radfernweg wurde die Römer-Lippe- Neben der Hauptroute können Sie an zwölf Punkten den Weg und Wasserliebhaber und alle, die sich für Römerkultur eine enge Beziehung und ihre Schicksale sind untrennbar zahlreichen (Wasser)Schlössern, vorbei an mächtigen Römischen Reiches bis an den Rhein. Damit gaben sich die Route nach dem bundesweit einheitlichen Kennzeichnungs- über die thematischen Wegeschleifen wählen. Diese führen Sie und europäische Historie begeistern können. Auch wenn miteinander verflochten. Von der Lippe ging einerseits Schleusen und als besonderes Highlight über insgesamt Römer aber nicht zufrieden und wollten auch das germanische system „Reisen für Alle“ zertifiziert. Entlang der Route gibt es zu ausgewählten Wassererlebnissen oder informieren zu Stätten die Lippe zum Understatement neigt, ist sie doch ein Fluss, ständige Bedrohung aus, andererseits war sie aber auch die vier handbetriebene Lippefähren. Nicht zuletzt widmen Gebiet zwischen Rhein und Elbe unter ihre Herrschaft bringen. außerdem zahlreiche Unterkünfte, Gastronomiebetriebe und der Römerkultur. Für Ausflügler eignen sich die Wegeschleifen den es zu entdecken lohnt: Ohne großen Namen, aber zentrale Lebensader der Region. Überschwemmungen und sich fast alle der zwölf thematischen Wegeschleifen der Ausgehend vom heutigen Xanten errichteten die Römer daher Sehenswürdigkeiten, für die Barrierefreiheit eine Selbstver- hervorragend für eine Tagesrundtour. An jedem Abzweig von ausgezeichnet als Flusslandschaft des Jahres 2018. Abseits Hochwasser prägten und veränderten den Fluss und das Römer-Lippe-Route ausgewählten Wassermotiven. -

Wanderwege Loipenplan
Langlauf Langlauf Langlauf Langlauf Willingen Loipe Stryck (1) Willingen Loipe Paradies (4) Willingen-Usseln Loipe Hohe Pön (7) Willingen-Eimelrod Loipe Mühlenberg I (10) 1 Willingen – Loipe Stryck 4 Willingen – Loipe Paradies 7 Usseln – Loipe Hohe-Pön 10 Eimelrod – Loipe Mühlenberg I LOIPENPLANWegeart Höhenprofil Wegeart Höhenprofil Wegeart Höhenprofil Wegeart Höhenprofil Länge 3.0 km Länge 8.3 km Länge 7.0 km Länge 7.9 km Das Langlauferlebnis Herzlich willkommen im Weltcuport und Kneipp-Heilbad Willingen mit sei- nen liebenswerten Orten. Willingen ist ein »Eldorado« für Skilangläufer. In idealen Höhenlagen von 580 bis 840 m erschließt sich ein Langlaufparadies von 80 km gepflegten Rundloipen, darunter sind auch sechs vom DSV nordicaktiv zertifizierte Loipen. Die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade bieten hervorragende Langlaufmöglichkeiten für Jung und Alt, Anfänger und Fortgeschrittene. Sehr gut ausgeschilderte Loipen bieten Natursportlern ein tolles Skierleb- nis bis ins sonnigwarme Frühjahr hinein. Viel Spaß wünscht Ihnen 589 – 636 m ü. NN Gesamtanstieg: 46 m 589 – 786 m ü. NN Schwierigkeitsgrad: schwierig 642 – 728 m ü. NN Schwierigkeitsgrad: schwierig 490 – 600 m ü. NN Schwierigkeitsgrad: mittel (rot) Langlauf Tourdaten Langlauf Länge: 3,1 km Beste JahreszeitSchwierigkeitsgrad:BewertungenTourdaten Langlauf leicht (blau) Länge: 8,3 km (freie TechnikBeste 3 km)Jahreszeit(schwarz) BewertungenTourdaten Länge: 7 km + ZubringerloipeBeste 1,5 Jahreszeit km (schwarz) BewertungenTourdaten Langlauf Länge: 7,9 km Beste Jahreszeit Bewertungen -

Die Hauptursachen Für Hochwasser Eines Der Größten Bekannten Hochwasser Der Diemel Trat Im November 1890 Die Weser Ein
Eco Pfad Technik und Natur Hochwasserschutz und Auenrenaturierung an der Diemel 11 Diemel Mündung in Die Hauptursachen für Hochwasser Eines der größten bekannten Hochwasser der Diemel trat im November 1890 die Weser ein. Das zweite Ereignis in jüngerer Zeit war das Hochwasser vom Juli 1965 mit • Übereinstimmung der Laufrichtung des Flusses mit der vorherrschenden dem höchsten bisher überhaupt bekannt gewordenen Spitzenabfluss. Die nach Regenrichtung von Südwest nach Nordost, dem Auslaufen des Hochwassers festgestellten Schäden betrugen 25 Mio. DM, • verhältnismäßig schmale Form des Niederschlagsgebietes, selbst mehrere Menschenleben waren zu beklagen. • Lage im Schatten des Rothaargebirges und dem folgenden Stau an den Rand- bergen der Weser, Hochwasserschutz • das bis auf wenige Ausnahmen steile bis sehr steile Gefälle des Hauptlaufes In den Diemelauen unterscheiden sich die Interessen des Fremdenverkehrs, der und der meisten Nebengewässer, • die nach Sättigung nur sehr geringe Durchlässigkeit des Untergrundes, Landwirtschaft sowie des Natur- und Hochwasserschutzes. • Zusammentreffen von Hochwasserwellen der Nebenläufe, insbesondere Früher wurden diese Probleme einseitig aus Sicht des Hochwasserschutzes und denen der Twiste, mit dem Scheitel der Diemel. allenfalls des Landgewinns gesehen. Hochwasserschutz bedeutete in diesem Zusammenhang die Abtrennung und das Zuschütten von Mäandern und Alt- Das Ausufern des Flusses wird zusätzlich forciert durch die Stauwehre vieler wassern, Ufersicherung und -aufhöhung bzw. Eindeichung, um einen schnellen kleiner Wasserkraftanlagen und die teilweise zu kleinen Durchflussöffnungen Wasserabfluss zu erreichen, die Ortslagen zu sichern und Land zu gewinnen. an Brücken. Mit abnehmendem Gefälle im Mittel- und Unterlauf nehmen die Diemelquelle Die Folgen waren eine extreme ökologische Verarmung der Aue und die Verrin- © GeoBasis-DE / BKG 2013 Überflutungen zu und breiten sich am weitesten im Bereich zwischen Eber- Verlauf der Diemel von der Quelle bis zur Mündung.