DER GEHEIMDIENST in Europa 1937–1945
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

3. Claus Schenk Graf Von Stauffenberg Und Operation Walküre
DIPLOMARBEIT „Geschichte des Widerstandes in Film und Fernsehen“ Die Inszenierung der Stauffenberg-Thematik und das tatsächliche Ereignis des 20. Juli 1944 Verfasserin Marlies Bauer angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. Phil.) Wien, Mai 2010 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 317 Studienrichtung lt. Studienblatt: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuerin / Betreuer: Doz. Dr. Clemens Stepina FÜR HELGA UND WILHELM BAUER Danksagung Vielen lieben Dank an meine Familie. Ich danke Isabella und meinem Vater Gerhard, meinem Bruder Oliver und meiner Oma Helga. Ein herzliches Dankeschön an Dr. Clemens Stepina für die großartige Betreuung. Danke an all meine lieben Freunde. Besonderen Dank für geduldiges Zuhören und spontanen Einsatz an: Jürgen Millautz, Kathleen Moser, Christian Podlipnig, Sabine Riedl, Davor Tadic, Magdalene Wyszecki und Oliver Zopper. INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung..................................................................................................... 1 2. Umsturzpläne in der NS-Zeit: Der Weg hin zum Stauffenberg-Attentat....... 5 2.1. Exkurs - Die ersten einsamen Helden des zivilen Widerstandes - Maurice Bavaud und Georg Elser ..........................................................6 2.2. Stimmen aus den eigenen Reihen - der Beginn des militärischen Widerstandes .......................................................................................11 2.2.1. Die letzte Chance? Der Verschwörerkreis um Hans Oster ..........12 2.2.2. Eine Flasche Cognac für das Führerflugzeug..............................16 -

Dokumentation Das Letzte Duell. Die
Dokumentation Horst Mühleisen Das letzte Duell. Die Auseinandersetzungen zwischen Heydrich und Canaris wegen der Revision der »Zehn Gebote« I. Die Bedeutung der Dokumente Admiral Wilhelm Franz Canaris war als Chef der Abwehr eine der Schlüsselfigu- ren des Zweiten Weltkrieges. Rätselhaftes umgibt noch heute, mehr als fünfzig Jah- re nach seinem gewaltsamen Ende, diesen Mann. Für Erwin Lahousen, einen sei- ner engsten Mitarbeiter, war Canaris »eine Person des reinen Intellekts«1. Die Qua- lifikationsberichte über den Fähnrich z.S. im Jahre 1907 bis zum Kapitän z.S. im Jahre 1934 bestätigen dieses Urteü2. Viele Biographen versuchten, dieses abenteu- erliche und schillernde Leben zu beschreiben; nur wenigen ist es gelungen3. Un- 1 Vgl. die Aussage des Generalmajors a.D. Lahousen Edler von Vivremont (1897-1955), Dezember 1938 bis 31.7.1943 Chef der Abwehr-Abteilung II, über Canaris' Charakter am 30.11.1945, in: Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Mi- litärgerichtshof (International Military Tribunal), Nürnberg, 14.11.1945-1.10.1946 (IMT), Bd 2, Nürnberg 1947, S. 489. Ders., Erinnerungsfragmente von Generalmajor a.D. Erwin Lahousen über das Amt Ausland/Abwehr (Canaris), abgeschlossen am 6.4.1948, in: Bun- desarchiv-Militärarchiv (BA-MA) Freiburg, MSg 1/2812, S. 64. Vgl. auch Ernst von Weiz- säcker, Erinnerungen, München, Leipzig, Freiburg i.Br. 1952, S. 175. 2 Vgl. Personalakte Wilhelm Canaris, in: BA-MA, Pers 6/105, fol. 1Γ-105Γ, teilweise ediert von Helmut Krausnick, Aus den Personalakten von Canaris, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (VfZG), 10 (1962), S. 280-310. Eine weitere Personalakte, eine Nebenakte, in: BA-MA, Pers 6/2293. -

Verbände Und Truppen Der Deutschen Wehrmacht Und Waffen SS Im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
GEORG TESSIN Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945 ZWEITER BAND: Die Landstreitkräfte 1—5 Bearbeitet auf Grund der Unterlagen des Bundesarchiv-Militärarchivs Herausgegeben mit Unterstützung des Bundesarchivs und des Arbeitskreises für Wehrforschung VERLAG E. S. MITTLER & SOHN GMBH. • FRANKFURT/MAIN 1" ( 1 Einleitung und Quellen Einleitung und Quellen Das vorliegende Werk hat es sich zum Ziel gesetzt, in einer zusammenfassenden Arbeit die Verbände und Einheiten des Kriegsheeres 1939—1945 von der Spitze bis hinab zu den Einheiten in Bataillons- und Abteilungsstärke darzustellen. Es setzt eine vom gleichen Verfasser in der Schriftenreihe des Bundesarchivs erschienene „Formations geschichte der Wehrmacht 1933-1939" J) fort. Die Arbeit soll gleichzeitig als ein Hilfsmittel für die wissenschaftliche Erfor schung des Krieges, wie auch als schnelles und für den Laien gut zu überschauendes Nachschlagewerk für den Gebrauch von Behörden, besonders in Versorgungs fragen, dienen. Bei der Überfülle von Material mußten die Angaben, besonders die über den Einsatz, äußerst knapp gehalten und viele bekannten Daten weggelassen werden. Trotz der Beschränkung wird da. Werk etwa 12 Bände umfassen. Es bietet eine Gesamt schau, Einzelangaben hingegen nur in strengster Auswahl. Die meisten von uns, die den Krieg mitgemacht haben, werden über ihre Einheit umfassender orientiert sein. Ober die Entwicklung aller Wehrmachtteile in ihrer Gesamtheit (Heer, Luftwaffe, Marine, Waffen SS) 2) dürfte auch der Organisationsbearbeiter an verantwortlicher Stelle wäh rend des Krieges kaum unterrichtet gewesen sein. So spiegelt die Arbeit den Aufbau der Wehrmacht wider. a) Literatur An Literatur erschien bereits 1953 eine Arbeit von Siegler über die höheren Dienst stellen der deutschen Wehrmacht.3) Sie erschien zu einem Zeitpunkt, in dem echte Unterlagen kaum zur Verfügung standen und ist auch heute noch als Nachschlagewerk ein gutes Hilfsmittel. -

Koch on Macksey, 'Guderian: Panzer General'
H-German Koch on Macksey, 'Guderian: Panzer General' Review published on Friday, August 1, 2003 Kenneth Macksey. Guderian: Panzer General. London: Greenhill Books/Lionel Leventhal, 2003. xii + 228 pp. $34.95 (cloth), ISBN 978-1-85367-538-6. Reviewed by James V. Koch (Old Dominion University) Published on H-German (August, 2003) If Germany had defeated the U.S.S.R. militarily in 1941-42, it is likely that the tightly knit Guderian clan would still today occupy the estate at Deipenhof in the Warthegau in West Prussia (now part of Poland) that was given to Generaloberst Heinz Guderian in October 1942 by Adolf Hitler. What should we make of this gift from the Fuehrer to Guderian, the acknowledged genius behind German armored forces in World War II? Was it simply one among many such secretive gifts that Hitler lavished upon the paladins and favorites of the Reich on the occasions of their anniversaries and birthdays, or when they recorded an especially notable achievement? (Guderian had been awarded the rare Oak Leaves to the Iron Cross in July 1941.) Alternatively, was it a subtle bribe to muffle an occasionally insubordinate general who, despite demonstrated affinity for National Socialism and Adolf Hitler, might have been viewed by Hitler as potentially disruptive and contentious? He was, after all, "always a rebel in his profession," according to Downing, and known for speaking his mind to nearly everyone, even to hisFuehrer .[1] Does the gift further suggest that Hitler regarded Guderian, who had been sacked for ordering a retreat south of Moscow contrary to theFuehrer's orders in December 1941, as, nonetheless, an ideological comrade? These are among the interpretative dilemmas Kenneth Macksey, veteran military historian, tackles in his revision of his original 1975 biography of Heinz Guderian. -
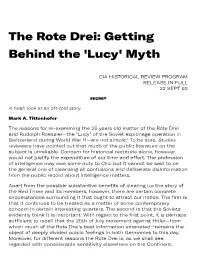
The Rote Drei: Getting Behind the 'Lucy' Myth
The Rote Drei: Getting Behind the 'Lucy' Myth CIA HISTORICAL REVIEW PROGRAM RELEASE IN FULL 22 SEPT 93 SECRET A fresh look at an oft-told story. Mark A. Tittenhofer The reasons for re-examining the 25 years old matter of the Rote Drei and Rudolph Roessler—the "Lucy" of the Soviet espionage operation in Switzerland during World War 11—are not simple.* To be sure, Studies reviewers have pointed out that much of the public literature on the subject is unreliable. Concern for historical rectitude alone, however, would not justify the expenditure of our time and effort. The profession of intelligence may owe some duty to Clio, but it cannot be said to be the general one of cleansing all confusions and deliberate disinformation from the public record about intelligence matters. Apart from the possible substantive benefits of clearing up the story of the Red Three and its members, however, there are certain concrete circumstances surrounding it that ought to attract our notice. The first is that it continues to be treated as a matter of some contemporary concern in certain interesting quarters. The second is that the Soviets evidently think it is important. With regard to the first point, it is perhaps sufficient to recall that the 20th of July movement against Hitler—from which much of the Rote Drei's best information emanated—remains the object of deeply divided public feelings in both Germanies to this day. Moreover, for different reasons the Rote Drei is, as we shall see, regarded with considerable sensitivity elsewhere on the Continent, particularly in Switzerland. -

Notes and References Documents Held at the Public Record Office, London, Are Crown Copyright and Are Reproduced by Permission of the Controller Ofhm Stationery Office
Notes and References Documents held at the Public Record Office, London, are crown copyright and are reproduced by permission of the Controller ofHM Stationery Office. I NTRODUCTION Christopher Andrew and David Dilks I. David Dilks (ed.), The Diaries rifSir Alexander Cadogan O.M. 1938-1945 (Lon don , (971) , p. 21. 2. Interview with Professor Hinsley in Part 3 of the BBC Radio 4 documentary series 'T he Profession of Intelligence', written and presented by Christopher Andrew (producer Peter Everett); first broadcast 16 Aug 1981. 3. F. H. Hinsleyet al., British Intelligencein the Second World War (London, 1979-). The first two chapters of volume I contain a useful retrospect on the pre-war development of the intelligence community. Curiously, despite the publication of Professor Hinsley's volumes, the government has decided not to release the official histories commissioned by it on wartime counter-espionage and deception. The forthcoming (non-official) collection of essays edited by Ernest R. May, Knowing One's Enemies: IntelligenceAssessment before the Two World Wars (Princeton) promises to add significantly to our knowledge of the role of intelligence on the eve of the world wars. 4. House of Commons Education, Science and Arts Committee (Session 1982-83) , Public Records: Minutes ofEvidence, pp . 76-7. 5. Chapman Pincher, Their Trade is Treachery (London, 1981). Nigel West, A Matter of Trust: MI51945-72 (London, 1982). Both volumes contain ample evidence of extensive 'inside information'. 6. Nigel West , MI5: British Security Operations /90/-/945 (London, 1981), pp . 41, 49, 58. One of the most interesting studies of British peacetime intelligence which depends on a substantial amount of inside information is Antony Verrier's history of post-war British foreign policy , Through the Looking Glass (London, 1983) . -

War Gaming”, by General Der Infanterie A.D. Rudolf M. Hofmann
MS # P-094 WAR GAMES by Rudolf M. Hofmann, General der Infanterie a.D. WITH A FORWORD BY GENERALOBERST a.D. FRANZ HALDER Translator: P. Luetzkendorf Editor: F. B. Robinson Reviewer: Capt. W. Ross Historical Division HEADQUARTERS UNITED STATES ARMY, EUROPE 1952 v MS # P-094 This version was OCR’d (20 July 2020) from a PDF of the original and reformatted to improve readability and make the document text searchable. Hard page breaks have been introduced to ensure page numbers are consistent with the original so that any “by page number” references in other documents remain accurate. vi MS # P-094 Contents Front Material Reviewers Evaluation of MS # P-094 .......................................................................... vii Biography of General der Infanterie a.D. Rudolf M. Hoffman, ................................. viii Forward by Generaloberst a.D. Franz Halder .............................................................. ix The Authors ................................................................................................................. xi Project as Assigned by the Historical Division SSUSA ................................................ xiii Origin of Wargames (extract) .................................................................................... xiv Chapter 1. The Various Kinds of War Games ------------------------------------------1 I. Introduction ............................................................................................................. 1 II. Explanation of the Various types of Wargames -

Subject Reference Dbase 09-05-2006
Subject reference dbase 09-05-2006 ONDERWERP TYPE NUMMER BIJZ GROEP TREFWOORD1 TREFWOORD2 ELECTRON 1958.12 1958.12 ELEC Z 46 TEK CX GEVR L,KWANTONETC KUBEL TS-N KERST CX LW,KW,LO 0,5/1 KW LW SEND 2.39 As 33/A1 34 Z 101 100-1000 KHZ MOB+FEST MOBS 0,7/1,4 KW SEND AS 60 10.40 AS 60 Z 101 FRUEHE AUSF 3-24 MHZ MOB+FEST MOBS 1 KWTT KW SEND 11.37 S 521 Bs Z 101 =+/-G 1,5.... MOBS 1 KWTT SHORT WAVE TR 5.36 S 486F Z 101 3-7 UND 2,5-6 MHZ MOBS 1 kW KW SEND S 521Bs TELEFUNKEN Z 172 +/-G 1,2K MOBS G1,2K+/- 10 WTT TELEF SENDER 10.34 S 318H Z 101 1500-3333 KHZ GUSS GEH SCHS 100 WTT SEND S 317H TELEFUNKEN Z 172 RS 31g 100-800METER alt SCHS S317H 100 WTT SENDER 4.33 S 317 H Z 101 UNIVERS SENDER 377-3000KHZ MOBS 15 W EINK SEND EMPF 10.35 Stat 272 B Z 101 +/- 15 W SE 469 SE 5285 F1/37 TRSE 15 WTT KARREN STN 4.40 SE 469A Z 101 3-5 MHZ TRSE 15 WTT KW STN 10.35 Spez804/445 Z 101 S= 804Bs E= Spez 445dBg 3-7,5M TRSE 150 WTT LANGW SENDE ANL 8.39 Stat 1006aF Z 101 S 427F SA 429F FLFU 1898-1938 40 JAAR RADIO IN NED SWIERSTRA R. Z 143 INLEGVEL VAN SWIERSTA PRIVE'38 LI 40 RADIO!! WILHELMINA 1kW KW SEND S 486F TELEFUNKEN Z 172 +/-2,5-7,5MHZ MOBS S486 1,5 LW SEND S 366Bs 11.37 S 366Bs Z 101 =+/- G1,5...100-600 KHZ MOBS 1,5kW LW SEND S366Bs TELEFUNKEN Z 172 +/-G 1,5L MOBS S366Bs S366BS 20 WTT FL STN 3.35 Spez 378mF Z 101 TELEF D B FLFU 20 WTT FLUGZEUG STN Spez 378nF TELEFUNKEN Z 172 URALT ANL LW FEST FREQU FLFU Spez378nF Spez378NF 20 WTT MITTELWELL GER Stat901 TELEFUNKEN Z 172 500-1500KHZ Stat 901A/F FLFU 200 WTT KW SEND AS 1008 11.39 AS 1008 Z 101 2,5-10 MHZ A1,A2,A3,HELL -

How the Germans Brought Their Communism to Yemen
Miriam M. Müller A Spectre is Haunting Arabia Political Science | Volume 26 This book is dedicated to my parents and grandparents. I wouldn’t be who I am without you. Miriam M. Müller (Joint PhD) received her doctorate jointly from the Free Uni- versity of Berlin, Germany, and the University of Victoria, Canada, in Political Science and International Relations. Specialized in the politics of the Middle East, she focuses on religious and political ideologies, international security, international development and foreign policy. Her current research is occupied with the role of religion, violence and identity in the manifestations of the »Isla- mic State«. Miriam M. Müller A Spectre is Haunting Arabia How the Germans Brought Their Communism to Yemen My thanks go to my supervisors Prof. Dr. Klaus Schroeder, Prof. Dr. Oliver Schmidtke, Prof. Dr. Uwe Puschner, and Prof. Dr. Peter Massing, as well as to my colleagues and friends at the Forschungsverbund SED-Staat, the Center for Global Studies at the University of Victoria, and the Political Science Depart- ment there. This dissertation project has been generously supported by the German Natio- nal Academic Foundation and the Center for Global Studies, Victoria, Canada. A Dissertation Submitted in (Partial) Fulfillment of the Requirements for the- Joint Doctoral Degree (Cotutelle) in the Faculty of Political and Social Sciences ofthe Free University of Berlin, Germany and the Department of Political Scien- ceof the University of Victoria, Canada in October 2014. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommer- cial-NoDerivs 4.0 (BY-NC-ND) which means that the text may be used for non- commercial purposes, provided credit is given to the author. -

Spy Lingo — a Secret Eye
A Secret Eye SpyLingo A Compendium Of Terms Used In The Intelligence Trade — July 2019 — A Secret Eye . blog PUBLISHER'S NOTICE: Although the authors and publisher have made every eort to ensure that the information in this book was correct at press time, the authors and publisher do not assume and hereby disclaim any liability to any party for any loss, damage, or disruption caused by errors or omissions, whether such errors or omissions result from negligence, TEXTUAL CONTENT: Textual Content can be reproduced for all non-commercial accident, or any other cause. purposes as long as you provide attribution to the author / and original source where available. CONSUMER NOTICE: You should assume that the author of this document has an aliate relationship and/or another material connection to the providers of goods and services mentioned in this report THIRD PARTY COPYRIGHT: and may be compensated when you purchase from a To the extent that copyright subsists in a third party it provider. remains with the original owner. Content compiled and adapted by: Vincent Hardy & J-F Bouchard © Copyright 9218-0082 Qc Inc July 2019 — Spy Lingo — A Secret Eye Table Of Contents INTRODUCTION 4 ALPHA 5 Ab - Ai 5 Al - As 6 Au - Av 7 Bravo 8 Ba - Bl 8 Bl - Bre 9 Bri - Bu 10 CHARLIE 11 C3 - Can 11 Car - Chi 12 Cho - Cl 13 Cn - Com 14 Comp - Cou 15 Cov 16 Cu 17 DELTA 18 Da - De 18 De - Di 19 Di - Dru 20 Dry - Dz 21 Echo 22 Ea - Ex 22 Ey 23 FOXTROT 24 Fa - Fi 24 Fl - For 25 Fou - Fu 26 GOLF 27 Ga - Go 27 Gr - Gu 28 HOTEL 29 Ha - Hoo 29 Hou - Hv 30 INDIA 31 Ia -

Transkribierte Fassung
Die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand und des Todes Qual berührt sie nicht. Den Augen der Toren schienen sie zu sterben. Als Unglück wurde ihr Ende angesehen, ihr Scheiden von uns als Untergang: Sie aber sind in Frieden. Wenn sie auch bei den Menschen Qualen erlitten, so ist doch ihre Hoffnung voll der Unsterblichkeit. Ein wenig nur wurden sie gepeinigt, aber viel Herrliches wird ihnen widerfahren. Denn Gott hat sie geprüft und er fand sie seiner wert. Wie Gold im Ofen hat er sie geprüft und wie ein Brandopfer sie angenommen. Zu seiner Zeit wird man nach ihnen schauen. Sie werden die Völker richten und über die Nationen herrschen und der Herr wird ihr König sein in Ewigkeit. (Buch der Weisheit Salomonis 3, 1–8) † Nach Gottes heiligem Willen und in der Kraft ihres Glaubens starben den Heldentod im freien, ehrenvolle Kampfe für Wahrheit und Recht, für des Deutschen Volkes Freiheit, für der Deutschen Waffen Reinheit und Ehre, als bewußte Sühne für das vor Gott verübte Unrecht unseres Volkes die Führer der aktiven Widerstands-Bewegung des 20. Juli 1944: Ludwig Beck, Generaloberst, erschossen 20. Juli 1944 Dr. Karl Goerdeler, vorm. Oberbürgerm., erhängt 1. Febr. 1945 Graf Claus Schenk von Stauffenberg, Oberst i. G., erschossen 20. Juli 1944 Erwin v. Witzleben, Generalfeldmarschall, erhängt 8. Aug. 1944 – zusammen mit zahlreichen Kameraden aus der Armee und aus allen Stämmen, Ständen und Parteien des Deutschen Volkes – namentlich: ╬ Robert Bernardis, Oberstleutnant † 8. Aug. 1944 Albrecht Graf von Bernstorff, Botschaftsrat † 23. April 1945 Hans-Jürgen Graf v. Blumenthal, Major i. G. † 13. Okt. 1944 Hasso von Boehmer, Oberstleutnant i. -

The Gallipoli Gazette OFFICIAL ORGAN of the GALLIPOLI MEMORIAL CLUB LTD
Vol. 50, No.4 (New Series) SUMMER 2020 The Gallipoli Gazette OFFICIAL ORGAN OF THE GALLIPOLI MEMORIAL CLUB LTD WW2 spy Agent Sonya later stole Atom Bomb secrets The incredible story behind probably the greatest female spy ever who altered the course of history in her decades as a Russian spy. British housewife, Mrs. brother, Jurgen became a noted Ursula joined the German Ursula Beurton, was a devoted historian-economist who also Communist Party. wife and mother-of-three who dabbled in espionage. Also in 1926 she attended a epitomised rural British dom- This prosperous family lived librarianship academy and the esticity in her quiet Cotswolds in southwest Berlin. In 1918, following year was employed by village of Great Rollright during when aged 11, she acted in a the large Berlin publisher Ullstein World War Two. silent movie, The House of Three Verlag. She was sacked in 1928 She would wave to her Girls. On leaving school Ursula after participating in a May Day neighbours as she pedaled her was apprenticed as a book dealer. rally. bicycle through the Oxfordshire In 1924 she joined the left-leaning For nine months from countryside to gather scientific Free Employees League, the December 1928 she worked in a intelligence from one of the Young Communists and New York book shop. On country's most brilliant nuclear Germany's Red Aid. In 1926 returning to Berlin she married physicists and then transmit it to Rudolf Hamburger, an architect Soviet intelligence head- and fellow Communist quarters via the radio Party member. They set transmitter she was up the Marxist Workers' hiding in her outdoor Library that she headed privy.