Der Beteiligungsprozess Am Klimaschutzplan 2050 | 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Plenarprotokoll 17/97
Plenarprotokoll 17/97 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 97. Sitzung Berlin, Freitag, den 18. März 2011 Inhalt: Absetzung der Tagesordnungspunkte 28 und 31 11137 A Basis des Prognosehorizontes 2025 planen – zu dem Antrag der Abgeordneten Tagesordnungspunkt 27: Winfried Hermann, Kerstin Andreae, a) Beschlussempfehlung und Bericht des Alexander Bonde, weiterer Abgeord- Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadt- neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/ entwicklung DIE GRÜNEN: Rheintalbahn – Mo- dellprojekt für anwohnerfreundli- – zu dem Antrag der Abgeordneten chen Schienenausbau Steffen Bilger, Peter Götz, Armin Schuster (Weil am Rhein), weiterer (Drucksachen 17/4861, 17/4856, 17/3659, Abgeordneter und der Fraktion der 17/2488, 17/4689, 17/5091) . 11113 A CDU/CSU sowie der Abgeordneten b) Antrag der Abgeordneten Karin Binder, Werner Simmling, Ernst Burgbacher, Sabine Leidig, Herbert Behrens, weiterer Sibylle Laurischk, weiterer Abgeord- Abgeordneter und der Fraktion DIE neter und der Fraktion der FDP: An- LINKE: Schutz vor Schienenverkehrs- wohnerfreundlicher Ausbau der lärm im Rheintal und andernorts Rheintalbahn (Drucksache 17/5036) . 11113 D – zu dem Antrag der Abgeordneten Ute c) Antrag der Abgeordneten Ute Kumpf, Kumpf, Christian Lange (Backnang), Gustav Herzog, Sören Bartol, weiterer Rainer Arnold, weiterer Abgeordneter Abgeordneter und der Fraktion der SPD und der Fraktion der SPD: Ausbau sowie der Abgeordneten Winfried Hermann, der Rheintalbahn als Modell für Kerstin Andreae, Alexander Bonde, weite- Bürgernähe, Lärm- und Land- rer Abgeordneter und der Fraktion BÜND- schaftsschutz NIS 90/DIE GRÜNEN: Rheintalbahn – – zu dem Antrag der Abgeordneten Finanzierung und anwohnerfreundli- Karin Binder, Dr. Dietmar Bartsch, chen Ausbau sicherstellen Herbert Behrens, weiterer Abgeord- (Drucksache 17/5037) . 11113 D neter und der Fraktion DIE LINKE: Tanja Gönner, Ministerin Akzeptanzprobleme bei der Rhein- (Baden-Württemberg) . -

Rausch Zuständig Für Verbraucher
politik & �����������������Ausgabe���������� Nr. 232� kommunikation politikszene 27.4. – 3.5.2009 �������������� Kommunikationsexperte Schweer zum BDI ����������������������������������������������Dieter Schweer (55) soll ab 15. Mai stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) werden. Er folgt auf Klaus Bräuning (55), der bereits im April vergan- ��������������������������������������������������������������genen Jahres in die Geschäftsführung des Verbands der��������������������� Automobilindustrie gewechselt ist.�������� In seiner ����������������������������������������������������������������������������������������neuen Funktion soll Schweer BDI-Hauptgeschäftsführer Werner Schnappauf (55) dabei unterstützen,�������� ����������������������������������������������������������������������������������������die internen Strukturen des Verbands zu modernisieren. Schweer ist seit 2006 geschäftsführender� ����������� �����������������������������������������������������������������������������������������������Gesellschafter der von ihm gegründeten Kommunikationsagentur Schweer Executive Communication ����������������������������������������������������������Solution. Von 1996 bis 2003 war er Kommunikationschef��������������������� des Energiekonzerns� RWE. Davor war er Dieter Schweer unter anderem bei der Hypo-Vereinsbank-Gruppe tätig. ���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������Pronold -
Verantwortung Für Die Zukunft Themenwochen Der CDU Südbaden
Verantwortung für die zukunft themenwochen DER CDU Südbaden SÜDBADEN SÜDBADEN Verantwortung für die zukunft OG RW EM VS TUT FR BHS KN LÖ WT Die CDU-Kreisverbände im Bezirksverband Südbaden starten mit einem vielseitigen Programm aktiv in den Herbst. OG Ortenau EM Emmendingen FR Freiburg BHS Breisgau-Hochschwarzwald LÖ Lörrach WT Waldshut RW Rottweil VS Schwarzwald-Baar TUT Tuttlingen KN Konstanz VORWORT Sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlich lade ich Sie zum Mitmachen bei den „Themenwochen der CDU Südbaden“ ein. Wir sind ein lebendiger, vielseitiger Verband mit 18.500 Mitgliedern. In unseren zehn Kreisverbänden und vielen Vereinigungen engagieren sich unzählige Frauen und Männer ehrenamtlich vor Ort; Alt und Jung wollen gemeinsam der Zukunftsverantwortung gerecht werden. Im Herbst 2010 wollen wir Ihnen erneut unsere thematische und personel- le Bandbreite vorstellen: Wir kümmern uns um die Themen, die uns allen auf den Nägeln brennen. Kommen Sie vorbei, lernen Sie unsere Mandats- träger und andere CDU-Mitglieder kennen und machen Sie sich selbst ein Bild von unserer Arbeit. Ob Sie schon Mitglied der CDU sind oder nicht: Ich lade Sie herzlich ein, uns (besser) kennenzulernen. Mit freundlichen Grüßen Ihr Minister Willi Stächele MdL Bezirksvorsitzender der CDU Südbaden Verantwortung für die zukunft SePteMBer LÖ Kommunalpolitische Vereinigung (KPV) des CDU-Kreisverbandes Lörrach Freitag, 17. September 2010, 12.30 – 14.30 Uhr Finanzminister Willi Stächele MdL und Ulrich Lusche MdL zum Thema „Kommunalfinanzen“ Stadtbibliothek, Basler Straße 152, 79539 Lörrach www.cdu-kv-loerrach.de Arbeitskreis Polizei des CDU-Bezirksverbandes Südbaden KN Montag, 20. September 2010, 9 Uhr Fachkongress „Innere Sicherheit“ mit Innenminister Heribert Rech MdL „Haus St. -

Nein-Stimmen: 32 Enthaltungen: 13 Ungültige: 0
Deutscher Bundestag 89. Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 27.Februar 2015 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1 Antrag des Bundesministeriums der Finanzen Finanzhilfen zugunsten Griechenlands; Verlängerung der Stabilitätshilfe Einholung eines zustimmenden Beschlusses des Deutschen Bundestages nach § 3 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 2 Nummer 2 des Stabilisierungsmechanismusgesetzes auf Verlängerung der bestehenden Finanzhilfefazilität zugunsten der Hellenischen Republik Drs. 18/4079 und 18/4093 Abgegebene Stimmen insgesamt: 586 Nicht abgegebene Stimmen: 45 Ja-Stimmen: 541 Nein-Stimmen: 32 Enthaltungen: 13 Ungültige: 0 Berlin, den 27.02.2015 Beginn: 11:05 Ende: 11:10 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Stephan Albani X Katrin Albsteiger X Peter Altmaier X Artur Auernhammer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Günter Baumann X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. Andre Berghegger X Dr. Christoph Bergner X Ute Bertram X Peter Beyer X Steffen Bilger X Clemens Binninger X Peter Bleser X Dr. Maria Böhmer X Wolfgang Bosbach X Norbert Brackmann X Klaus Brähmig X Michael Brand X Dr. Reinhard Brandl X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Dr. Helge Braun X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Alexandra Dinges-Dierig X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Jutta Eckenbach X Dr. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Dr. Thomas Feist X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. -
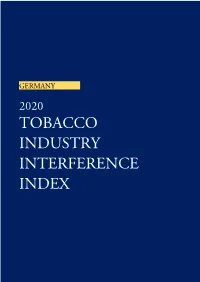
TOBACCO INDUSTRY INTERFERENCE INDEX September 2020
GERMANY 2020 TOBACCO INDUSTRY INTERFERENCE INDEX September 2020 Acknow e!"ements $%# report w&# written by L&)ra Graen. $e a)thor wo) ! l%ke to th&nk Katrin Sch& er and Ute Mons o- t+e Germ&n C&ncer Re#e&rch Center (DKF/0, Jo+&nne# Spatz o- Forum Smoke4Free, J&n Sch) 3 and Sonj& von Eichborn o- Unf&irtobacco1 M&rtina Pötsc+ke4(&nger o- the Germ&n Smoke-ree A %&nce (ABNR0 a# we a# Timo L&nge o- LobbyContro w+o pro6%!e! input and fee!back. $e a)thor wo) ! a #o like to e9pre## sincere gratitu!e to M&ry A##)nta o- t+e G oba Center for Goo! Go6ernance in Tobacco Contro (GGTC0 for her technica a!vice* $%# report i# f)nde! by B oomberg Ph% &nthropie# t+ro)"+ Stoppin" Tobacco Org&niz&tions &nd Pro!)cts (STO70* Endorse! by Germ&n Me!ica Action Gro)p Smoking or He& th (;ARG0, Germ&n NCD A %&nce (DANK), Germ&n Re#piratory Societ' (DG70, Germ&n C&ncer Re#e&rch Center (DKF/01 FACT e*<. – >omen A"&inst Tobacco1 Frie!en#band1 Institute for Therapy and He& th Re#e&rch (IFT Nord01 Center for A!!iction Prevention Ber in, R&)ch-rei Pl)# – He& th f&cilitie# for co)nse ing and tobacco ce##&tion, Unf&irtobacco1 V%6&nte# Ho#pita Ne)kö n 2 Table o- Content# B&ckgro)nd and Intro!)ction*****************************************************************************************************? Tobacco and H)m&n r%"+t#*****************************************************************************************************? (&ck o- Tobacco Contro Me&#)re# in Germ&ny D)e to Ind)#tr' Interference************************? Tobacco Ind)#tr' in Germ&ny*************************************************************************************************@ -

2019 11 13 Einladung FG
Einladung Fachgespräch Eigentum schützen, Rechtssicherheit schaffen – Landwirtschaft ist Mittelstand Sehr geehrte Damen und Herren, die Landwirtschaft ist das Herzstück der deutschen Ernährungswirtschaft. Diese stellt mit ihren gut 700.000 Betrieben und mehr als 5,5 Millionen Beschäftigten einen wichtigen Wirtschaftszweig auf dem Land dar. Landwirtschaft ist Mittel- stand. Jedes zwölfte klein- und mittelständische Unternehmen ist ein Agrar- betrieb. Im Zeitalter erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe ist die Landwirtschaft auch Motor für Innovationen. Doch unsere Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Die Flächen werden knapper und die Auflagen schärfer. Die Erwartungen von Verbrauchern und Medien steigen. Das Konsumverhalten orientiert sich aber weiterhin stark am Preis. Für viele Bauernfamilien wird es eng. Immer mehr Betriebe stellen sich die Frage: Können wir den Hof noch halten? Sind wir noch gewünscht? Auf welche Bedingungen können wir uns einstellen? Der Parlamentskreis Mittelstand will die Situation der Betriebe beleuchten und über gesetzgeberische Maßnahmen sprechen. Im Mittelpunkt wird dabei die Frage stehen, was unsere landwirtschaftlichen Betriebe für die Zukunft brauchen. Zu dieser Veranstaltung laden wir Sie herzlich ein für Mittwoch, den 13. November, von 13.30 bis 15.30 Uhr, in den Sitzungssaal der CDU/CSU- Fraktion im Deutschen Bundestag, Reichstagsgebäude, Raum 3N001, Berlin. Über Ihre Teilnahme würden wir uns freuen. Gerne können Sie die Einladung an andere Interessierte weiterleiten. Mit freundlichen Grüßen Christian Freiherr von Stetten MdB Gitta Connemann MdB Dr. Carsten Linnemann MdB Vorsitzender Parlamentskreis Mittelstand Stellvertretende Vorsitzende Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion der CDU/CSU-Fraktion der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag im Deutschen Bundestag im Deutschen Bundestag Programm Fachgespräch Eigentum schützen, Rechtssicherheit schaffen – Landwirtschaft ist Mittelstand Mittwoch, 13. -
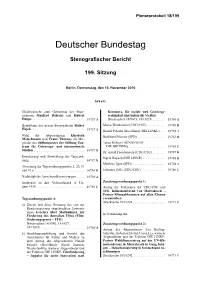
Plenarprotokoll 18/199
Plenarprotokoll 18/199 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 199. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 10. November 2016 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abge- Kommerz, für soziale und Genderge- ordneten Manfred Behrens und Hubert rechtigkeit und kulturelle Vielfalt Hüppe .............................. 19757 A Drucksachen 18/8073, 18/10218 ....... 19760 A Begrüßung des neuen Abgeordneten Rainer Marco Wanderwitz (CDU/CSU) .......... 19760 B Hajek .............................. 19757 A Harald Petzold (Havelland) (DIE LINKE) .. 19762 A Wahl der Abgeordneten Elisabeth Burkhard Blienert (SPD) ................ 19763 B Motschmann und Franz Thönnes als Mit- glieder des Stiftungsrates der Stiftung Zen- Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/ trum für Osteuropa- und internationale DIE GRÜNEN) ..................... 19765 C Studien ............................. 19757 B Dr. Astrid Freudenstein (CDU/CSU) ...... 19767 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Sigrid Hupach (DIE LINKE) ............ 19768 B nung. 19757 B Matthias Ilgen (SPD) .................. 19769 A Absetzung der Tagesordnungspunkte 5, 20, 31 und 41 a ............................. 19758 D Johannes Selle (CDU/CSU) ............. 19769 C Nachträgliche Ausschussüberweisungen ... 19759 A Gedenken an den Volksaufstand in Un- Zusatztagesordnungspunkt 1: garn 1956 ........................... 19759 C Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: Klimakonferenz von Marrakesch – Pariser Klimaabkommen auf allen Ebenen Tagesordnungspunkt 4: vorantreiben Drucksache 18/10238 .................. 19771 C a) -

500 Jahre Reinheitsgebot
Bavaria rs 500 Yea aw Purity L of 016 to 23, 2 April 21 Jubiläumsveranstaltung 21. bis 23. April 2016 Spalier der Garde in historischen Kostümen zur Begrüßung der Festgäste am 21. April / Bayerische Bier-, Hallertauer Hopfen- und Herrnbräu-Weißbierkönigin beim Guard of honor in historical costumes to welcome the guests on April 21 Festzug in Ingolstadt / The Bavarian Beer Queen, the Hallertau Hop Queen and the Herrnbräu Wheat Beer Queen ready for the procession in Ingolstadt 78 Hopfen-Rundschau International 201 6/ 2017 Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt eröffnete den Deutschen Brauertag in Ingolstadt Brauer feierten dasC 500-jähhrigre iJusbitläuima dnes R einSheitscghebomtes idt Ingolstadt, 21. April 2016. Bundeslandwirtschafts- Christian Schmidt, German Federal minister Christian Schmidt eröffnete am Donnerstag - Minister of Food and Agriculture, abend den „Deutschen Brauertag“ im oberbayerischen Ingolstadt. Das traditionelle Treffen von Brauern und opened the German Brewers' Mälzern aus Deutschland und Europa stand in diesem Congress in Ingolstadt Jahr ganz im Zeichen des Jubiläums des weltbekannten Brewers celebrated the 500th anniversary Reinheitsgebotes für Bier. Dieses Gebot war vor 500 of the purity law Jah ren in Ingolstadt im Rahmen einer Landesordnung erlassen worden. Galt das Reinheitsgebot zunächst nur Ingolstadt, April 21, 2016. On Thursday evening, für das Herzogtum Bayern, wurde es nach der Verkün - April 21, 2016, Christian Schmidt, German Feder- dung am 23. April 1516 von mehr und mehr Ländern al Minister of Food and Agriculture, opened the übernommen und ist seit 1906 geltendes Recht in ganz German Brewers' Congress in the Upper Bavarian Deutschland. Das Reinheitsgebot schreibt vor, dass zur city of Ingolstadt. The traditional meeting of Bierherstellung nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe ver - brewers and maltsters from Germany and the wendet werden dürfen. -

Plenarprotokoll 16/63
Plenarprotokoll 16/63 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 63. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 9. November 2006 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag des Abgeord- Innovation forcieren – Sicherheit im neten Dr. Max Lehmer . 6097 A Wandel fördern – Deutsche Einheit vollenden Wahl der Abgeordneten Dr. Michael Meister (Drucksache 16/313) . 6099 A und Ludwig Stiegler in den Verwaltungsrat der Kreditanstalt für Wiederaufbau . 6097 B d) Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadt- Wahl der Abgeordneten Angelika Krüger- entwicklung: Leißner als ordentliches Mitglied und der Abgeordneten Dorothee Bär als stellvertre- – zu der Unterrichtung durch die Bun- tendes Mitglied der Vergabekommission der desregierung: Jahresbericht der Bun- Filmförderanstalt . 6097 B desregierung zum Stand der deut- Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- schen Einheit 2005 nung . 6097 C – zu dem Entschließungsantrag der Ab- Absetzung der Tagesordnungspunkte 14, 22, geordneten Arnold Vaatz, Ulrich 26 und 32 . 6098 C Adam, Peter Albach, weiterer Abge- ordneter und der Fraktion der CDU/ Änderung der Tagesordnung . 6098 D CSU sowie der Abgeordneten Stephan Hilsberg, Andrea Wicklein, Ernst Bahr (Neuruppin), weiterer Abgeordneter Tagesordnungspunkt 3: und der Fraktion der SPD zu der Un- terrichtung durch die Bundesregie- a) Unterrichtung durch die Bundesregierung: rung: Jahresbericht der Bundesre- Jahresbericht der Bundesregierung gierung zum Stand der deutschen zum Stand der deutschen Einheit 2006 Einheit 2005 (Drucksache 16/2870) . 6098 -

Kleine Anfrage Der Abgeordneten Gitta Connemann, Annette Widmann-Mauz, Ursula Heinen, Peter H
Deutscher Bundestag Drucksache 15/5060 15. Wahlperiode 08. 03. 2005 Kleine Anfrage der Abgeordneten Gitta Connemann, Annette Widmann-Mauz, Ursula Heinen, Peter H. Carstensen (Nordstrand), Marlene Mortler, Artur Auernhammer, Peter Bleser, Helmut Heiderich, Uda Carmen Freia Heller, Dr. Peter Jahr, Julia Klöckner, Bernhard Schulte-Drüggelte, Kurt Segner, Jochen Borchert, Cajus Julius Caesar, Hubert Deittert, Thomas Dörflinger, Gerda Hasselfeldt, Susanne Jaffke, Heinrich- Wilhelm Ronsöhr, Dr. Klaus Rose, Norbert Schindler, Georg Schirmbeck, Max Straubinger, Volkmar Uwe Vogel und der Fraktion der CDU/CSU Risiken einer Lockerung des Importverbotes für Geflügel aus Asien angesichts der Entwicklung der Vogelgrippe als zunehmende Gefahr auch für Menschen In vielen asiatischen Staaten sind schon seit einiger Zeit Geflügelbestände mit aviären Influenzaviren (sog. Vogelgrippe)infiziert. 1997 erkrankten erstmals bei einem Ausbruch hochpathogener aviärer Influenzaviren in Hongkong auch Menschen, einige starben an den Symptomen. Ursache war das Influenzavirus Typ H5N1. Ende 2003 brach die Vogelgrippe (Virustyp H5N1) erneut in ver- schiedenen Staaten Südostasiens aus. Die Epidemie griff nach Europa über. Un- ter anderem wurden Geflügelbestände in den Niederlanden infiziert. Daraufhin verhängte die Europäische Kommission im Februar 2004 Importverbote für Geflügel aus Asien, im Falle von Thailand für die Dauer von zwölf Monaten. Die Bilanz des letztjährigen Seuchenzuges war verheerend. Millionen Tiere mussten getötet werden oder verendeten. Zahlreiche Menschen starben. Zu den Opfern zählten insbesondere Menschen, die von Berufs wegen mit den erkrank- ten Tieren zu tun hatten. Seither grassiert das Virus in den Ländern Südostasiens mit kaum verminderter Intensität. Allein zwischen Dezember des letzten Jahres bis zu Beginn dieses Jahres sind dort weitere neun Menschen an der Vogelgrippe gestorben. -

PKM-Journal in Neuem Gewand Heißer Herbst
Nachrichten und Kommentare zur Mittelstandspolitik Nr. 3| 23. Oktober 2012 In eigener Sache PKM-Journal in neuem Gewand Heißer Herbst Mit dem neuen Erscheinungsbild der Fraktion haben wir Die Bundeskanzlerin hat es bereits in der Sommerpause auch das gute alte PKM-Journal ein wenig modernisiert: mehrfach vorhergesagt: Uns steht ein heißer Herbst bevor. Neben dem neuen Layout, das übersichtlicher und leser- Der Endspurt der Legislaturperiode bis zur Bundestagswahl freundlicher sein soll, wird das Journal zukünftig auch im nächsten Jahr hat begonnen. Wichtige Gesetzesvorha- deutlich kürzer sein, aber ben müssen noch auf den Weg gebracht und bzw. oder bis dafür häufiger erscheinen. zum nächsten Sommer beschlossen werden. Dabei wird Das Journal soll Ihnen alle der politische Alltag im Bundestag nach wie vor von der vier bis sechs Wochen ei- Staatsverschuldungskrise und der Energiewende be- nen kurzen Überblick über stimmt. Aber die letzten Entwicklungen stimmen positiv – die aktuelle Arbeit des PKM auch weil wir mit unserer Bundeskanzlerin Dr. Angela Mer- vermitteln. Um dennoch kel, dem Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble und auch längere Texte einbin- unserem Bundesumweltminister Peter Altmaier herausra- den zu können, ist es unser gende Politiker in unseren Reihen haben, die mit Sachkom- Ziel, das Journal Schritt für petenz, Durchsetzungsvermögen aber auch viel Feingefühl Schritt zu einem elektroni- diese schwierigen Themen erfolgreich vorantreiben und schen Journal umzubauen, den Dialog mit dem PKM suchen (http://www.handelsblatt. bei dem wir über Verlin- com/politik/deutschland/pakt-mit-fdp-verraten-cdu-wirt- kungen auch längere Texte schaftsfluegel-rechnet-mit-merkel-ab/7002162.html). in das Journal einbeziehen Aber auch das politische Alltagsgeschäft verdient und be- können. -

Rede Der Bundesministerin Für Ernährung Und Landwirtschaft Julia Klöckner
- 1 - Rede der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Julia Klöckner Es gilt das gesprochene Wort! Sperrfrist: Redebeginn Liebe Gitta Connemann, lieber Volker Kauder, lieber Alexander Dobrindt, sehr verehrte Frau Präsidentin [Gerda] Hasselfeldt, Präsidentin Deutsches Rotes Kreuz e.V. sehr geehrter Herr Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Geschäftsführendes Präsidialmitglied, Deutscher Landkreistag sehr geehrter Herr Dr. [Reiner] Klingholz, Geschäftsführender Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung sehr geehrter Herr [Axel] Gedaschko, Präsident Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmer e.V. sehr geehrte, liebe Frau [Nina] Sehnke, Bundesvorsitzende Bund Deutscher Landjugend e.V. - 2 - liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste der Fraktion! I. Einleitung Ich bin der Fraktion, lieber Volker Kauder, liebe Gitta Connemann, für die Veranstaltung dieses Kongresses sehr dankbar. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Organisation einer solchen Veranstaltung immer von vielen externen Faktoren abhängt, da man solch ein Event ja nicht von heute auf morgen plant. Beim Thema war vorher klar, das ist ein Volltreffer: - 3 - Die Zukunft der ländlichen Räume, die Diskussion um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, um Heimat, verbunden mit der Aufgabe der Politik, eine Zunahme von Disparitäten zu verhindern, ist allgegenwärtig. Aber beim Timing so einer Veranstaltung kann auch mal was schief gehen. Heute jedoch kann ich Euch nur beglückwünschen, denn Ihr habt eine Punktlandung hinbekommen. II. Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse gegründet Vor nicht einmal drei Stunden haben Horst Seehofer, die Kollegin Giffey und ich die erste Sitzung der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse der Bundesregierung geleitet. - 4 - Auch unsere Bundeskanzlerin Dr.