Trumpf Oder Bluff?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Deutsche Generäle in Britischer Gefangenschaft 1942–1945. Eine
289 Von vielen deutschen Generälen des Zweiten Weltkriegs sind häufig nur die Laufbahndaten bekannt; Briefe und Tagebücher liegen nur wenige vor. Für die For schung sind sie oft genug nur eingeschränkt zugänglich. So fällt es nach wie vor schwer, zu beurteilen, wie die Generale selbst die militärischen und politischen Geschehnisse der Zeit zwischen 1939 und 1945 rezipiert haben und welche Folgerungen sie daraus zogen. Wichtige Aufschlüsse über ihre Kenntnisse von den nationalsozialistischen Massenmorden oder ihr Urteil über den deutschen Widerstand gegen Hitler bieten jedoch die Abhörprotokolle deutscher Stabsoffiziere in britischer Kriegsgefangen schaft. Sönke Neitzel Deutsche Generäle in britischer Gefangenschaft 1942-1945 Eine Auswahledition der Abhörprotokolle des Combined Services Detailed Interrogation Centre UK Die deutsche Generalität hat sich der öffentlichen Reflexion über ihre Rolle wäh rend des Zweiten Weltkrieges weitgehend verschlossen. Das Bild, das sie vor allem in ihren Memoiren von sich selbst zeichnete, läßt sich verkürzt auf die Formel bringen: Sie hat einen sauberen Krieg geführt, hatte von Kriegsverbrechen größe ren Ausmaßes keine oder kaum Kenntnis, und die militärische Niederlage war zu einem Gutteil den dilettantischen Eingriffen Hitlers als Obersten Befehlshaber in die Kriegführung zuzuschreiben. Es erübrigt sich näher darauf einzugehen, daß dieses Bild von der Geschichts wissenschaft längst gründlich widerlegt worden ist. Aber nach wie vor wissen wir wenig darüber, wie die Generäle die Zeit zwischen 1939 und 1945 rezipiert haben, welche Kenntnis sie von den militärischen und politischen Geschehnissen hatten, die über ihren engen Arbeitsbereich hinausgingen, und welche Schlußfolgerungen sie hieraus zogen. Zur Durchleuchtung dieses Komplexes ist vor allem der Rück griff auf persönliche Quellen wie Briefe und Tagebücher notwendig, die allerdings nur von einem kleinen Personenkreis vorliegen und zudem oft auch nur beschränkt zugänglich sind, da sie sich in Privatbesitz befinden1. -
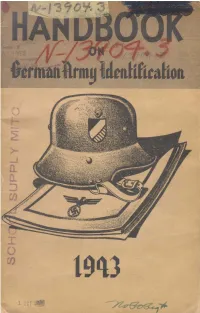
Handbook on German Army Identification
c rx . zt'fa. "r' w FOREWORD THIS HANDBOOK was prepared at the Military Intelligence Training Center, Camp Ritchie, Maryland, and is designed to provide a ready reference manual for intelligence person- nel in combat operations. The need for such a manual was so pressing that some errors and omissions are anticipated in the current edition. Any suggestions as to additions, or errors noted, should be reported directly to the Comman- dant, Military Intelligence Training Center, for correction in later editions. 513748 -- 43---1 HANDBOOK ON GERMAN ARMY IDENTIFICATION Left to right: Soldier (noncommissioned officer candidate-note silver cord across outer edge of shoulder strap), air force captain (belongs to staff, probably Air Ministry), SS Obergruppenfiihrer Josef Diet- rich (commander SS Division Adolf Hitler and chief of SS Oberabschnitt Ost), Hitler, Reichsfihrer SS Heinrich Himmler (head of the SS and German police). WAR DEPARTMENT, WASHINGTON, APRIL 9, 1943. HANDBOOK ON GERMAN ARMY IDENTIFICATION SECTION I. General. Paragraph Identification of German military and semi- military organizations --- ______ 1 II. German Order of Battle. Definition--___------------------------_ 2 Purpose and scope --- __ ___---- ----- 3 III. The German Army (Das Deutsche Heer). Uniforms and equipment-------_------- 4 German Army identifications of specialists - - 5 Colors of arms of service (Waffenfarbe) ___- _ _ 6 Enlisted men (Mannschaften)__ _____ 7 Noncommissioned officers (Unteroffiziere) .-- 8 Officers (Offiziere)--------------.--------- 9 German identification -

Hostage Case: Indictment
University of North Dakota UND Scholarly Commons Elwyn B. Robinson Department of Special Nuremberg Transcripts Collections 5-10-1947 Hostage Case: Indictment University of North Dakota Follow this and additional works at: https://commons.und.edu/nuremburg-transcripts Part of the History Commons Recommended Citation University of North Dakota, "Hostage Case: Indictment" (1947). Nuremberg Transcripts. 4. https://commons.und.edu/nuremburg-transcripts/4 This Court Document is brought to you for free and open access by the Elwyn B. Robinson Department of Special Collections at UND Scholarly Commons. It has been accepted for inclusion in Nuremberg Transcripts by an authorized administrator of UND Scholarly Commons. For more information, please contact [email protected]. I. INDICTMENT, INCLUDING APPENDIX LISTING POSITIONS OF THE DEFENDANTS The United States of America, by the undersigned Telford Taylor,Chief of Counsel for War Crimes, duly appointed to represent saidGovernment in the prosecution of war criminals, charges the defendantsherein with the commission of war crimes and crimes against humanity,as defined in Control Council Law No. 10, duly enacted by the AlliedControl Council on 20 December 1945. These crimes included murder,ill-treatment, and deportation to slave labor of prisoners of war andother members of the armed forces of nations at war with Germany, andof civilian populations of territories occupied by the German armedforces, plunder of public and private property, wanton destruction ofcities, towns, and villages, and other atrocities and offenses againstcivilian populations. The persons accused as guilty of these crimes and accordingly named as defendants in this case are: WILHELM LIST-Generalfeldmarschall (General of the Army) ; Commanderin Chief 12th Army, April-October 1941; Wehrmachtsbefehlshaber Sϋdost(Armed Forces Commander Southeast), June-October 1941; Commander inChief Army Group A, July-September 1942. -

Grossdeutschland NSDAP Verbaende Und Reichsregierung
32 Gkoßdeutschrand. —» Die mer-AP- B".- Großdeutschland I- Aufbau der NationalsozialistischenzDeutschen Arbeiterpartei (NSDAP.), ihrer Gliederungen lind »der angeschlossenen -. « Verbände.. sz ’ « - 1. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Reichsgeschästsstelle München. Der Führers Adolf Hitler zugleich Oberster ·SA.-Führer· Der Chef der ännzlei des Führers der NSVAPsz und angeschlossenen Verbande sowie die Stellen des Reiches undder Länder betreffend. « Reichsleiter Bouhle r« Philipp, Berlin W 8, Voßstraße 4. « Amt III, Amtsleiter V e rt e n t a m p - Huberh Bearbeitung von Gnasdensachen von Angehöri- Die Kanzleides Führers der RSDAP gen der Bewegung . "- — Amt I, hauptamtsleiter B o rm anfn . Albert: Amt IV, Amtsleiter E n y rim, Heinz:« Bearbei- Persönliche Angelegenheiten des Führers und tung von sozialwirtschaftlichen Angelegenheiten Sonderaufgaben. « - - und Gesuchen sozialer Art. " Amt 11-, Amtsleiter Vrack Viktor: Bearbeitung Amt V, Amtsleiter Jaens ch herbei-t: Personal-» von Eingaben, die NSDAP., ihre Gliederungen Und Verwaltungsangelegenheiten. - Der Stellvertreter des Führers: · . Rudolf Heß.« München, Braunes Haus, Brienner-Straße 45. « Die Reichsleilung der ASDAP R o se n b e r g Alfred, Leiter des Außenpolitischsen Amtes der NSDAP· und Beauftragter des Die Reichsleiter: Führers für die· gesamte geistige und welt- Amann Max, Reichsleiter der Presse. · anschauliche Erziehung der NSDAP. ; Bormann Martin, Stabsleiter des Stellver- Schirach Baldur v., Reichsjugendsührer. treters des Führers. ·" « Schwarz Franz Xaver, Reichsschatzmeister. - «Bouhler Philipp, Chef der Kanzlei des Christians en Friedrich, Korpssührer des Führers. NSFK. J Buch Walter, Oberster Parteirichter. D ar rö Malta-, Leiter des .Reichsamtes für Der Reichsorganisaliansleiler »der "JISDAP. und Agrarpolitik. — « Leiter der Deutschen Arbeits-freut Dietrich Okto, «Dr.", Reichspressechef der Reichsleiter Dr. Robert Ley, München, Baker- NSDAP — straße 15. -

Digitalisierungen in Der Abteilung Militärarchiv, Stand
Digitalisierte Einzelstücke und Bestände Digitalisiert werden Sachakten amtlicher Herkunft, dazu Karten und Technische Zeichnungen. Hinzu kommen herausgehobene Personalunterlagen. Darüber hinaus werden als Ergänzung auch Unterlagen privater Herkunft, insbesondere Nachlässe digitalisiert. Digitalisiert werden zum Teil die kompletten Bestände, zum Teil aber auch nur Bestandsportionen. Herausgehobene einzelne Archivalien werden teilweise vorab digitalisiert. (Stand: 31.7.2020) Flugblätter BArch MSg 235/3743 US-Flugblatt; ca. 1943/44 NEU Flugblätter aus den Weltkriegen Die Abt. Militärarchiv des Bundesarchivs verfügt über eine umfangreiche Sammlung deutscher und ausländischer Flugblätter aus beiden Weltkriegen. Die Sammlung wurde digitalisiert und steht zur Einsichtnahme im Internet zur Verfügung. MSg 235 Sammlung Flugblätter und Wandanschläge militärischer Einrichtungen https://invenio.bundesarchiv.de/invenio/direktlink/a28a4f88-b7ed-42b0-9ed4-6f12cc9f5386/ Herausgehobene Personalunterlagen Aktuell in der Digitalisierung und demnächst online Auswahl aus Pers 6 Personalunterlagen von Angehörigen der Reichswehr und Wehrmacht.- v.a. Personalakten der Generalfeldmarschalle, Generaloberste, Generale und Generalleutnante, dazu die Personaldossiers zweier Karteien des Heerespersonalamtes – der sog. Generalskartei und der Kartei der höheren Adjutanten und Offiziere des Heerespersonalamtes Das deutsche Engagement im Osmanischen Reich Digitalisierte Bestände und Einzelstücke zum deutschen Engagement im Osmanischen Reich folgen demnächst. Aktuell in -

VII. Das Kriegsende in Süddeutschland Und Die Konsolidierung Der Militärregierung
VII. Das Kriegsende in Süddeutschland und die Konsolidierung der Militärregierung 1. Letzte Kämpfe Ende Januar 1945, nach dem Scheitern der Offensive In den Ardennen und dem mächtigen sowjetischen Vorstoß von der Weichsel an die Oder, hatte die deutsche Kriegführung jegliche realistische Perspektive verloren. Nun war auch das in der poli tisch-militärischen Spitze des Reiches verbreitete, immerhin nicht gänzlich abwegige Kalkül dahin, die bedingungslose Kapitulation und der Untergang des Reiches ließen sich vielleicht doch noch irgendwie abwenden. Die Erklärung von Jalta und die Ver nichtung Dresdens setzten im Februar Ausrufungszeichen hinter das Menetekel. Im März, nachdem Eisenhower dem Westheer das Rückgrat gebrochen und den Rhein glatt forciert hatte, konnten in Deutschland weder Fachmann noch Laie weiterhin mit akzeptablen Argumenten behaupten, der totalen Niederlage im sechsten Jahr des tota len Krieges sei zu entrinnen. Die alliierten Stäbe waren über die verzweifelte Lage des Feindes genau im Bilde, dem neben der bedingungslosen Kapitulation nur noch eine einzige Handlungsmög• lichkeit geblieben sei, nämlich das bevorstehende Ende einige Augenblicke lang hin auszuzögern. [ Der SD kam in einer zusammenfassenden Analyse zur selben Erkennt nis: Der Zweifel am Sinn des weiteren Kampfes zerfresse die Einsatzbereitschaft und das Vertrauen der Bevölkerung: "Der bisher bewahrte Hoffnungsfunke ist am Auslö• schen".2 Dennoch war den Amerikanern Anfang April 1945 ebenso klar wie dem deutschen Sicherheitsdienst, daß es trotzdem nicht -
Die Reichsregierung Will Unter Sicherung Alter (R.G.Bl
Die Peithsregierung. Der Führer und Reichskanzler- Adolf Hitler. Reichsten-lei- Veklin w 8, Wilhelmsimße 78. Peicnsfinanzministeriumt Berlin W 8, Wilhelm- Reichsminifter und Chef der Neichskanzlei Dr. Heinrich platz lj2. Lammers. Reichsminifter der Finanzen: GrafSchwerin von Krosigt. Präsidiaikanzieir Staatsminister Dr. Meißner, Peitilsurirtscnastsministerium: Berlin W 8, Behan- Berlin W, Voßstraße 1. straße 43,45. Dem Führer und Reichskanzler unmittelbar Reichswirtfchaftsminister: Walther Funk. unterstellt sind: Generalinspektor fiir das deutsche Straßenwefem Reichs- und PreuBisciier Minister fiir Ernährung l)r. Jng. Todt, Berlin W s, Pariser Platz Z; und Landwirtschaft: R. Walther Dach, BerlinW8, Wilhelmstraße 72. Reichsstelle fiir Raumordnung: Leiter-, Neichsminifter und Preußischer Staatsminister Reichs- unei PreuBiscites Arbeitsministerium: Hans Kerrlz Berlin W 8, Unter den Linden 13—15. Jugendfiihrer des Deutschen Reiches-: Reichs- und Preußischer Arbeitsminifter: Franz Seldte. Veichsleiter Baldur von Schirach, Berlin NW 40, Kronprinzenufer 10; Peitnssustizministerium Berlin W 8, Wilhelm- Generalinspettor für die Reichshauptftadtt strasze 65. Pros. Alberi Speer; Reichsminifter der Justiz: l)1-. h. e. Franz Gärtner. Der Beauftragte für den Vierjahresplam Generalseldmarschall Hermann Göring, BerlinW8, Peitnspostministerium: Berlin W 66, Leipziger Leipziger Straße s; Straße 15. Reichspostminister: Dr. Jng. Wilhelm Ohnesorge. Reichsminister ohne Geschäftsbereich: Rudolf Heß, Stellvertreter des Führers, BerlinW 8, Wilhelmstraße 64. Peitilslrericenrsministerium: -
NARA T733 R2 Guide 25
GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA. No. 25. German Air Force Records: Luftgaukommandos, Flak, Deutsche Luftwaffenmission in Rumanian The National Archives National Archives and Records Service General Services Administration Washington: 1961 This finding aid, prepared "under the direction of the Committee for the Study of War Documents of the American Historical Association, has been reproduced by the National Archives as part of its program of facilitating the use of records in its custody* The microfilm described in this list has been deposited in the National Archives by the American Historical Association and may be identified as Microcopy No, T-ljOI>. It may be consulted at the National Archives* A price list appears on the last page* Those desiring to purchase microfilm should write to the Exhibits and Publications Branch, National Archives, Washington 2$, D. C. Some of the papers reproduced on the microfilm referred to in this and other guides of the same series may have been of private origin* The fact of their seizure is not believed to divest their original owners of any literary property rights in them. Anyone, therefore, who publishes them in whole or in part without permission of their authors may be held liable for infringement of such literary property rights. AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION COMMITTEE FOR THE STUDY OP WAR GUIDES TO GERMAN BECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA. No. 25« German Air Force Records: Luftgaukommandos, Flak, Deutsche Luftwaffemnission in RumSnien THE AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION -

Article-Ln-Abk-Verz.Pdf
Ab kür zun gsv er z eichnis Abst. Tr. Abstecl<trupp Abt. Abteilung A.K. Armeekorps a. Kr. auf Kriegsdauer (bei Beamten) A.O.K. (AOK) Armeeoberkonunando Ausb. Ausbildung Bofu Bordfunker Btl. Bataillon Chi-Stelle Chiffrierstelle d.B. des Beurlaubtenstandes (bei Beamten) d.G. des Generalstabes (Heer) d.L. der Landwehr (bei Soldaten) d.R. der Reserve (bei Soldaten) D.R.K. (DRK) Deutsches Rotes Kreuz Dunaja dunkle Nachtjagd D.V. Durchgangs-Vermittlung (Heer) d. Verf. der Verfasser Eis (E) Eisenbahn, verlastet E.K. Eisernes Kreuz Fe. Fernsprecher F~r. Führer und Fähnrich Fl. Div. Fliegerdivision Flg. Flieger FIg. H. Fliegerhorst Flg. PI. Flugplatz Fluko Flugwachkonunando Flum (Flugm.) Flugmelde Fluwa Flugwache Fsch. Fallschirm Fsch. Jg. Fallschirmjäger Fschr. WT. Tr. Fernschreib-Wechselstromtelegrafie:-Trupp Fschrb. (Fs) Fernschreib Fspr. (Fe) Fernsprem Fspr. Verm. Tr. Fernsprech-Vermittlungs-Trupp Fu (Fkr) Funker Fu.G. Funkgerät FuMG (FMG) Funkmeßgerät (Radar) GBN Generalbevollmächtigter für technische Nachrichtenmittel Geb. Gebirgs Gefr. Gefreiter geh. (g.) geheim geh. Kdos. (g.K.) geheime Kommandosache oder g. Kdos. Gen. (G) General Gen. d. Flak General der Flakartillerie Gen. d. FIg. General der Flieger Gen. d. Fsm. General der Fallschirmjäger 686 Gen. d. Ln. Tr. General der Luftnaduichtentruppe Gen. Lt. (GL) Generalleutnant Gen. Maj. (GM) Generalmajor Gen. Ob. (GO) Generaloberst Gfm. (GF) Generalfeldmarschall Gen. Kdo. Generalkommando Gen. Nafü Generalnachrichtenführer Gen. Qu. Generalquartiermeister Grp. Gruppe H (Ho) Horch, Funkhorch. Henaja helle Nachtjagd H.Grp. Heeresgruppe H.}. Hitler-Jugend Höh. Nafü Höherer Naduichtenführer (hot) bespannt im Soldatenjargon Hptm. Hauptmann HQ Hauptquartier HV Heeres-Vermittlung HVW Heeresnachrichten-Verbindungs-Wesen I Gruppe I (eins) in einem Stabe Ia Einsatzbearbeiter in einem Stabe Ib Nachschubbearbeiter Ie Feindnachrichtenbearbeiter I1NVW Nachrichten-Verbindungs-Wesen-Bearbeiter I.D. -
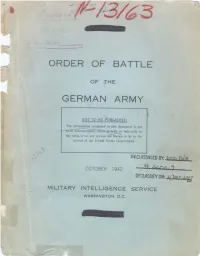
Usarmy Order of Battle GER Army Oct. 1942.Pdf
OF rTHE . , ' "... .. wti : :::. ' ;; : r ,; ,.:.. .. _ . - : , s "' ;:-:. :: :: .. , . >.. , . .,.. :K. .. ,. .. +. TABECLFCONENS TABLE OF CONTENTS Page FOREWORD iii - vi PART A - THE GERMAN HIGH COMMAND I INTRODUCTION....................... 2 II THE DEFENSE MINISTRY.................. 3 III ARMY GHQ........ 4 IV THE WAR DEPARTMENT....... 5 PART B - THE BASIC STRUCTURE I INTRODUCTION....................... 8 II THE MILITARY DISTRICT ORGANIZATION,- 8 III WAR DEPARTMENT CONTROL ............ 9 IV CONTROL OF MANPOWER . ........ 10 V CONTROL OF TRAINING.. .. ........ 11 VI SUMMARY.............. 11 VII DRAFT OF PERSON.NEL .... ..... ......... 12 VIII REPLACEMENT TRAINING UNITS: THE ORI- GINAL ALLOTMENENT.T. ...... .. 13 SUBSEQUENT DEVELOPMENTS... ........ 14 THE PRESENT ALLOTMENT..... 14 REPLACEMENT TRAINING UNITS IN OCCUPIED TERRITORY ..................... 15 XII MILITARY DISTRICTS (WEHRKREISE) . 17 XIII OCCUPIED COUNTRIES ........ 28 XIV THE THEATER OF WAR ........ "... 35 PART C - ORGANIZATIONS AND COMMANDERS I INTRODUCTION. ... ."....... 38 II ARMY GROUPS....... ....... .......... ....... 38 III ARMIES........... ................. 39 IV PANZER ARMIES .... 42 V INFANTRY CORPS.... ............. 43 VI PANZER CORPS...... "" .... .. :. .. 49 VII MOUNTAIN CORPS ... 51 VIII CORPS COMMANDS ... .......... :.. '52 IX PANZER DIVISIONS .. " . " " 55 X MOTORIZED DIVISIONS .. " 63 XI LIGHT DIVISIONS .... .............. : .. 68 XII MOUNTAIN DIVISIONS. " """ ," " """ 70 XII CAVALRY DIVISIONS.. .. ... ". ..... "s " .. 72 XIV INFANTRY DIVISIONS.. 73 XV "SICHERUNGS" -

Die Ardennen-Offensive 1944 Hitlers Letzte Schlacht Im Westen
Leseprobe Antony Beevor Die Ardennen-Offensive 1944 Hitlers letzte Schlacht im Westen »Scharf in der Analyse, lebendig und anschaulich geschrieben.« Joachim Käppner, Süddeutsche Zeitung Bestellen Sie mit einem Klick für 17,00 € Seiten: 480 Erscheinungstermin: 26. März 2018 Mehr Informationen zum Buch gibt es auf www.penguinrandomhouse.de Inhalte Buch lesen Mehr zum Autor Zum Buch Das letzte Aufbäumen Hitlers – die wohl brutalste Schlacht des Zweiten Weltkriegs Im August 1944 schien das Ende des Zweiten Weltkrieges nah, das Deutsche Reich war in Auflösung begriffen. Doch Hitler beschloss, noch einmal alles auf eine Karte zu setzen. Am 16. Dezember 1944 startete die Ardennen-Offensive – es war der Beginn der wohl brutalsten Schlacht des Zweiten Weltkriegs. Präzise und faktenreich beschreibt Antony Beevor, einer der renommiertesten Historiker zur Militärgeschichte, diese sechs Wochen im Winter 1944/45. Detailliert stellt er die Frontverläufe dar, dem einfachen Soldaten und der auf allen Seiten in die Kämpfe verwickelten Bevölkerung verleiht er eine Stimme. Auf diese Weise gelingt ihm ein eindrucksvoll lebendiges Geschichtspanorama. Autor Antony Beevor Antony Beevor, Jahrgang 1946, hat sich mit mehrfach ausgezeichneten und in zahlreiche Sprachen übersetzten Büchern einen Namen gemacht. Er ist weltweit der erfolgreichste Autor zu Antony Beevor Die Ardennen-Offensive 1944 Hitlers letzte Schlacht im Westen Aus dem Englischen übertragen von Helmut Ettinger Pantheon 3332_55374_Beevor_Ardennen_Titelei.indd32_55374_Beevor_Ardennen_Titelei.indd 3 220.02.180.02.18 006:506:50 Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Ardennes 1944. Hitler’s Last Gamble« bei Viking, London. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. -

50 Jahre Clausewitz-Gesellschaft E.V. Chronik 1961
50 Jahre Clausewitz-Gesellschaft e.V. Chronik 1961 - 2011 Chronik der Clausewitz-Gesellschaft e.V. 1961 - 2011 Herausgeber und Copyright 2011 Clausewitz-Gesellschaft e.V., Hamburg Manteuffelstraße 20, D-22587 Hamburg Internet: www.clausewitz-gesellschaft.de Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenze des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Clausewitz-Gesellschaft e.V. bzw. der Autoren unzulässig. Redaktion: Viktor Toyka, Rüdiger Kracht, Clausewitz-Gesellschaft e.V. Lektorat: Werner Baach, Wolfgang Fett, Clausewitz-Gesellschaft e.V. Layout und Satz: Sebastian Reichold, Zentrum Operative Information Umschlaggestaltung: Sebastian Reichold, Zentrum Operative Information Bilder: Bundeswehr (Informations- und Medienzentrale, Standortkommando Berlin), Clausewitz-Gesellschaft, Zentrum elekronische Medien der Schweizer Armee Gesamtherstellung: Clausewitz-Gesellschaft e.V. Umschlagabbildung: Clausewitz-Gesellschaft e.V. Druck: Kommando Strategische Aufklärung Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier (chlorfrei gebleicht). ISBN: 978-3-9810794-6-3 2 Inhalt Seite Geleitwort des Ehrenpräsidenten, General a.D. Wolfgang Altenburg 4 Vorwort des Präsidenten, Generalleutnant a.D. Dr. Klaus Olshausen 6 Einführung 9 I. Von der kameradschaftlichen Vereinigung zur wehrwissenschaftlichen Gellschaft 11 II. Ausbau der Gesellschaft und organisatorische Festigung 26 III. Der Weg zum Internationalen Forum 41 IV. Kontinuität und Fortschritt 54 V. Die Nachkriegsgeneration – Die Gesellschaft